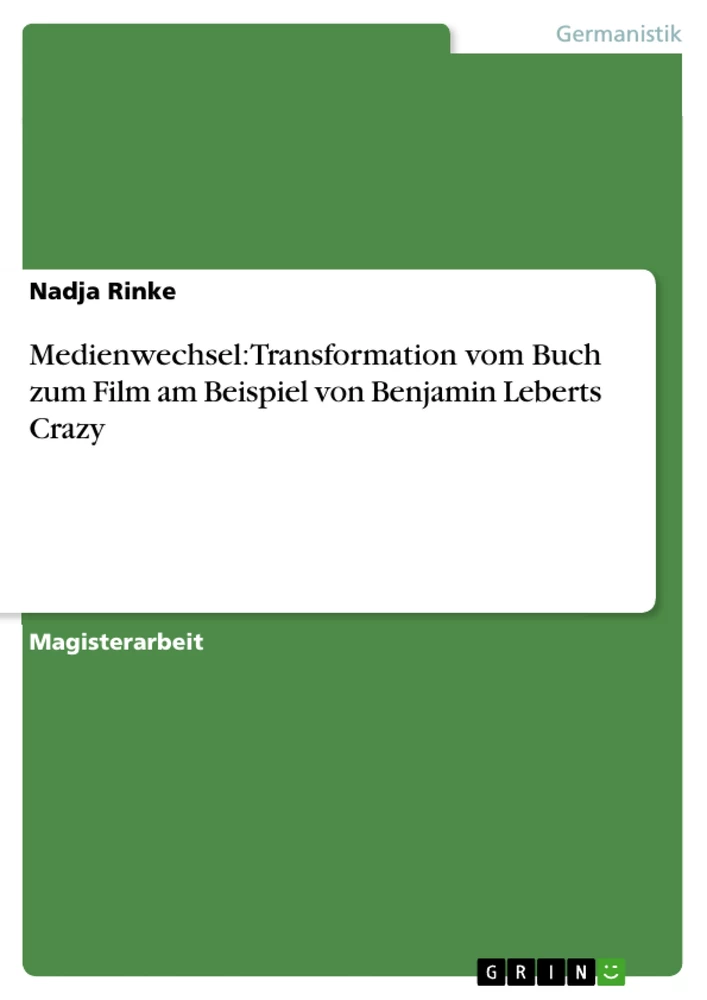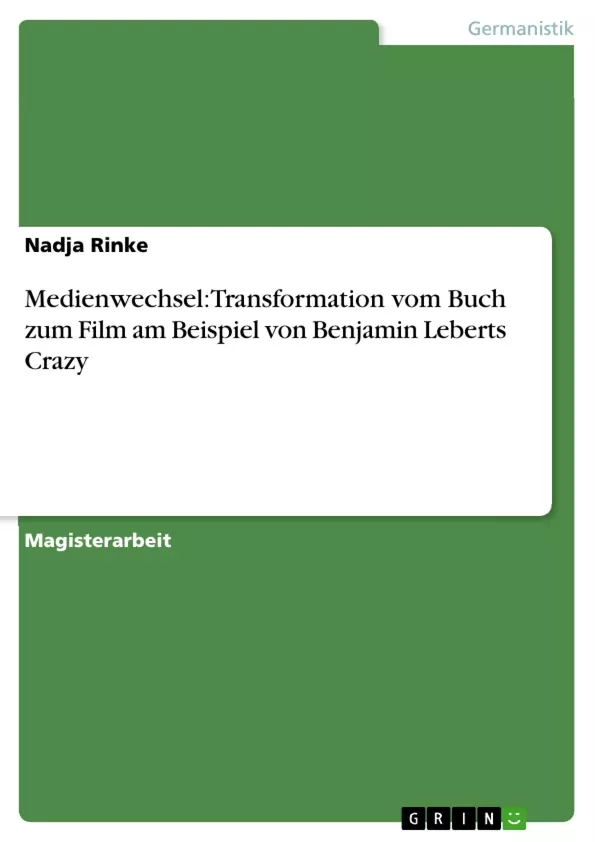Die Verfilmung literarischer Werke ist zunehmend zu einer Selbstverständlichkeit in der Literaturverfilmung Filmgeschichte geworden. als Gegenstandsbereich der Literaturwissenschaft ist allerdings weniger etabliert. Lange Zeit stand die Literaturwissenschaft dem Medium Film äußerst skeptisch gegenüber, und auch heute gibt es noch Methodenprobleme bei der Analyse verfilmter Literatur. Die Transformation eines literarischen Werkes in das Massenmedium Film ist eine Herausforderung, sowohl für die Literatur- als auch für die Filmwissenschaft. Der Film, als „Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit“ und in seiner Eigenschaft als technisches Medium, ist für viele Schriftsteller der wichtigste Auftraggeber geworden. Dennoch sind Verfilmungen, vor allem klassischer Literatur, noch immer der Auslöser für den Missmut vieler Literaturkritiker, die in dem Medium Film einen der Massenunterhaltung dienenden Illusionsapparat sehen, der mit Kultur- und Literaturvernichtung identisch zu sein scheint. Nun ist das Medium Film nicht aus dem Nichts entstanden, sondern das Produkt einer schon existierenden und sich immer weiter entwickelnden Medienkultur. Die Entstehung neuer Medien geschah einerseits immer aus der Idee heraus, eine schnellere und weiträumigere Kommunikationstechnik zu finden. Andererseits ist Kommunikation ohne mediale Vermittlungssysteme, die die Aufzeichnung und Verbreitung kulturellen Wissens ermöglichen, nicht denkbar. Die zur Verbreitung dienenden Mittel reichen von der mündlichen Überlieferung bis hin zur heute existierenden Digitalisierung. Dass Weltwahrnehmung und Kommunikation notwendigerweise an Medien gebunden sind, hat schon Platon in seinem Höhlengleichnis zum Ausdruck gebracht. Auch Luhmann erklärt: „Was wir über unsere Gesellschaft, ja über die Welt, in der wir leben, wissen, wissen wir durch die Massenmedien“. Diese Erkenntnis ist fast genauso alt wie die Tendenz medialer Systeme, zu interagieren und sich wechselseitig aufeinander zu beziehen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Crazy
- 1.2. Methodische Herangehensweise
- 2. Der Begriff des Mediums
- 2.1. Termini der Intermedialitätsforschung
- 2.2. Theoretische Modelle der Intermedialitätsforschung
- 2.3. Intermediale Wechselbeziehungen von Film und Literatur
- 2.4. Transkriptivität
- 2.5. Theatralität
- 3. Der Film als Kunstform zwischen Erzähltext und Theater
- 3.1. Der Vorspann
- 3.2. Die Kamera als Erzähler
- 3.3. Inszenierung und Dramaturgie
- 3.4. Literarische Nullpositionen
- 3.5. Montage und Schnitt
- 3.6. Musik und Geräusche
- 4. Analyse: Der Medienwechsel vom Buch Crazy zum Film Crazy
- 4.1. Exposition
- 4.2. Striptease in Rosenheim
- 4.3. Das Drehbuch als intermediale Zwischenstufe
- 4.4. Buch - Drehbuch - Film
- 5. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Magisterarbeit befasst sich mit dem Thema der Literaturverfilmung am Beispiel von Benjamin Leberts Roman „Crazy“. Ziel ist es, die Transformation des Romans in das Medium Film unter Berücksichtigung intermedialer Verfahren zu analysieren.
- Der Begriff des Mediums und seine Relevanz für die Intermedialitätsforschung
- Die Wechselbeziehung zwischen Film und Literatur sowie die Besonderheiten des Medienwechsels
- Die Analyse von Kontinuitäten und Veränderungen im Transformationsprozess vom Buch zum Film
- Die Erörterung der Frage, welche neuen Sinndimensionen durch das Zusammenspiel literarischer und filmischer Strukturen entstehen
- Die Untersuchung der medienspezifischen Bedeutungskonstitutionen und ästhetischen Wirkung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Thematik der Literaturverfilmung und die Relevanz des gewählten Beispiels „Crazy“ beleuchtet. Anschließend wird der Begriff des Mediums im Kontext der Intermedialitätsforschung erörtert, wobei verschiedene theoretische Modelle und die besonderen Wechselbeziehungen zwischen Film und Literatur behandelt werden.
Kapitel 3 widmet sich der Analyse des Films als Kunstform, wobei die spezifischen Merkmale wie Vorspann, Kameraführung, Inszenierung und Dramaturgie im Vergleich zum Erzähltext untersucht werden.
Im vierten Kapitel steht die konkrete Analyse des Medienwechsels vom Buch „Crazy“ zum Film „Crazy“ im Mittelpunkt. Die Exposition des Romans und des Films werden verglichen, und die Bedeutung des Drehbuchs als intermediale Zwischenstufe wird herausgearbeitet.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Arbeit lassen sich mit folgenden Schlüsselbegriffen zusammenfassen: Intermedialität, Literaturverfilmung, Medienwechsel, Transkriptivität, Theatralität, Film- und Literaturanalyse, ästhetische Wirkung, Bedeutungskonstitution, „Crazy“ von Benjamin Lebert.
- Arbeit zitieren
- Nadja Rinke (Autor:in), 2006, Medienwechsel: Transformation vom Buch zum Film am Beispiel von Benjamin Leberts Crazy, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/59231