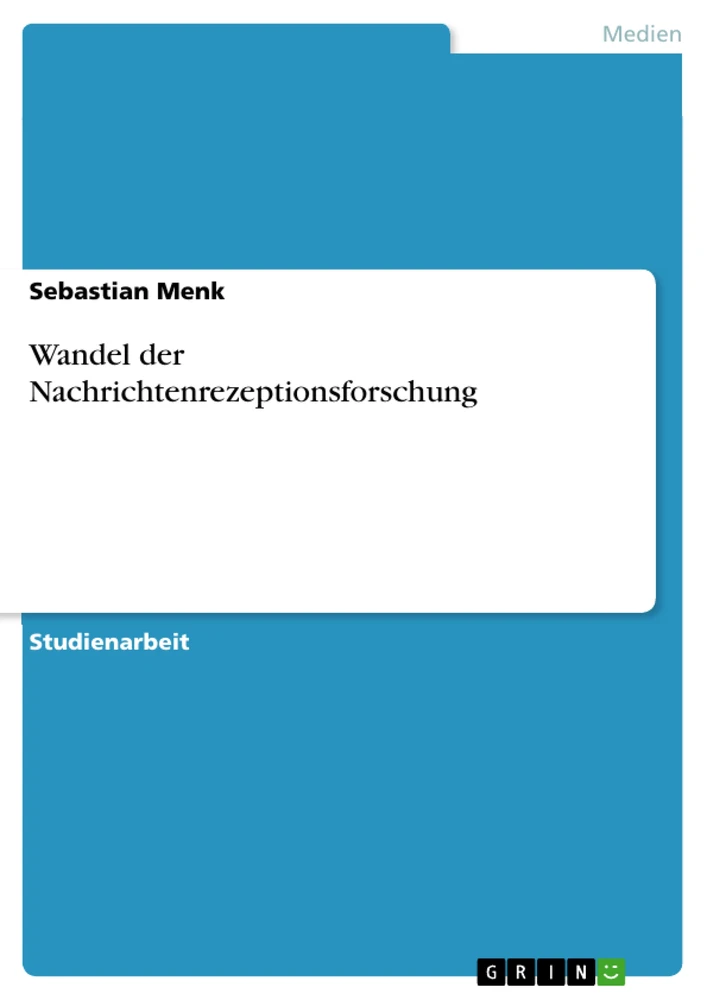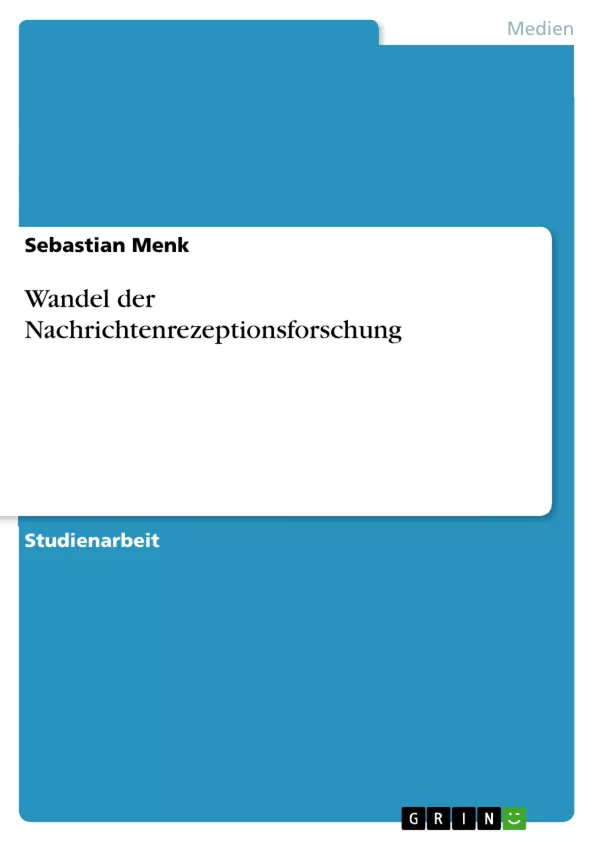In nahezu allen deutschen Haushalten steht mittlerweile ein Fernsehgerät. Im Jahr 2003 belief sich die durchschnittliche Sehdauer pro Tag - nach den Messungen der GfK - auf 203 Minuten, womit insgesamt 75 Prozent aller Bundesbürger an einem gewöhnlichen Wochentag fern sahen. Davon entfallen 63 Minuten auf Informationssendungen der einzelnen Fernsehsender (Darschin/ Gerhard 2004: 142/48). Unter diesen wiederum werden Nachrichtensendungen, ausgehend vom gesamten Zuschauerinteresse, noch vor Spielfilmen und Sportsendungen gesetzt. Insgesamt sind im Jahre 1997 91 Prozent der Deutschen über 14 Jahre an Fernsehnachrichten interessiert. Auch im Jahr 2002 ist das große Interesse an Nachrichten ungeteilt, womit es weiterhin zu den beliebtesten Sendungen Deutschlands gehört (vgl. AGF/GfK 2002). Die Mehrheit der Zuschauer sieht sich die Hauptnachrichtensendung der ARD, die „Tagesschau“ an, welche - mit der ersten Sendung am 26.12.1952 - seit nunmehr über 50 Jahren ausgestrahlt wird. Daneben etablierte sich einige Jahre darauf die Sendung „heute“ des ZDF. Mitte der 1980er Jahre kamen schließlich die privaten Sender hinzu, mit den ihnen typischen, weniger seriösen und eher auf Unterhaltung setzenden, Nachrichtensendungen. Mit der Herausbildung des dualen Fernsehsystems stieg das Interesse der Kommunikationsforscher, für das Segment der Nachrichten - vor allem der Rezeption dieser - enorm an. Innerhalb der letzten zwei Jahrzehnte vollzog sich, mit der progressiven Entwicklung des Fernsehens - angemerkt sei die Ökonomisierung, Digitalisierung und Wandlung der inhaltliche Elemente unter anderem - auch ein Umbruch hinsichtlich der Erforschung dieses Alltagsstücks. Insbesondere im Bereich der Nachrichtenrezeptionsforschung erfolgte ein Diskurs, in deren Mittelpunkt die Grundlagen der früheren Studien angezweifelt worden sind. Axiomatisch fundamentale Gesichtspunkte einer „eher stimuluszentrierten Forschungslogik“, wonach alle Zuschauer der Nachrichten rational handelnd auf einen Informationsgewinn. abzielen, wurden in der Folgezeit aufgebrochen. Mittlerweile zahlreich vorhanden sind umfangreiche Studien, in denen subjektive Interpretationsmuster eines jeden einzelnen Nachrichtenrezipienten als Basis der Untersuchung dienen (Gleich 1998: 524). Der Beginn jener Entwicklung, hin zu den aktuellen Methoden, ist gegen Ende der Achtziger zu datieren. [...]
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Bereiche der Nachrichtenforschung
- III. Abkehr von rational handelnden Personen und kollektiven Nachrichtenrezeptionsmodellen
- 1) Veränderungen der Forschungslogik zur Nachrichtenrezeption
- 2) Christiane Eilders – Häufigkeit und Ausprägung von Nachrichtenfaktoren bei der Rezeption
- a) Grundlagen I: Nachrichtenwerttheorie nach Galtung und Ruge
- b) Grundlagen II: Der dynamisch-transaktionale Ansatz nach Früh/Schönbach 1982
- c) Eilders Forschungshypothese
- d) Ergebnisse zur Beitragsauswahl
- e) Ergebnisse zur Beitragserinnerung
- f) Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Beitragsauswahl und Beitragserinnerung
- IV. Heutige Nachrichtenrezeption und Probleme der Rezeptionsforschung
- 1) Zuschauertendenzen bei Nachrichten im Zeitraum 1999 bis 2003
- 2) Methodische Ansätze der Nachrichtenforschung und deren Problematik
- V. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert den Wandel in der Nachrichtenrezeptionsforschung und beleuchtet die Abkehr von einem rationalen Rezipientenmodell. Der Fokus liegt auf der Darstellung der Studie "Nachrichtenfaktoren und Rezeption" von Christiane Eilders, die ein Beispiel für eine moderne Forschungslogik bietet, die subjektive Interpretationsmuster in den Vordergrund stellt.
- Veränderungen der Forschungslogik in der Nachrichtenrezeption
- Eilders Studie: Nachrichtenfaktoren und Rezeption
- Die Bedeutung subjektiver Interpretationsmuster
- Aktuelle Herausforderungen und Problemfelder in der Nachrichtenrezeptionsforschung
- Zusammenhang zwischen Rezeption und der gesellschaftlichen Wirklichkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und beleuchtet die Relevanz von Nachrichtensendungen im heutigen Fernsehprogramm. Kapitel II definiert die Bereiche der Nachrichtenforschung, darunter die Nachrichtenproduktion, die Analyse von Nachrichteninhalten und die Rezeption von Nachrichten. Kapitel III widmet sich dem Wandel in der Rezeptionsforschung und stellt die Studie von Christiane Eilders vor. Eilders' Forschung greift die Nachrichtenwerttheorie von Galtung und Ruge sowie den dynamisch-transaktionalen Ansatz von Früh/Schönbach auf und präsentiert Erkenntnisse über die Auswahl und Erinnerung von Nachrichtenbeiträgen. Kapitel IV beleuchtet aktuelle Zuschauerverhaltenstrends im Nachrichtenbereich und problematisiert methodische Ansätze der Rezeptionsforschung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt zentrale Themen der Nachrichtenrezeption, darunter die Forschungslogik der Rezeptionsforschung, subjektive Interpretationsmuster, Nachrichtenfaktoren, Nachrichtenwerttheorie, Rezeptionsprozesse, methodische Ansätze und aktuelle Trends in der Mediennutzung. Die Relevanz von Nachrichtensendungen für die Gesellschaft und das Individuum wird ebenso beleuchtet.
- Quote paper
- Sebastian Menk (Author), 2005, Wandel der Nachrichtenrezeptionsforschung, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/58796