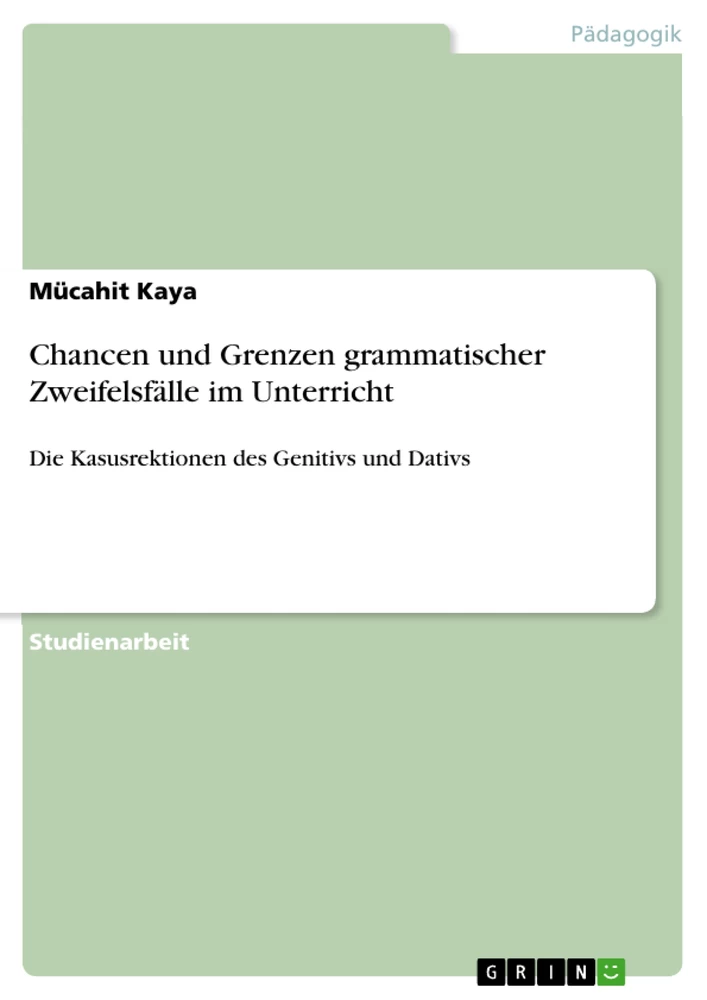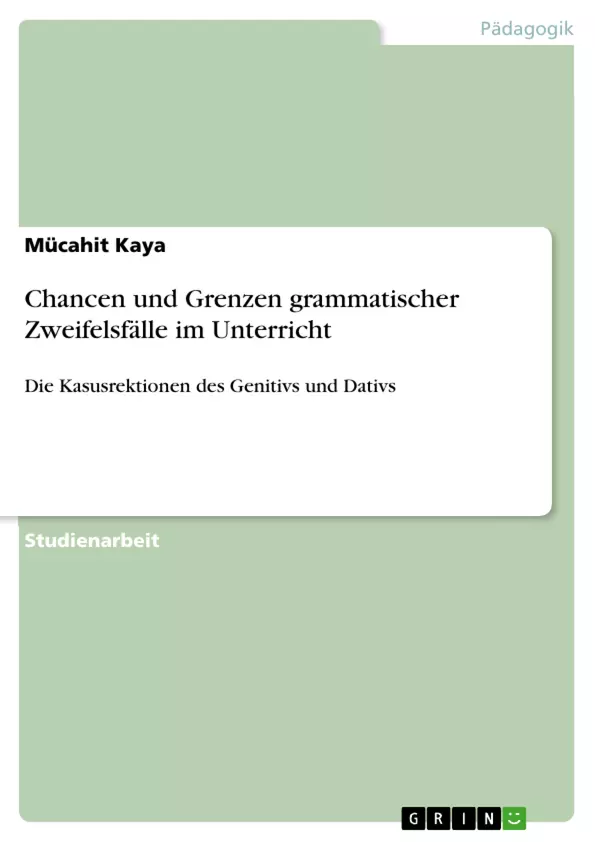Heißt es wegen dem Pferd oder doch wegen des Pferds? Mit beiden Varianten kommen Sprecher des Deutschen zumeist in Kontakt. Und nicht Wenige fragen sich dabei: Welche Variante ist richtig? Ob tatsächlich eine richtige Variante existiert, soll diese Arbeit aufklären.
Weiterhin wird Aufschluss über Positionen von Sprachverständnissen gegeben, die sich anhand der Erkenntnisse, ob Sprache "richtig" sein kann oder nicht, orientieren werden. Es gilt, die errungenen Erkenntnisse im Schulkontext zu verorten, um die Frage zu beantworten, ob grammatische Zweifel einen Gewinn für den bewussten Umgang mit Sprache sowie Sprachwandel darstellen.
Um das Themenfeld der sprachlichen Zweifelsfälle exemplarisch verorten zu können, wird dies anhand der Kasusrektionen des Genitivs und Dativs unternommen. Hierfür wird der Begriff des sprachlichen Zweifelsfalls definiert. Mit der Definition gehen die Positionen der sprachlichen Zweifelsfälle einher, welche verschiedene Verständnisse von Sprachzweifeln aufweisen. Im Hinblick auf niedersächsische Kerncurricula werden Auszüge aus Lehrwerken analysiert, womit die Bestandsaufnahme in der Schule erfasst wird. Die Analyse soll den Weg für alternative Schulaufgaben ebnen, welche praktikabel für die Schule sein sollten. Die Alternativen werden im Kontext der Positionen formuliert, wodurch ebenso ein Diskurs der Herangehensweisen angestrebt wird. Komplementiert wird demnach die theoretische Ebene durch die praktische Ebene, in denen linguistische Perspektiven sowie Schulbezüge hergestellt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition der sprachlichen Zweifelsfälle
- Die theoretische Ebene
- Perspektiven auf die deutsche Sprache
- Die Kasusrektionen des Genitivs und Dativs
- Die praktische Ebene
- KC-Einordnung
- Lehrwerkanalyse
- Alternative Vorschläge
- Zwischen normativen und deskriptiven Positionen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Phänomen der grammatischen Zweifelsfälle im Unterricht. Ziel ist es, die Chancen und Grenzen der Auseinandersetzung mit solchen Zweifelsfällen in der sprachlichen Bildung zu beleuchten. Die Arbeit analysiert anhand des Beispiels der Kasusrektionen des Genitivs und Dativs, wie sprachliche Zweifelsfälle im Schulkontext behandelt werden können und welche didaktischen Möglichkeiten sich daraus ergeben.
- Definition des Begriffs „sprachlicher Zweifelsfall“
- Normative und deskriptive Perspektiven auf die deutsche Sprache
- Die Rolle der Kasusrektionen des Genitivs und Dativs im Schulkontext
- Analyse von Lehrwerken und Schulmaterialien
- Entwicklung alternativer Unterrichtsansätze
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der sprachlichen Zweifelsfälle ein und beleuchtet die Problematik der unterschiedlichen sprachlichen Varianten. Das erste Kapitel beschäftigt sich mit der Definition des Begriffs „sprachlicher Zweifelsfall“ und analysiert verschiedene Positionen im Hinblick auf sprachliche Norm und Variation. Im zweiten Kapitel werden normative und deskriptive Perspektiven auf die deutsche Sprache beleuchtet. Dabei wird auch auf die Rolle der Kasusrektionen des Genitivs und Dativs im Schulkontext eingegangen. Das dritte Kapitel widmet sich der Analyse von Lehrwerken und Schulmaterialien im Hinblick auf die Einordnung von sprachlichen Zweifelsfällen. Es werden auch alternative Unterrichtsansätze entwickelt und diskutiert.
Schlüsselwörter
Sprachliche Zweifelsfälle, Kasusrektionen, Genitiv, Dativ, normative Grammatik, deskriptive Grammatik, Sprachwandel, Schulgrammatik, Unterrichtsmaterialien, Didaktik.
- Quote paper
- Mücahit Kaya (Author), 2019, Chancen und Grenzen grammatischer Zweifelsfälle im Unterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/584086