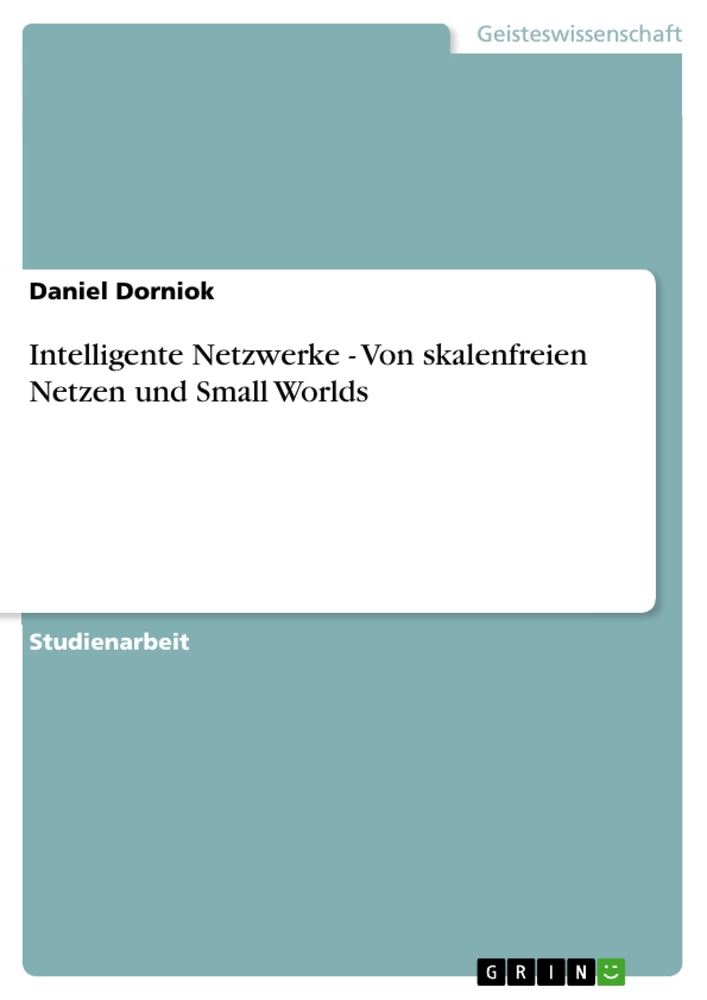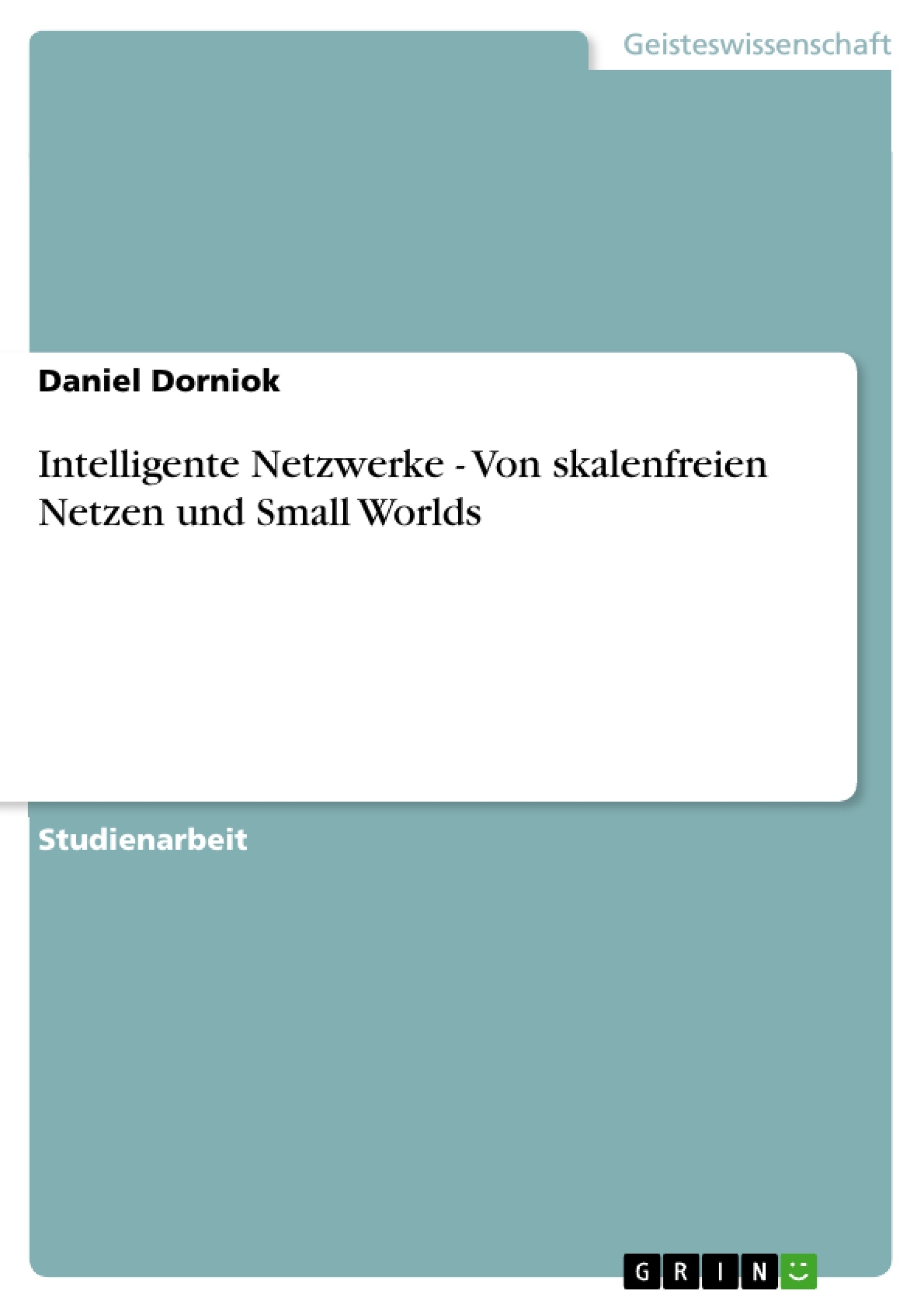Theoretisch sind komplexe Netze und Systeme von verschiedenster Art denkbar und unterscheidbar. So zum Beispiel Nervensysteme, Ökosysteme, soziale Systeme, die Gesellschaft, Stromnetze, Transportsysteme, das Internet, das World Wide Web, die Sprache etc. Um untersuchen zu können, ob diese auf den ersten Blick grundverschiedenen und vielfältigen Konzepte von Netzen und Systemen trotzdem gemeinsame Organisationsprinzipien aufweisen und oder bestimmten Gesetzmäßigkeiten gehorchen, sind Netze als Graphen zu unterscheiden und zu operationalisieren. Graphen der Graphentheorie stellen die jeweiligen Elemente als Knoten abstrahiert in einem gedachten Netz und die Beziehungen zwischen ihnen als Fäden oder auch Kanten dar. Das Grundprinzip ist dabei also, dass einzelne Objekte, z. B. Personen oder Zellen als Knoten repräsentiert sind, zwischen denen eine Kante besteht, wenn zwischen ihnen eine bestimmte, dann näher spezifizierbare Beziehung besteht. Durch dieses Vorgehen werden die verschiedenen Netze vergleichbar. Für die Untersuchung irrelevante Unterschiede werden eliminiert und interessierende potentielle Gemeinsamkeiten werden vergleichbar.
Auf diese Weise wird deutlich, dass viele Netze ganz bestimmte Eigenschaften aufweisen. Die mathematisierte Netzwerkforschung konnte eine Pluralität von Strukturmustern feststellen, manche Prinzipien liegen vielen komplexen Systemen zugrunde. Besonders interessant sind dabei aber die skalenfreien Netze. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie durch eine relativ geringe Zahl von sehr großen Knoten beherrscht werden, die mit sehr vielen andern verbunden sind. Als Größe wird dabei also die Anzahl der Verbindungen, die von einem Knoten ausgehen, bezeichnet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Small Worlds
- Das Milgram Experiment
- Erdös
- Granovetter
- Baran und seine intelligenten Netzwerke
- Watts und Strogatz
- Skalenfreie Netze
- Das Internet
- Das World Wide Web
- Weitere skalenfreie Netze
- Entstehung von skalenfreien Netzen
- Verhalten skalenfreier Netze bei Störungen und Angriffen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text analysiert die strukturellen Eigenschaften von komplexen Netzwerken und untersucht die Gemeinsamkeiten und Gesetzmäßigkeiten, die diesen Systemen zugrunde liegen. Der Fokus liegt dabei auf der Unterscheidung zwischen geordneten und zufälligen Netzstrukturen sowie der besonderen Eigenschaften skalenfreier Netzwerke.
- Die Untersuchung der Struktur und Organisationsprinzipien von Netzwerken
- Die Erforschung des Zusammenhangs zwischen „Small Worlds" und skalenfreien Netzen
- Die Analyse des Verhaltens skalenfreier Netze im Umgang mit Störungen und Angriffen
- Die praktische Anwendung der Erkenntnisse in Bereichen wie Kommunikation und soziale Strukturen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den theoretischen Rahmen für die Analyse von Netzwerken vor. Sie beschreibt die Methode der Graphentheorie, die es ermöglicht, unterschiedliche Arten von Netzwerken zu vergleichen und Gemeinsamkeiten zu identifizieren. Das Kapitel betont die Besonderheit von skalenfreien Netzen, die durch eine geringe Anzahl von großen Knoten mit vielen Verbindungen dominiert werden.
Das Kapitel "Small Worlds" untersucht das Experiment von Stanley Milgram, das die Existenz von "sechs Freiheitsgraden der Trennung" (six degrees of separation) in sozialen Netzwerken aufzeigt. Es werden die Beiträge von Erdös, Granovetter und Baran vorgestellt, die die Entstehung von Small Worlds weiter beleuchten. Das Kapitel endet mit der Diskussion der Arbeiten von Watts und Strogatz, die die Entstehung von Small Worlds durch die Einführung von Zufallsverbindungen in geordnete Netzwerke erklären.
Schlüsselwörter
Der Text befasst sich mit den Themen Netzwerke, Graphentheorie, "Small Worlds", skalenfreie Netze, zentrale Knoten, Störungen, Angriffe, Redundanz, Kommunikationsnetze, soziale Strukturen, Milgram Experiment, Erdös, Granovetter, Baran, Watts, Strogatz, und der "Stärke schwacher Bindungen".
- Quote paper
- Daniel Dorniok (Author), 2005, Intelligente Netzwerke - Von skalenfreien Netzen und Small Worlds, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/58291