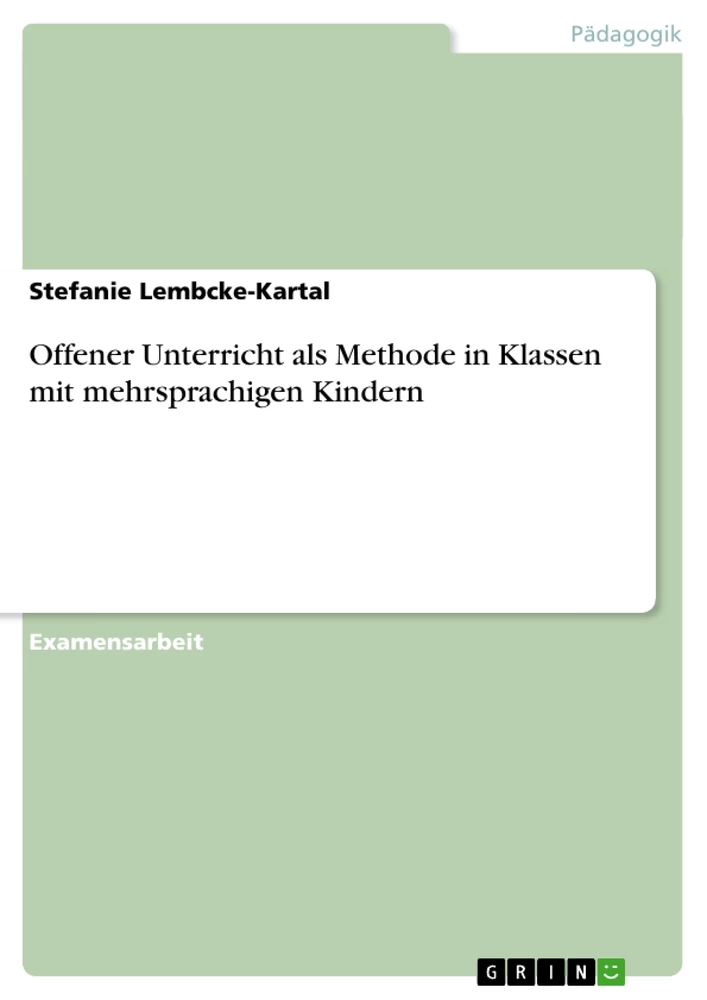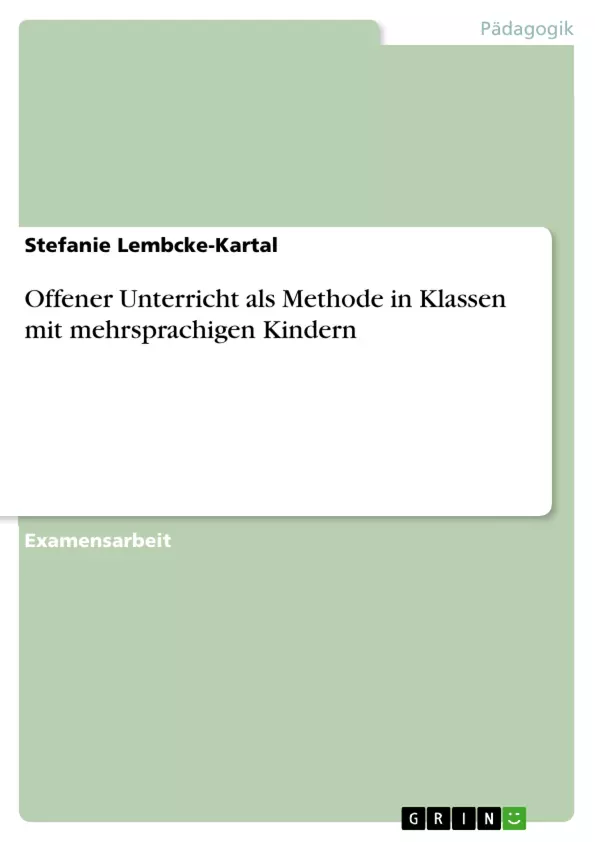Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einer Grundschullehrerin, die eine multikulturelle Klasse unterrichtete, in der viele Kinder sehr unterschiedliche, zum Teil geringe Deutschkenntnisse hatten. Die Lehrerin meinte, sie könnte unter diesen Umständen nicht vernünftig arbeiten. Ich fand, dass diese Aussage eine falsche Einstellung zu ihrer Aufgabe und zum Kind verriet, verstand aber andererseits, dass sie sich in dieser Situation überfordert fühlte und ihren Ansprüchen an ihren Unterricht nicht gerecht werden konnte. Sie plädierte dafür, die Kinder so lange auszusondern, bis sie vernünftig Deutsch sprachen, und berief sich dabei auf ein nicht näher bezeichnetes kanadisches Modell. Mir reichte das nicht aus.
Da ich selbst mit einem türkischen Muttersprachler verheiratet bin und unsere Kinder zwei- oder mehrsprachig aufwachsen sollen, fühle ich mich von der Thematik direkt betroffen. Als angehende Sonderschullehrerin werde ich auch im Beruf mit mehrsprachigen Kindern konfrontiert werden, die unterschiedliche Deutschkenntnisse, aber andere Kompetenzen haben. Die Aufgabe der Schulkinder ist nicht, mir oder anderen Lehrern einen Arbeitsplatz zu schaffen oder das Arbeiten leicht zu machen. Unsere Aufgabe als Pädagogen ist es, allen Kindern das Lernen zu ermöglichen. Es ist notwendig, nach einer Unterrichtsmethode zu suchen, die den Bedürfnissen der Kinder entspricht, anstatt die Kinder der Schule anpassen zu wollen.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 1. Kinder unter der Bedingung von Mehrsprachigkeit
- 1.1 Mehrsprachigkeit - Begriffsklärung
- 1.2 Modelle zum Erst- und Zweitspracherwerb
- 1.2.1 Spracherwerbsansätze
- 1.2.2 Der Kognitive Spracherwerbsansatz und die Entwicklung des Wortschatzes
- 1.2.3 Formen von Mehrsprachigkeit
- 1.2.4 Interdependenzhypothese
- 1.2.5 Psychosoziale Faktoren gelungener Mehrsprachigkeit
- 1.3 Relevanz der Beachtung von Mehrsprachigkeit und Mehrkulturalität
- 1.3.1 Exkurs: Kulturimperialismus, Kultureller Relativismus und Kultureller Interpopulismus
- 1.4 Statistische Informationen
- 1.5 Fazit Mehrsprachigkeit
- 2. Offener Unterricht
- 2.1 Begriffsklärung
- 2.2 Bausteine der Methode
- 2.2.1 Gesprächskreise
- 2.2.2 Wochenplanarbeit
- 2.2.3 Freie Arbeit
- 2.3 Ziele der Methode
- 2.3.1 Entdeckendes Lernen und die Erziehung zur Eigenverantwortung
- 2.3.2 Beachtung der kindlichen Persönlichkeit und Einbeziehung der Lern- und Lebenswelten
- 2.4 Die Aufgaben der Lehrkraft
- 2.4.1 Planen von Lernsituationen und Zulassen von eigenen Lösungswegen
- 2.4.2 Analysierende Begleitung - Zur Frage der Diagnostik
- 2.5 Der Klassenraum
- 2.6 Fazit Offener Unterricht
- 3. Schulpolitische Rahmenbedingungen
- 3.1 Richtlinien der Grundschulen
- 3.2 Vorgaben des Lehrplans
- 3.3 Die Beschulung von Kindern unter der Bedingung von Mehrsprachigkeit
- 3.4 Fazit schulpolitische Rahmenbedingungen
- 4. Offener Unterricht in Klassen mit Kindern unter der Bedingung von Mehrsprachigkeit
- 4.1 Der Gesprächskreis mit mehrsprachigen SchülerInnen
- 4.2 Die Wochenplanarbeit mit mehrsprachigen SchülerInnen
- 4.3 Die Freie Arbeit mit mehrsprachigen SchülerInnen
- 4.4 Vorüberlegungen der Lehrkraft - persönliche Grundeinstellung und Möglichkeiten
- 5. Offener Unterricht mit Kindern unter der Bedingung von Mehrsprachigkeit anhand der fiktiven Grundschulklasse X
- 5.1 Vorstellung der Klasse
- 5.1.1 Klassenstruktur
- 5.1.2 Vorstellung der mehrsprachigen Kinder
- 5.2 Das Thema "Familie" im offenen Sachunterricht
- 5.2.1 Einführung des Projektthemas "Familie"
- 5.2.2 Das Thema "Familie" im offenen Sachunterricht der Klasse X
- 5.3 Relevanz der Muttersprache für den Unterricht
- 5.3.1 Mögliche muttersprachliche Lernhilfen
- 5.3.2 Einsatz muttersprachlicher Lernhilfen im Offenen Unterricht der Klasse X
- 5.4 Förderung der Bedeutungsentwicklung im Offenen Unterricht
- 5.5 Sprachliche Handlungsfähigkeit
- 5.6 Kulturelle Aspekte im Unterricht - Nutzung der Mehrkulturalität
- 5.6.1 Wir feiern das Opferfest (Kurban Bayrami)
- 5.1 Vorstellung der Klasse
- 6. Fazit, Beantwortung der Fragestellung und Ausblick der vorgelegten Arbeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht den Einsatz des offenen Unterrichts in Klassen mit mehrsprachigen Kindern. Ziel ist es, die Methode des offenen Unterrichts hinsichtlich ihrer Eignung für die Förderung von Sprachentwicklung und Lernerfolg in dieser besonderen Lerngruppe zu analysieren.
- Mehrsprachigkeit und Spracherwerb
- Konzepte des offenen Unterrichts
- Integration von Mehrsprachigkeit in den Unterricht
- Förderung der Sprachentwicklung im offenen Unterricht
- Kulturelle Vielfalt im Klassenzimmer
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer detaillierten Auseinandersetzung mit dem Phänomen der Mehrsprachigkeit, einschließlich verschiedener Modelle des Spracherwerbs. Im zweiten Kapitel wird der offene Unterricht als pädagogisches Konzept vorgestellt, wobei die Bausteine der Methode, ihre Ziele und die Aufgaben der Lehrkraft im Fokus stehen. Anschließend werden die schulpolitischen Rahmenbedingungen für die Beschulung mehrsprachiger Kinder beleuchtet. Das vierte Kapitel behandelt die konkrete Anwendung des offenen Unterrichts in Klassen mit mehrsprachigen SchülerInnen, wobei die einzelnen Bausteine der Methode im Detail betrachtet werden. Schließlich präsentiert die Arbeit ein fiktives Beispiel für die Umsetzung des offenen Unterrichts in einer Grundschulklasse mit mehrsprachigen Kindern und diskutiert die Bedeutung der Muttersprache für den Unterricht.
Schlüsselwörter
Mehrsprachigkeit, Offener Unterricht, Sprachentwicklung, Lernerfolg, Interkulturelles Lernen, Mehrkulturalität, Inklusion, Muttersprache, Pädagogik, Grundschule, Sonderschule, Sprachbehindertenpädagogik.
- Arbeit zitieren
- Stefanie Lembcke-Kartal (Autor:in), 2000, Offener Unterricht als Methode in Klassen mit mehrsprachigen Kindern, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/5741