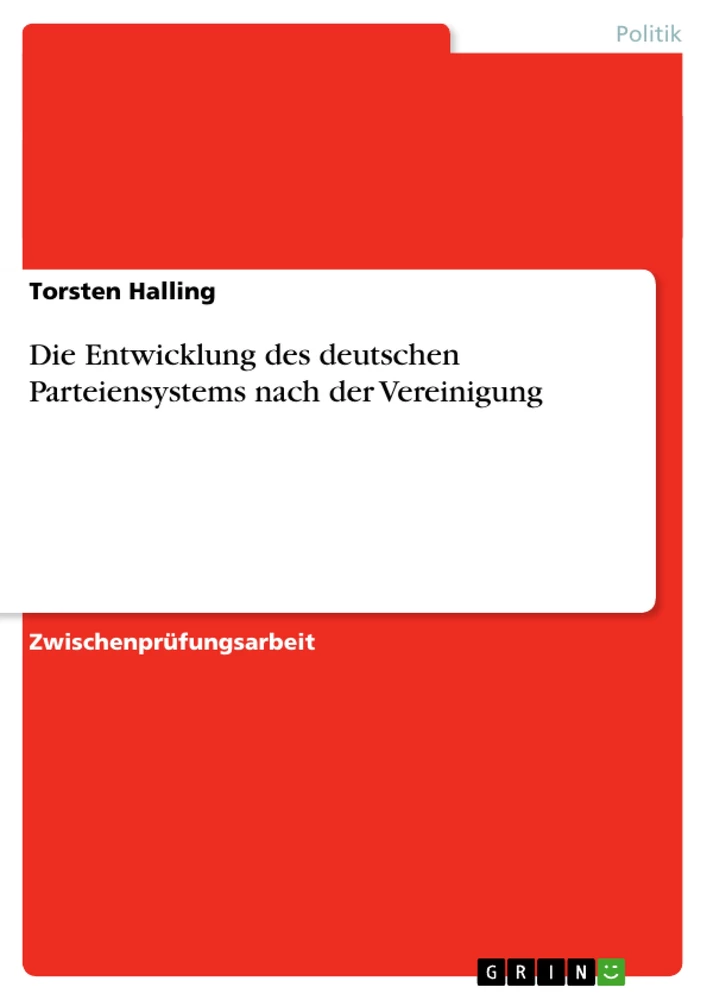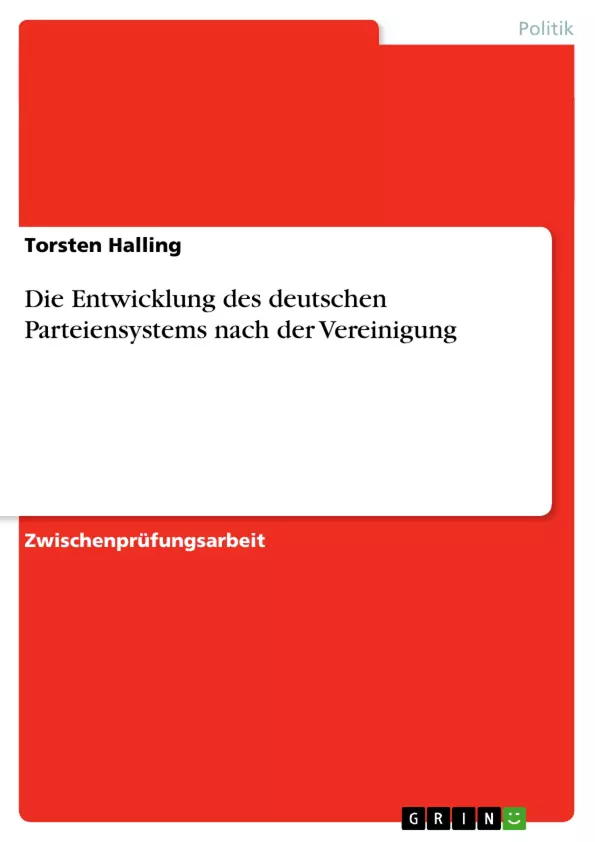Die Arbeit geht von der Fragestellung aus, ob die nach der Vereinigung im deutschen Parteiensystem zu beobachtende Dynamisierung als grundsätzliche Bedrohung für dessen Stabilität anzusehen ist. Bei der Analyse wird zwischen drei Parteientypen unterschieden, die jeweils von spezifischen gesellschaftlichen Entwicklungen betroffen sind: die von der Erosion der klassischen sozialen Milieus, der zunehmenden Parteienverdrossenheit in der Bevölkerung und den allgemeinen Entideologisierungstendenzen betroffenen Volksparteien CDU/CSU und SPD; die zwischen Anpassung und Selbstbehauptung pendelnden, weitgehend auf die alten Bundesländer beschränkten etablierten Kleinparteien FDP und Bündnis 90/ Die Grünen sowie die neu entstandenen Parteien am linken und rechten Rand des politischen Spektrums, von denen sich bisher jedoch nur die PDS als ostdeutsche Regionalpartei einen festen Platz im Parteiensystem sichern konnte. Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass es durchaus zu einigen destabilisierenden Tendenzen gekommen ist wie etwa der Fragmentierung der Parteienlandschaft auf Bundesebene, der teilweise verstärkten Polarisierung und Segmentierung durch die Erfolge der PDS in Ostdeutschland oder der erhöhten Volatilität des Parteiensystems auf Länderebene. Gleichzeitig sind jedoch auch stabilisierende Entwicklungen zu beobachten wie die ungebrochene Dominanz der Volksparteien, die programmatische Annäherung der etablierten Parteien oder die Konzentrationsprozesse in Ostdeutschland. Es lässt sich somit feststellen, dass das gegenwärtige deutsche Parteiensystem bei aller Dynamik von einer grundlegenden Destabilisierung weit entfernt ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Entwicklungsprozesse nach 1990
- Die Entwicklung der Volksparteien
- Die Volksparteien als Opfer des sozialen Wandels?
- Der Kampf um die politische Mitte
- Die Entwicklung der etablierten Kleinparteien
- Programmparteien oder Funktionsparteien?
- Unverhoffte Marginalisierung in den neuen Bundesländern
- Die Entwicklung der Parteien an den Rändern des politischen Spektrums
- Die PDS als neuer ostdeutscher Machtfaktor
- Die rechten Parteien zwischen Aufbruchsstimmung und Selbstzerfleischung
- Die Entwicklung der Volksparteien
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht, ob die Entwicklung des deutschen Parteiensystems nach der Wiedervereinigung tatsächlich Tendenzen zu einer verstärkten Instabilität zeigt. Der Fokus liegt dabei auf den Prozessen der Fragmentierung, Polarisierung und Segmentierung innerhalb des Systems und deren potenzieller Gefahr für die politische Stabilität.
- Die Auswirkungen des sozialen Wandels auf die Volksparteien (SPD, CDU/CSU)
- Die Herausforderungen für etablierte Kleinparteien (FDP, Bündnis 90/Die Grünen) in der neuen gesamtdeutschen Landschaft
- Der Aufstieg neuer politischer Akteure an den Rändern des Spektrums (PDS, rechte Parteien)
- Die Interaktionsverhältnisse zwischen den Parteien im Kontext langfristiger Entwicklungen des Systems
- Die Frage, ob die beobachteten Prozesse eine Bedrohung für die Stabilität des politischen Systems darstellen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Ausgangssituation dar und erläutert die zentrale Fragestellung der Arbeit. Sie beleuchtet die Dynamik des gesamtdeutschen Parteiensystems im Vergleich zum westdeutschen System der 60er und 70er Jahre und die wachsende Bedeutung neuer Parteien. Die Arbeit geht der Frage nach, ob diese Entwicklungen zu einer Instabilität des Systems führen könnten.
Kapitel 2.1 analysiert die Herausforderungen für die Volksparteien SPD und CDU/CSU, die durch den sozialen Wandel und die Auflösung traditioneller sozialer Milieus beeinflusst werden. Hier werden auch die Versuche der Parteien, sich in den veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zu behaupten, betrachtet.
Kapitel 2.2 befasst sich mit den etablierten Kleinparteien FDP und Bündnis 90/Die Grünen, die in den 1990er Jahren als eher kurzlebig galten.
Kapitel 2.3 untersucht die Entwicklung neuer politischer Akteure im linken und rechten Spektrum des Parteiensystems, insbesondere die Rolle der PDS als neuer Machtfaktor im Osten und die Herausforderungen für rechte Parteien.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Entwicklung des deutschen Parteiensystems nach der Wiedervereinigung, insbesondere auf die Prozesse der Fragmentierung, Polarisierung und Segmentierung, die das System beeinflussen. Sie analysiert die Rolle der Volksparteien (SPD, CDU/CSU), etablierter Kleinparteien (FDP, Bündnis 90/Die Grünen), und neuer Akteure an den Rändern des Spektrums (PDS, rechte Parteien). Darüber hinaus werden die Auswirkungen des sozialen Wandels, der Wertewandel und die Entwicklung der politischen Kultur untersucht, um die Stabilität des Systems zu beurteilen.
- Quote paper
- Torsten Halling (Author), 2002, Die Entwicklung des deutschen Parteiensystems nach der Vereinigung, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/57121