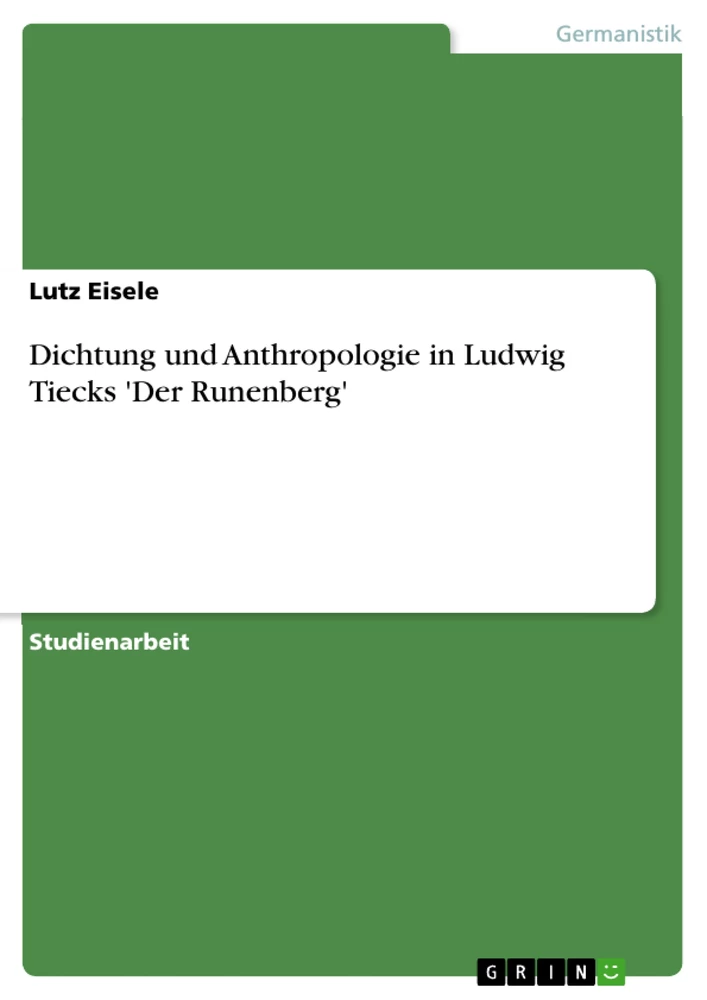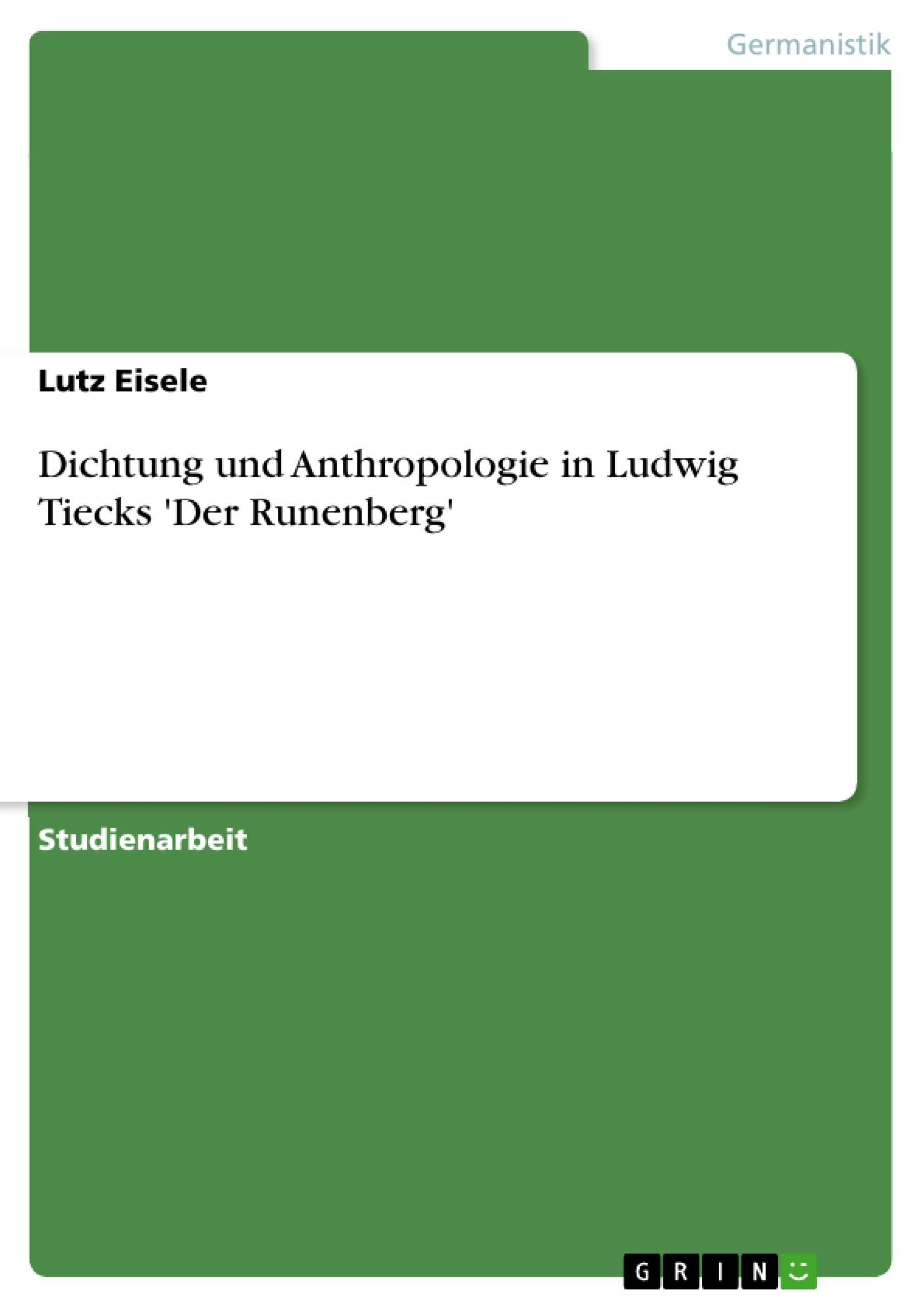Die Anthropologie Lessings ist durch die göttliche Vorsehung fundiert: Sie garantiert, daß der Mensch für das Gute offen ist, daß es günstige Zufälle und Gelegenheiten gibt, in denen er sich incooperatiomit dem Göttlichen bewähren kann, daß das Unbewußte nicht zur großen Unbekannten wird, die alle menschlichen Bemühungen untergräbt, sondern der freie Wille sein trotziges ‘kein Mensch muß müssen’ sprechen kann. Sie stattet den Menschen mit Sprache aus, mit der er in der Lage ist, sich selbst und die Welt zu ergründen, sich und andere zu bilden. Alles ist getragen von dem Glauben an die Realpräsenz des Göttlichen in der Welt und im Menschen: Introite, nam et hic dii sunt.
Bei Ludwig Tieck scheint der Fall anders zu liegen, seine Figuren machen eher einen getriebenen Eindruck; sie sind sich selbst und anderen ein unerklärliches Rätsel. Offensichtlich hat zwischen beiden Werken ein Wandel stattgefunden; die Anthropologie muß eine grundlegende Veränderung erfahren haben. Dem soll nun nachgegangen werden; im Zentrum des Interesses steht also die Anthropologie. Die Grundlagen einer nach Maßgabe des Kunstmärchens glücklichen Existenz sollen erfragt werden. Ganz besonders im Mittelpunkt steht die Überlegung, in welcher Weise sich die religiöse Grundlage verändert hat und welche Folgen sich daraus für alles andere ergeben.
Um dieser Problematik näher zu kommen, soll zunächst der Weg nachgezeichnet werden, den Christian im Runenberg geht.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Aufhebung der Individualität ins Absolute bei Christian
- 1. Christian allein im Gebirge: Gespannt auf etwas Unbekanntes
- 1.1. Die Kluft zwischen Ich und Welt als hermeneutisches Problem und als Aufgabe der Phantasie
- 1.2. Subjekt-Objekt-Spaltung oder Persönlichkeitsproblem?
- 1.3. Zusammenfassung und Weiterführung: Die Wurzel als Symbol des Todes
- 2. Christians Erlebnis auf dem Runenberg
- 3. Christians Aufenthalt im Dorf und seine Rückkehr in die Welt des Gebirges
- 4. Die Rückkehr in die Dorfwelt
- 5. Christians Entwicklung - Zusammenfassung
- 1. Christian allein im Gebirge: Gespannt auf etwas Unbekanntes
- III. Christian als romantischer Künstler - mit besonderer Rücksicht auf Novalis
- IV. Der Vater als Gegenentwurf: Dichtung in Demut
- V. Die Verunsicherung des Lesers als Grundlage für seine Romantisierung
- VI. Zusammenfassung und Ausblick - Dichtung und Anthropologie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Anthropologie in Ludwig Tiecks "Der Runenberg" und verfolgt die Entwicklung der Hauptfigur Christian. Ziel ist es, die religiösen und philosophischen Grundlagen der glücklichen Existenz im Kontext des Kunstmärchens zu ergründen und die Veränderungen der religiösen Basis und deren Folgen zu analysieren. Die Arbeit beleuchtet Christians Weg, seine innere Zerrissenheit und sein Verhältnis zur Natur und zur Gesellschaft.
- Entwicklung der Hauptfigur Christian
- Christians Verhältnis zur Natur und zur Welt
- Die Rolle der Phantasie und Sprache
- Der Gegensatz zwischen Christian und seinem Vater
- Die Bedeutung von Symbolen im Text
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung vergleicht die Anthropologie Lessings mit der in Tiecks "Der Runenberg", die sich durch eine grundlegende Veränderung auszeichnet. Sie stellt die zentrale Forschungsfrage nach den Grundlagen einer glücklichen Existenz im Kunstmärchen und der Veränderung der religiösen Grundlage und deren Konsequenzen. Der Fokus liegt auf der Nachzeichnung von Christians Weg im "Runenberg".
II. Aufhebung der Individualität ins Absolute bei Christian: Dieses Kapitel analysiert Christians Entwicklung auf verschiedenen Ebenen. Es untersucht seine anfängliche Unzufriedenheit und seine Suche nach einer Heimat, die im Verlassen der vertrauten Umgebung und dem Versuch, sich in verschiedenen Berufen zu etablieren, ihren Ausdruck findet. Christians innere Leere und die Unfähigkeit, mit der Natur und der Gesellschaft in Einklang zu kommen, werden als zentrales Problem hervorgehoben. Die Analyse umfasst die Kluft zwischen Ich und Welt, das hermeneutische Problem des Verstehens und die Rolle der Phantasie in Christians Bemühungen, diese Kluft zu überwinden.
III. Christian als romantischer Künstler - mit besonderer Rücksicht auf Novalis: Dieses Kapitel betrachtet Christian im Kontext des romantischen Künstlers, insbesondere im Vergleich zu Novalis' Heinrich von Ofterdingen. Es untersucht Christians Berufung zum Dichter, seine poetische Verwandlung der Welt und die Schwierigkeiten der Rezeption seines künstlerischen Schaffens. Der Fokus liegt auf der Rolle der Kunst und der Poesie im Umgang mit der inneren Zerrissenheit und der Suche nach Sinn. Ein Vergleich mit Novalis' Werk ermöglicht eine vertiefte Analyse der romantischen Kunstauffassung.
IV. Der Vater als Gegenentwurf: Dichtung in Demut: Dieses Kapitel setzt Christian seinem Vater gegenüber, um deren unterschiedliche Ansätze zur Bewältigung existenzieller Fragen, insbesondere der Todesfrage, zu beleuchten. Es analysiert die differierenden Auffassungen von Persönlichkeit und Künstlertum, die die Vater-Sohn-Beziehung prägen. Der Vater repräsentiert einen Gegenentwurf zu Christians künstlerischem Streben. Die Analyse zeigt, wie die unterschiedlichen Positionen zur Todesfrage die Beziehung zwischen Vater und Sohn beeinflussen und das Verständnis von Dichtung und Leben prägen.
V. Die Verunsicherung des Lesers als Grundlage für seine Romantisierung: Dieses Kapitel befasst sich mit der Rolle der erzählerischen Gestaltung und der offenen Schlussstruktur des Textes. Es analysiert die textimmanenten Aspekte wie Erzählhaltung, Charakterisierung und Motivwahl, um die Verunsicherung des Lesers zu erklären. Der offene Schluss wird als integraler Bestandteil der Romantisierung interpretiert und die Analyse verdeutlicht, wie die Unsicherheit den Lesern Raum für eigene Interpretationen und Identifikation mit den Figuren bietet. Mögliche Interpretationsansätze werden erörtert.
Schlüsselwörter
Ludwig Tieck, Der Runenberg, Romantik, Anthropologie, Christian, Identität, Phantasie, Sprache, Natur, Vater-Sohn-Beziehung, Künstler, Poesie, Hermeneutik, Symbol, Absolutes, Individualität, Verunsicherung.
Häufig gestellte Fragen zu Ludwig Tiecks "Der Runenberg"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Anthropologie in Ludwig Tiecks "Der Runenberg" und verfolgt die Entwicklung der Hauptfigur Christian. Sie untersucht die religiösen und philosophischen Grundlagen einer glücklichen Existenz im Kontext des Kunstmärchens und analysiert Veränderungen der religiösen Basis und deren Folgen. Ein Schwerpunkt liegt auf Christians Weg, seiner inneren Zerrissenheit und seinem Verhältnis zur Natur und Gesellschaft.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Christians Entwicklung, sein Verhältnis zur Natur und Welt, die Rolle von Phantasie und Sprache, den Gegensatz zwischen Christian und seinem Vater, die Bedeutung von Symbolen im Text, sowie die Verunsicherung des Lesers und deren Beitrag zur Romantisierung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Kapitel I (Einleitung) vergleicht die Anthropologie Lessings mit der in Tiecks Werk und stellt die Forschungsfrage. Kapitel II analysiert Christians Entwicklung und seine Suche nach einer Heimat. Kapitel III betrachtet Christian als romantischen Künstler im Vergleich zu Novalis. Kapitel IV setzt Christian seinem Vater gegenüber, um deren unterschiedliche Ansätze zur Bewältigung existenzieller Fragen zu beleuchten. Kapitel V befasst sich mit der Rolle der erzählerischen Gestaltung und der offenen Schlussstruktur. Kapitel VI bietet eine Zusammenfassung und einen Ausblick.
Wie wird Christians Entwicklung dargestellt?
Christians Entwicklung wird auf verschiedenen Ebenen analysiert, beginnend mit seiner anfänglichen Unzufriedenheit und seiner Suche nach einer Heimat, über seine innere Leere und die Unfähigkeit, mit der Natur und Gesellschaft in Einklang zu kommen, bis hin zu seiner möglichen Entwicklung zum romantischen Künstler. Seine Beziehung zu seinem Vater und dessen Gegenentwurf zu Christians Lebensweg werden ebenfalls detailliert untersucht.
Welche Rolle spielen Phantasie und Sprache in der Erzählung?
Phantasie und Sprache spielen eine zentrale Rolle in Christians Bemühungen, die Kluft zwischen Ich und Welt zu überwinden. Die Arbeit analysiert, wie er durch Phantasie und künstlerisches Schaffen versucht, seine innere Zerrissenheit zu bewältigen und Sinn zu finden. Die poetische Verwandlung der Welt durch Christian wird im Kontext der romantischen Kunstauffassung untersucht.
Welche Bedeutung haben Symbole im Text?
Die Arbeit untersucht die Bedeutung verschiedener Symbole im Text, um Christians innere Entwicklung und die zugrundeliegenden philosophischen und religiösen Konzepte zu verstehen. Ein Beispiel hierfür ist die "Wurzel als Symbol des Todes".
Wie wird die Verunsicherung des Lesers als Teil der Romantisierung interpretiert?
Die offene Schlussstruktur und die Erzähltechnik des Textes tragen maßgeblich zur Verunsicherung des Lesers bei. Diese Verunsicherung wird als integraler Bestandteil der Romantisierung interpretiert, da sie dem Leser Raum für eigene Interpretationen und Identifikation mit den Figuren bietet.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Ludwig Tieck, Der Runenberg, Romantik, Anthropologie, Christian, Identität, Phantasie, Sprache, Natur, Vater-Sohn-Beziehung, Künstler, Poesie, Hermeneutik, Symbol, Absolutes, Individualität, Verunsicherung.
- Arbeit zitieren
- Lutz Eisele (Autor:in), 1998, Dichtung und Anthropologie in Ludwig Tiecks 'Der Runenberg', München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/55809