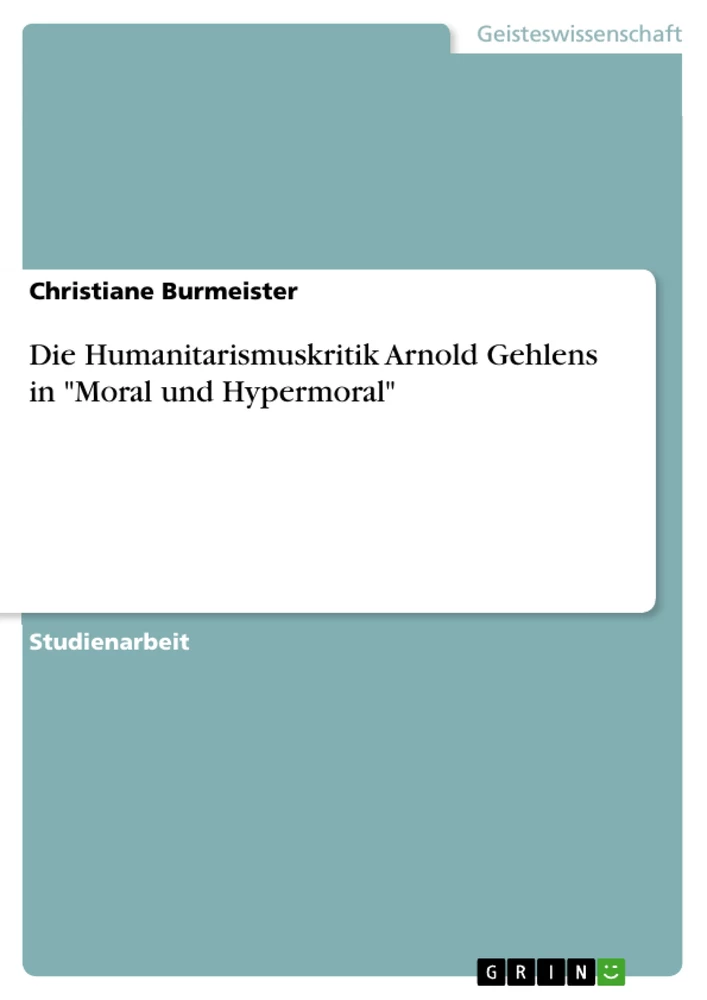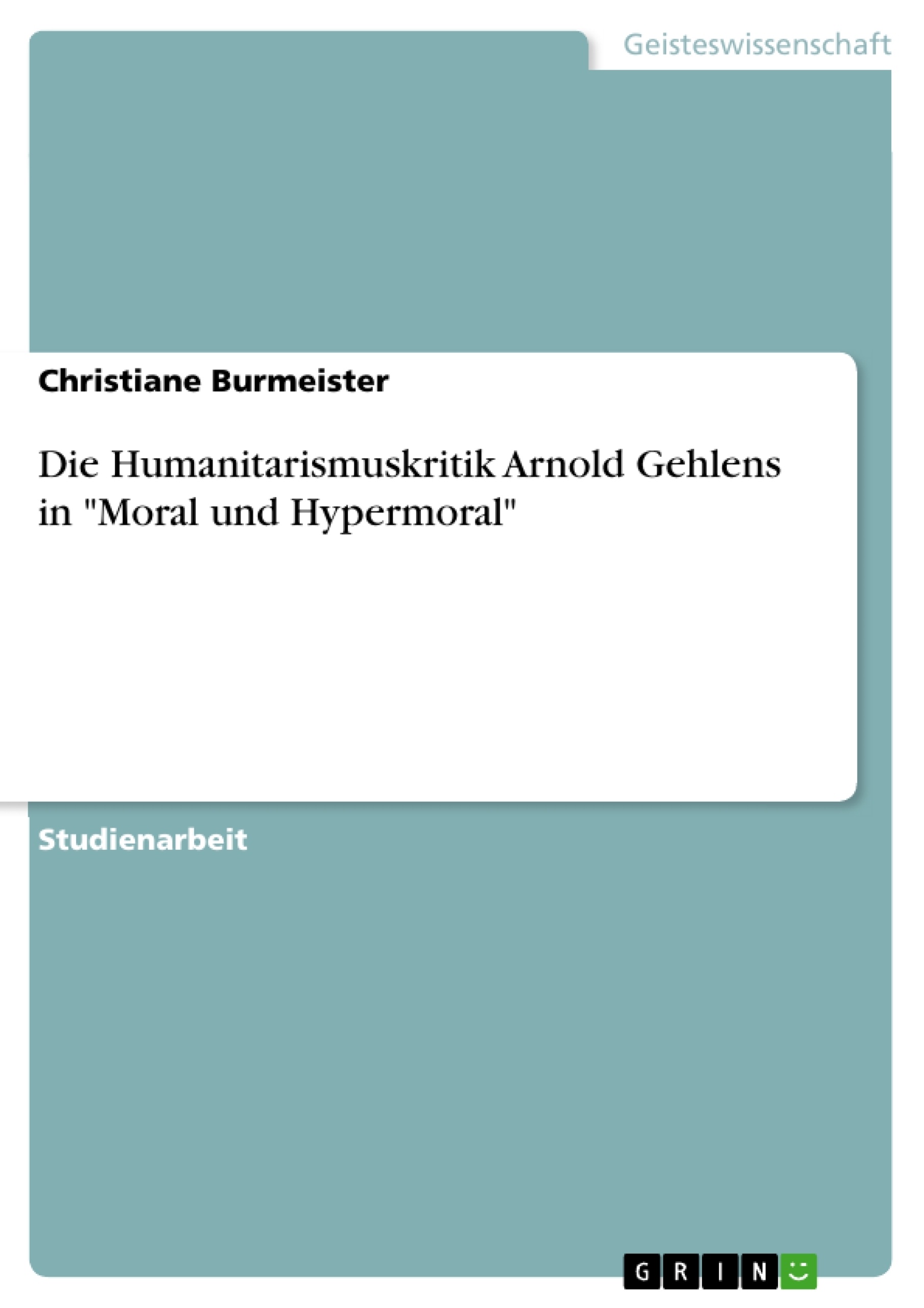1. Einleitung
Wie kaum ein anderer Philosoph hat Arnold Gehlen die deutsche Nachkriegskontroverse vom Standpunkt des Institutionalismus geprägt und es gebührt ihm der Verdienst einer detaillierten, sozio- anthropologisch fundierten Kritik der Zeitgesinnung. Er ist jedoch ebenfalls für die Humanitarismusdebatte des 20. Jahrhunderts, innerhalb derer er der Ausbreitung einer globalen, menschenfreundlichen Massenmoral zutiefst kritisch gegenüberstand, von Bedeutung. In seinen Augen steht der Humanitarismus in einem destruktiven Verhältnis zu Institutionen, allen voran dem Staat. Da es sich gemäß Gehlen bei diesen Institutionen für den instinktreduzierten, mängelbehafteten und effektgeladenen Menschen um lebensnotwendige Regelmuster handelte, hätte eine umgreifende „Moralhypertrophie“ fatale Auswirkungen. Sie ließe politische Tugenden verkümmern, sprenge die Grenzen der nationalen Identifikation, und zerstöre den Staat sowohl als ideologisches als auch institutionelles Konstrukt. Ohne aber das ausführliche ethische Programm, das hinter dieser umstrittenen und vieldiskutierten Ansicht steht zu kennen, wird man dem Philosophen Arnold Gehlen nicht gerecht.
Die Monographie „Moral und Hypermoral. Eine pluralistische Ethik“ muss als wesentliche Ergänzung zu seinem Hauptwerk „Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt“ verstanden werden. Es soll im Folgenden untersucht werden, wie die Humanitarismuskritik in diesem Buch darzustellen und kritisch zu durchleuchten ist. Zudem wird der Versuch unternommen, die Argumentationsstruktur des Autors zu verdeutlichen und die verschiedenen Ebenen seiner Beweisführung aufzuzeigen. Dafür muss ebenso die Gehlensche Genealogie einer pluralistischen Ethik und deren Aufteilung in verschiedene Verhaltensregulationen skizziert werden, denn dies muss als seine gedankliche Voraussetzung für die Kritik am humanitaristischen Ethos verstanden werden.
Am Schluss steht eine kritische Zusammenfassung, welche die Kernelemente der Gehlenschen Humanitarismuskritik herausstellen und von einem ethischen als auch politikphilosophischen Standpunkt auf ihre Schlüssigkeit und ihren Gehalt überprüfen soll. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. „Die Humanitarismuskritik Gehlens in Moral und Hypermoral“
- 2.1 Humanitarismus als Verfall
- 2.2 Humanitarismus als überdehntes Familienethos
- 2.3 Humanitarismus als Gefahr für Institutionen und Politik
- 3. Die Diagnose der Moralhypertrophie
- 4. Kritischer Rückblick
- 5. Die ideengeschichtliche Position Arnold Gehlens
- 6. Schlussgedanken
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Arnold Gehlens Kritik am Humanitarismus in seinem Werk „Moral und Hypermoral“. Ziel ist es, Gehlens Argumentationsstruktur zu analysieren und seine Position im ideengeschichtlichen Kontext zu verorten. Dabei wird geprüft, ob Gehlens Kritik ausreichend begründet ist und welche Form des Humanitarismus er kritisiert.
- Gehlens Kritik am Humanitarismus als Ursache für den Staatsverfall
- Die anthropologische Grundlage von Gehlens Argumentation
- Die Gefahr des Humanitarismus für Institutionen und Politik nach Gehlen
- Gehlens Konzept der Moralhypertrophie
- Die ideengeschichtliche Einordnung von Gehlens Position
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Schlüssigkeit und dem Gehalt von Gehlens Humanitarismuskritik dar. Sie skizziert den Kontext von Gehlens Werk innerhalb der Nachkriegsdebatte und hebt die Bedeutung seines sozio-anthropologischen Ansatzes hervor. Die Einleitung verdeutlicht den Zusammenhang zwischen Gehlens Hauptwerk „Der Mensch“ und „Moral und Hypermoral“ und kündigt die methodische Vorgehensweise der Arbeit an, die eine Analyse der Argumentationsstruktur und eine ideengeschichtliche Einordnung von Gehlens Position beinhaltet.
2. „Die Humanitarismuskritik Gehlens in Moral und Hypermoral“: Dieses Kapitel analysiert die Kernbegriffe von Gehlens Kritik: Humanitarismus, Masseneudaimonismus und Moralhypertrophie. Es erläutert Gehlens Verständnis dieser Begriffe und zeigt die drei Hauptargumente seiner Kritik auf: ein historisches Argument (Staatsverfall), ein anthropologisches Argument (Unterdrückung anderer Ethosformen) und ein politisches Argument (Gefährdung von Staat und Nation). Der Fokus liegt auf der Verknüpfung dieser drei Argumentationslinien und ihrer Bedeutung für Gehlens Gesamtargumentation.
Schlüsselwörter
Arnold Gehlen, Humanitarismuskritik, Moral und Hypermoral, Masseneudaimonismus, Moralhypertrophie, Institutionen, Politik, Staatsverfall, Anthropologie, Ideengeschichte, Pluralistische Ethik.
Häufig gestellte Fragen zu: Arnold Gehlens Humanitarismuskritik in "Moral und Hypermoral"
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Arnold Gehlens Kritik am Humanitarismus, wie sie in seinem Werk "Moral und Hypermoral" dargelegt wird. Sie untersucht seine Argumentationsstruktur, ordnet seine Position im ideengeschichtlichen Kontext ein und prüft die Schlüssigkeit seiner Kritik. Die Arbeit umfasst eine Einleitung, eine detaillierte Analyse von Gehlens Kritik, einen kritischen Rückblick, eine Einordnung in die Ideengeschichte und abschließende Gedanken.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf Gehlens Kritik am Humanitarismus als Ursache für Staatsverfall, die anthropologischen Grundlagen seiner Argumentation, die Gefahren des Humanitarismus für Institutionen und Politik nach Gehlen, sein Konzept der Moralhypertrophie und die ideengeschichtliche Einordnung seiner Position. Die drei Hauptargumente Gehlens – historisch, anthropologisch und politisch – werden eingehend untersucht.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in sechs Kapitel gegliedert: Einleitung, Analyse von Gehlens Humanitarismuskritik in "Moral und Hypermoral" (mit Unterkapiteln zu Humanitarismus als Verfall, überdehntes Familienethos und Gefahr für Institutionen), Diagnose der Moralhypertrophie, kritischer Rückblick, ideengeschichtliche Positionierung Gehlens und Schlussgedanken. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel detailliert beschrieben.
Welche zentralen Begriffe werden in der Arbeit erläutert?
Zentrale Begriffe sind: Humanitarismus, Masseneudaimonismus, Moralhypertrophie, Institutionen, Politik, Staatsverfall, Anthropologie und Pluralistische Ethik. Die Arbeit erläutert Gehlens Verständnis dieser Begriffe und ihre Bedeutung für seine Kritik am Humanitarismus.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist die Analyse von Gehlens Argumentationsstruktur in Bezug auf seine Humanitarismuskritik und die Einordnung seiner Position im ideengeschichtlichen Kontext. Es wird geprüft, ob seine Kritik ausreichend begründet ist und welche Form des Humanitarismus er kritisiert.
Welche methodische Vorgehensweise wird angewendet?
Die Arbeit analysiert die Argumentationsstruktur von Gehlens Kritik und ordnet seine Position ideengeschichtlich ein. Sie untersucht den Zusammenhang zwischen Gehlens Hauptwerk "Der Mensch" und "Moral und Hypermoral".
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Arnold Gehlen, Humanitarismuskritik, Moral und Hypermoral, Masseneudaimonismus, Moralhypertrophie, Institutionen, Politik, Staatsverfall, Anthropologie, Ideengeschichte, Pluralistische Ethik.
- Arbeit zitieren
- Christiane Burmeister (Autor:in), 2005, Die Humanitarismuskritik Arnold Gehlens in "Moral und Hypermoral", München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/55601