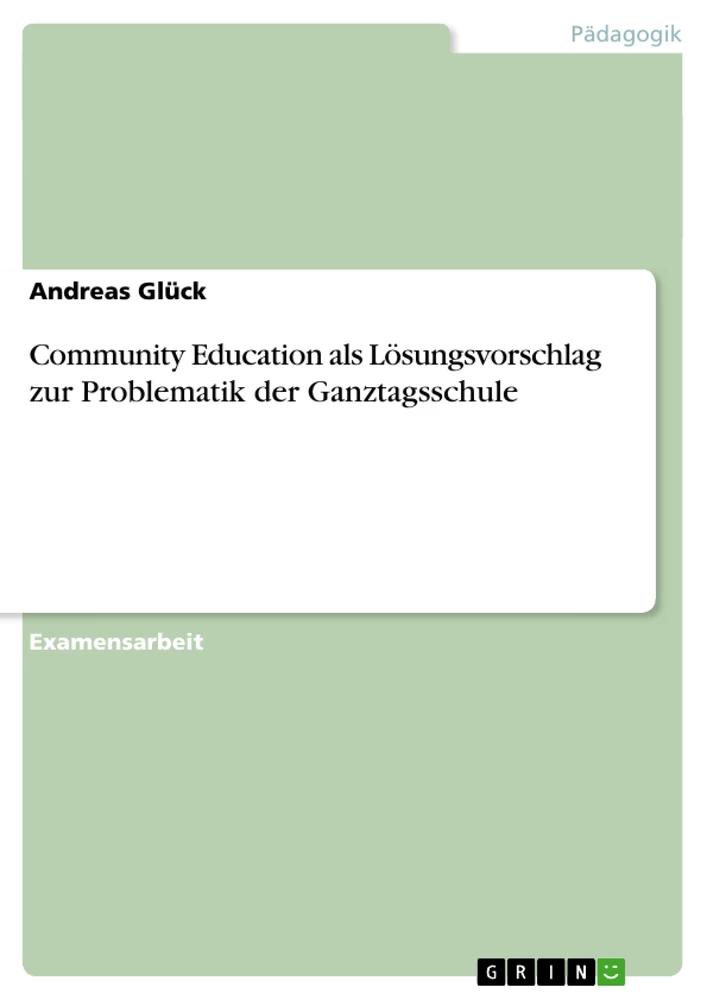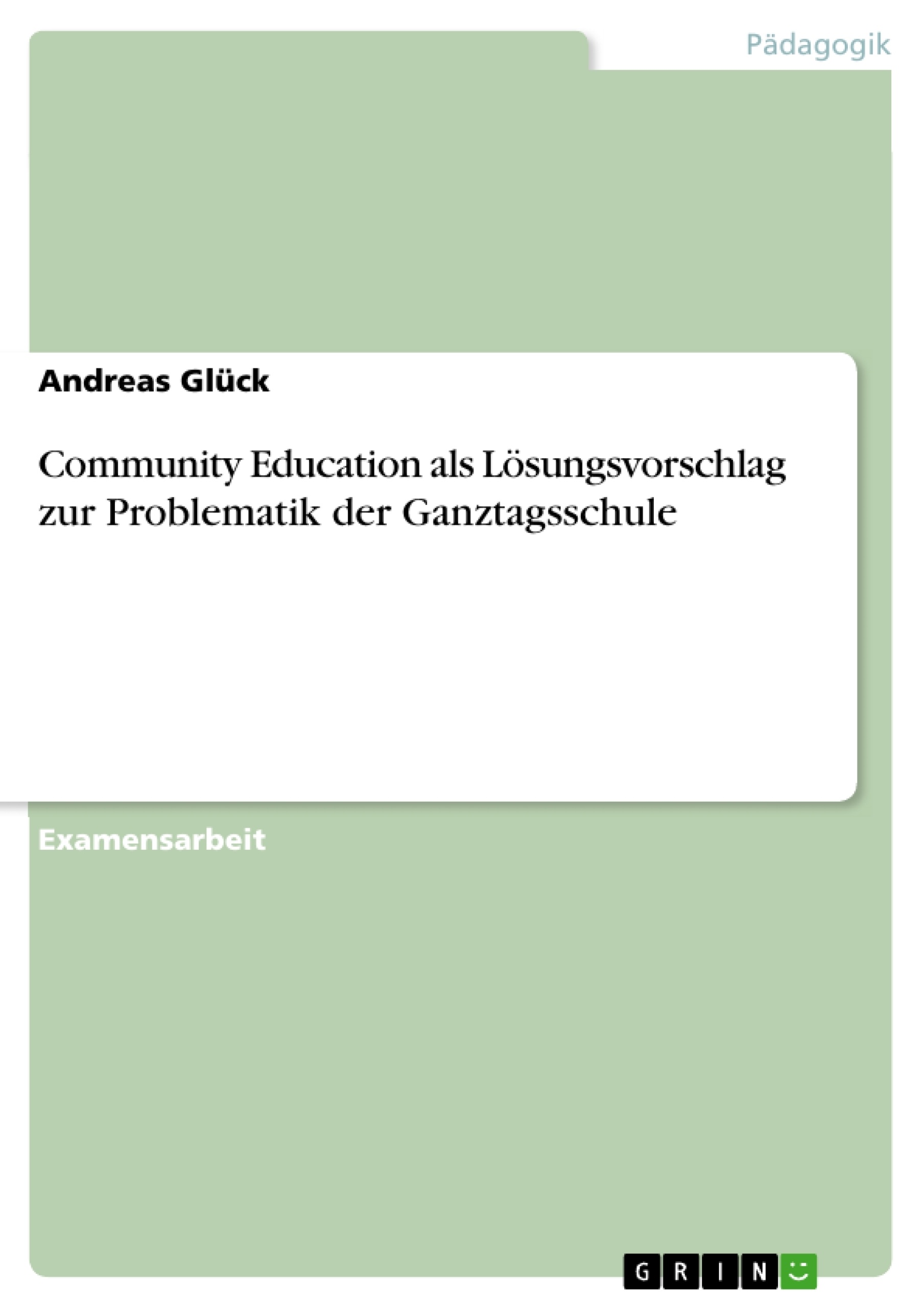Dieser Arbeit liegt der Gedanke zu Grunde, dass die dreigeteilte Vormittagsschule, die isoliert im Viertel liegt, die an sie gestellten Aufgaben nicht erbringen kann.
Als Ansatz der Korrektur wird das angelsächsische Modell der „Community Education“, welches transformiert im deutschsprachigen Raum als „Offene Schule“ oder „Öffnung der Schule“ bekannt ist aufgegriffen.
Der in diesem Werk praktizierte Ansatz soll die bekannten Elemente der Ganztagsschule mit den Möglichkeiten der „Community“ vereinen und damit zu einer Schule führen, die ihren Schülern eine Ganztagsbetreuung anbietet, die aber nicht in Form von Beschäftigungsangeboten realisiert wird, sondern vielmehr ein spielerisches Lernen verbunden mit der umliegenden Gemeinde bewerkstelligt. Im Ergebnis der Bemühungen wird die Schule im Viertel verwurzelt, die Bewohner fühlen sich ihren Schülern nicht nur verbunden, sondern liefern je nach Qualifizierung auch selbst Bildungsinhalte. Im Gegenzug öffnet sich die Schule und das Schulgebäude nach außen. Im theoretischen Ideal wird die Schule der Ort im Viertel, in dem Bildungs- und Freizeitangebote für alle Nachbarn bereitgestellt werden, dies selbstverständlich auch nach dem regulären Schulende, am Abend und am Wochenende.
Sinn aller Aktivitäten innerhalb dieses entwickelten Ansatzes ist die lebensnahe Bildung, verbunden mit Kompetenzen wie „life-ling-learning“. Erreicht werden soll vor allem aber, dass die Absolventen der unterschiedlichen Schulen in der Lage sind, den neuen Anforderungen (in Ausbildung oder Studium) zu entsprechen bzw. über Fähigkeiten verfügen sich bestimmte Inhalte selbständig und selbstgesteuert anzueignen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Community Education
- Vorbetrachtung
- Historische Wurzeln
- Großbritannien
- Vereinigte Staaten von Amerika
- Zusammenfassung Community Education
- Definitions- und Klassifikationsversuche der Community Education
- Der konzeptorientierte Ansatz von Ashcroft 1975
- Der praxisorientierte Ansatz nach Clark 1985
- Differenzierung nach Handlung
- Historisch - analytischer Ansatz
- Differenzierung durch Modellbildung nach Buhren
- Demokratisches Modell
- Life-long-learning - Modell
- Das kompensatorisch - reformorientierte Modell
- Das gesellschaftsverändernde Modell
- Aktive und passive Community Education nach Baecker
- Zusammenfassung Definitions- und Klassifikationsversuche
- Konzeptuelle Merkmale
- Community Development
- Lifelong Learning
- Multicultural Approach
- Community Education in Deutschland
- Das Konzept wird populär
- Handlungsfelder der Community Education in Deutschland
- Handlungsfeld Jugend – und Kulturarbeit
- Handlungsfeld Gemeinwesen
- Handlungsfeld Schule
- Überblick
- Öffnung der Schule
- Umsetzung des Konzepts an alternative Schulen
- Voraussetzung der Öffnung
- Öffnung des Unterrichts
- Praxis der Öffnung
- Rahmenkonzept Gestaltung des Schullebens und Öffnung von Unterricht
- Handlungsfelder GÖS
- Zusammenfassung „Öffnung der Schule und Öffnung des Unterrichts“
- Die Ganztagsschule
- Allgemeines
- Aufgaben der Ganztagsschule nach dem Deutschem Bildungsrat (1968)
- Organisationsformen und -merkmale der Ganztagsschule
- Kritik am Konzept der Ganztagsschule
- Zusammenfassung
- „Die geöffnete Ganztagsschule“
- Gemeinsamkeiten
- Differenzen
- Konsens
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Community Education als Lösungsansatz für die Herausforderungen der Ganztagsschule. Sie analysiert das Konzept der Community Education, seine historischen Wurzeln und verschiedenen Ausprägungen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Implementierung von Community Education in Deutschland, insbesondere im schulischen Kontext.
- Konzept und Geschichte von Community Education
- Definitions- und Klassifikationsversuche von Community Education
- Community Education in Deutschland und seine Handlungsfelder
- Die Ganztagsschule und ihre Herausforderungen
- Die "geöffnete Ganztagsschule" als Synthese
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Problematik des deutschen Schulsystems, welches in Bezug auf Wissensvermittlung und Kompetenzentwicklung als mangelhaft eingeschätzt wird. Es werden Defizite in den Bereichen Mathematik, Deutsch und den sogenannten "Soft Skills" aufgezeigt. Der Fokus liegt auf der Notwendigkeit innovativer Lösungsansätze für diese Herausforderungen. Der Mangel an Kompetenzvermittlung wird mit Beispielen aus dem Alltag illustriert, wie z.B. der Beliebtheit eines Fastfood-Konzern-Infobusses bei Schülern und Lehrern.
Community Education: Dieses Kapitel beleuchtet das Konzept der Community Education, beginnend mit einer Vorbetrachtung und den historischen Wurzeln in Großbritannien und den Vereinigten Staaten. Es werden Schlüsselpersonen wie Henry Morris, der Plowden-Report, Eric Midwinter, John Dewey, Frank Manley und Charles Stuart Mott vorgestellt und deren Beiträge zur Entwicklung des Konzepts erläutert. Die Kapitel geben einen Überblick über die Entwicklung und die verschiedenen Aspekte von Community Education.
Definitions- und Klassifikationsversuche der Community Education: Dieses Kapitel analysiert verschiedene Ansätze zur Definition und Klassifizierung von Community Education. Es werden unterschiedliche Perspektiven und Modelle, wie der konzeptorientierte Ansatz von Ashcroft, der praxisorientierte Ansatz von Clark, sowie differenzierende Ansätze nach Handlung, historisch-analytisch und nach Buhren (demokratisches, Life-long-learning, kompensatorisch-reformorientiertes, gesellschaftsveränderndes Modell) und Baecker (aktiv/passiv) verglichen und bewertet. Die verschiedenen Ansätze verdeutlichen die Vielschichtigkeit des Konzepts.
Konzeptuelle Merkmale: In diesem Kapitel werden die zentralen konzeptionellen Merkmale von Community Education näher beleuchtet: Community Development, Lifelong Learning und ein Multicultural Approach. Diese drei Säulen des Konzepts werden in ihren Einzelheiten beschrieben und ihre Bedeutung für das Gesamtkonzept hervorgehoben. Der Fokus liegt auf der Verknüpfung dieser konzeptionellen Bausteine für eine ganzheitliche Betrachtung von Community Education.
Community Education in Deutschland: Dieses Kapitel widmet sich der Verbreitung und Umsetzung von Community Education in Deutschland. Es beschreibt die Popularisierung des Konzepts und seine verschiedenen Handlungsfelder, darunter Jugend- und Kulturarbeit, Gemeinwesenarbeit und die Arbeit im Schulbereich. Der Fokus liegt auf der Öffnung der Schule, der Öffnung des Unterrichts und der konkreten Umsetzung an alternativen Schulen. Voraussetzungen und Praxisbeispiele werden vorgestellt.
Die Ganztagsschule: Dieses Kapitel behandelt das Konzept der Ganztagsschule, deren Aufgaben nach dem Deutschen Bildungsrat (1968), verschiedene Organisationsformen und die damit verbundene Kritik. Es bietet einen umfassenden Überblick über die Ganztagsschule, ihre verschiedenen Facetten und die bestehenden Herausforderungen. Das Kapitel bereitet den Boden für die spätere Diskussion über die "geöffnete Ganztagsschule".
„Die geöffnete Ganztagsschule“: Dieses Kapitel befasst sich mit der Verbindung von Community Education und der Ganztagsschule, indem es Gemeinsamkeiten, Differenzen und Konsense zwischen beiden Konzepten herausarbeitet. Der Fokus liegt auf der Frage, wie die Prinzipien von Community Education zur Verbesserung der Ganztagsschule beitragen können. Das Kapitel sucht nach Synergieeffekten und Lösungsansätzen für die bestehenden Probleme der Ganztagsschule.
Schlüsselwörter
Community Education, Ganztagsschule, Schulreform, Bildungslandschaft, Kompetenzentwicklung, Lifelong Learning, Community Development, Öffnung der Schule, Partizipation, Soziale Kompetenz, Multicultural Approach.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Community Education und die geöffnete Ganztagsschule"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht Community Education als Lösungsansatz für die Herausforderungen der Ganztagsschule. Sie analysiert das Konzept der Community Education, seine historischen Wurzeln und verschiedenen Ausprägungen sowie dessen Implementierung in Deutschland, insbesondere im schulischen Kontext. Ein Fokus liegt auf der „geöffneten Ganztagsschule“ als mögliche Synthese beider Konzepte.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt die Konzepte von Community Education und Ganztagsschule umfassend. Es werden historische Wurzeln, verschiedene Definitionsversuche und Klassifikationen von Community Education beleuchtet. Die konzeptionellen Merkmale (Community Development, Lifelong Learning, Multicultural Approach) werden ebenso behandelt wie die Umsetzung von Community Education in Deutschland, insbesondere im Bereich der Schule (Öffnung der Schule und des Unterrichts). Die Ganztagsschule wird kritisch betrachtet, ihre Organisationsformen und Herausforderungen werden analysiert. Schließlich wird der mögliche Konsens zwischen Community Education und Ganztagsschule im Konzept der „geöffneten Ganztagsschule“ diskutiert.
Welche historischen Wurzeln von Community Education werden betrachtet?
Die Arbeit beleuchtet die historischen Wurzeln von Community Education in Großbritannien und den Vereinigten Staaten. Dabei werden wichtige Persönlichkeiten und deren Beiträge zur Entwicklung des Konzepts erwähnt, darunter Henry Morris, der Plowden-Report, Eric Midwinter, John Dewey, Frank Manley und Charles Stuart Mott.
Wie wird Community Education definiert und klassifiziert?
Die Arbeit analysiert verschiedene Ansätze zur Definition und Klassifizierung von Community Education. Es werden der konzeptorientierte Ansatz von Ashcroft, der praxisorientierte Ansatz von Clark, sowie differenzierende Ansätze nach Handlung, historisch-analytisch und nach Buhren (demokratisches, Life-long-learning, kompensatorisch-reformorientiertes, gesellschaftsveränderndes Modell) und Baecker (aktiv/passiv) verglichen und bewertet.
Welche konzeptionellen Merkmale von Community Education werden hervorgehoben?
Die Arbeit hebt die konzeptionellen Merkmale Community Development, Lifelong Learning und den Multicultural Approach hervor und beschreibt deren Bedeutung für das Gesamtkonzept von Community Education.
Wie wird Community Education in Deutschland umgesetzt?
Die Arbeit beschreibt die Verbreitung und Umsetzung von Community Education in Deutschland, mit Fokus auf die Handlungsfelder Jugend- und Kulturarbeit, Gemeinwesenarbeit und Schule (Öffnung der Schule und des Unterrichts). Sie beleuchtet die Umsetzung an alternativen Schulen und diskutiert Voraussetzungen und Praxisbeispiele.
Welche Aspekte der Ganztagsschule werden behandelt?
Die Arbeit behandelt das Konzept der Ganztagsschule, ihre Aufgaben nach dem Deutschen Bildungsrat (1968), verschiedene Organisationsformen und die damit verbundene Kritik. Es wird ein umfassender Überblick über die Ganztagsschule, ihre verschiedenen Facetten und bestehenden Herausforderungen gegeben.
Was ist die „geöffnete Ganztagsschule“?
Die „geöffnete Ganztagsschule“ wird als mögliche Synthese von Community Education und Ganztagsschule dargestellt. Die Arbeit untersucht Gemeinsamkeiten, Differenzen und Konsense zwischen beiden Konzepten und sucht nach Synergieeffekten und Lösungsansätzen für die bestehenden Probleme der Ganztagsschule.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Community Education, Ganztagsschule, Schulreform, Bildungslandschaft, Kompetenzentwicklung, Lifelong Learning, Community Development, Öffnung der Schule, Partizipation, Soziale Kompetenz, Multicultural Approach.
Welche Problematik des deutschen Schulsystems wird angesprochen?
Die Einleitung beschreibt Defizite im deutschen Schulsystem in Bezug auf Wissensvermittlung und Kompetenzentwicklung, insbesondere in Mathematik, Deutsch und den „Soft Skills“. Der Mangel an Kompetenzvermittlung wird durch alltagsnahe Beispiele illustriert (z.B. Beliebtheit eines Fastfood-Konzern-Infobusses bei Schülern und Lehrern).
- Quote paper
- Andreas Glück (Author), 2004, Community Education als Lösungsvorschlag zur Problematik der Ganztagsschule, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/55275