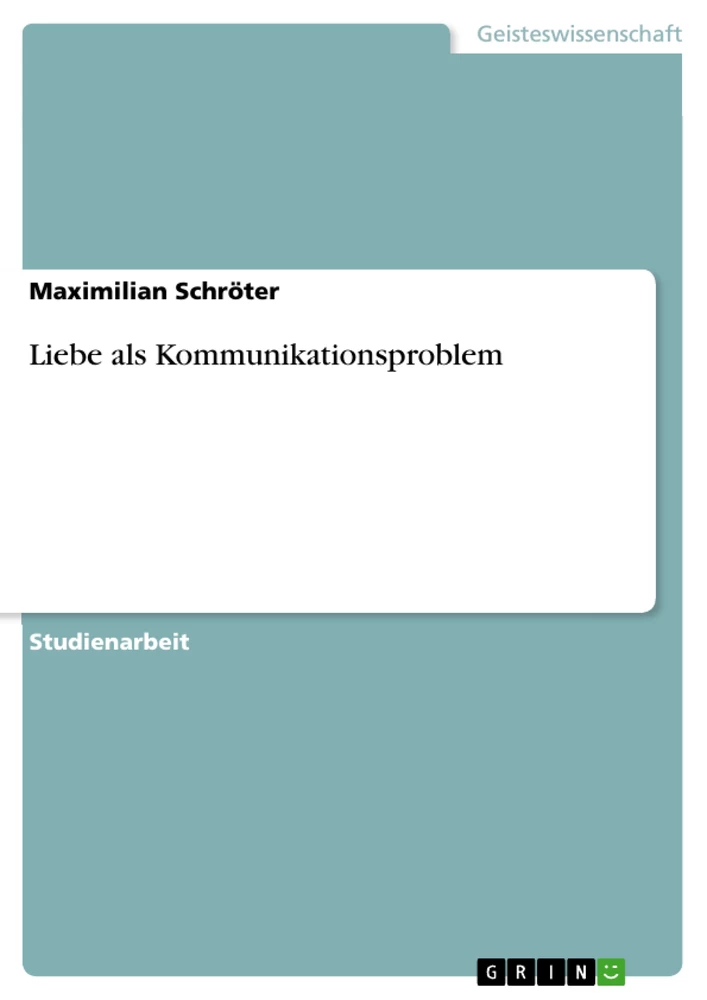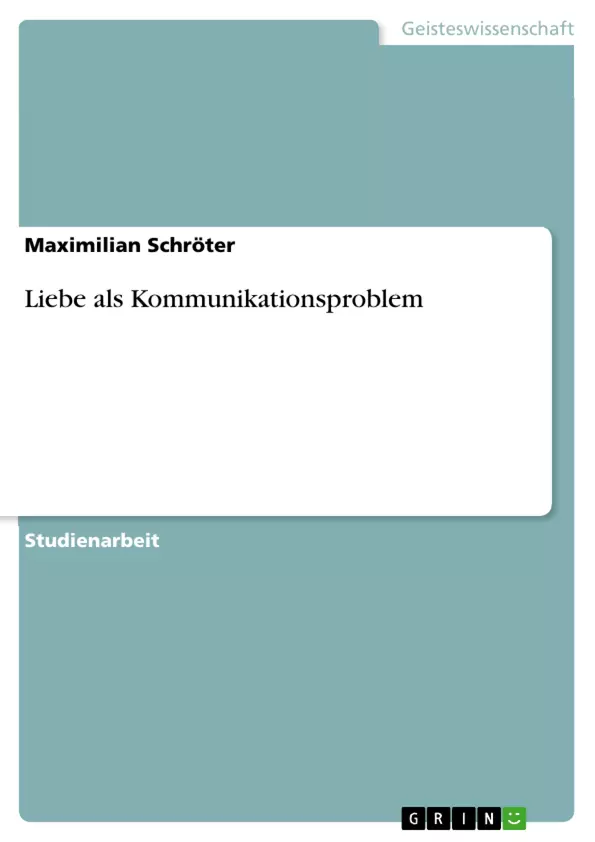Das Konzept der Liebe besagt, dass zwei Personen füreinander da sind, wobei dieses „für-einander“ nicht nur den jeweils anderen Liebespartner einschließt, sondern auch alle anderen Menschen ausschließt. Diese exklusive Zuwendung zum jeweiligen Liebespartner ist - so einfach sie auf den ersten Blick erscheinen mag - tatsächlich hochkomplex. Zwischen zwei Liebenden spielen sich ständig Kommunikationsprozesse ab, die für Liebessituationen typisch sind und so nur im Kontext der Liebe stattfinden. Letztendlich dienen sie dem Zweck, sich einander der Liebe, die man füreinander empfindet, zu versichern. Doch was genau wird dabei in der Liebeskommunikation kommuniziert - oder, aus einer etwas anderen Richtung betrachtet: Wie vermittelt man dem Partner dessen Bedeutung für einen selbst? Es geht also darum, wie sich Liebe kommunizieren lässt. Das Problem, auf das man beim Versuch, dem anderen aufrichtig seine Liebe zu ihm bzw. ihr vermitteln zu wollen, unweigerlich stößt, ist das der Inkommunikabilität (vgl. Luhmann 1994, 153ff). Um dabei die „Unmöglichkeit der Aufrichtigkeit“ (ebd., 154) zu umgehen, haben sich in der Liebeskommunikation ganz bestimmte Formen entwickelt, nach denen diese immer wieder abläuft.
Im Folgenden soll - nach einer kurzen, an Peter Fuchs orientierten Darstellung der Funktion, die die Liebe in der modernen Gesellschaft erfüllt - auf die Probleme verwiesen werden, die in der Liebeskommunikation auftreten und dargelegt werden, welche Strategien sich zu ihrer Lösung herausgebildet haben. Dabei wird die Literatur als Quelle von Formvorlagen für im Alltag stattfindende Liebeskommunikationen aufgezeigt und dargestellt, warum gerade die in Romanen beschriebenen Kommunikations- und Verhaltensweisen als Vorbild für reale Liebeskommunikation dienen. Zudem soll kurz die Frage danach behandelt werden, welche weiteren Quellen für Formvorlagen heute neben der Literatur existieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Anforderungen der funktional differenzierten Gesellschaft
- Romantische Liebe als Reaktion auf die funktionale Differenzierung
- Die Kommunikation von Einzigartigkeit – Das Problem der Aufrichtigkeit
- Die Herstellung von Aufrichtigkeit
- Das Gefühl
- Nonverbale Kommunikation
- Formvorlagen für den Code der Liebe
- Romane vs. Ratgeberliteratur
- Die Strategie der Opakisierung
- Weitere Quellen für Formvorlagen
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Rolle der Liebe in der modernen, funktional differenzierten Gesellschaft und ihre spezifischen Kommunikationsprobleme. Ziel ist es, aufzuzeigen, wie trotz dieser Probleme Aufrichtigkeit in der Liebeskommunikation erreicht werden kann, und welche Bedeutung dabei Formvorlagen spielen.
- Die Funktion der Liebe in der modernen Gesellschaft
- Die Kommunikationsprobleme der Liebe
- Die Herstellung von Aufrichtigkeit in der Liebeskommunikation
- Die Bedeutung von Formvorlagen
- Die Rolle der Literatur und anderer Quellen als Formvorlagen für Liebeskommunikation
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Konzept der Liebe in der modernen Gesellschaft vor und skizziert die damit verbundenen Kommunikationsprobleme. Kapitel 2 beleuchtet die Anforderungen der funktional differenzierten Gesellschaft und die Rolle der romantischen Liebe als Reaktion auf diese Differenzierung. Kapitel 3 beschäftigt sich mit der Herstellung von Aufrichtigkeit in der Liebeskommunikation und analysiert dabei die Bedeutung von Gefühlen und nonverbaler Kommunikation. Kapitel 4 untersucht die Bedeutung von Formvorlagen, insbesondere von Romanen und Ratgeberliteratur, für die Liebeskommunikation.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Hausarbeit sind romantische Liebe, funktionale Differenzierung, Liebeskommunikation, Aufrichtigkeit, Formvorlagen, Literatur, nonverbale Kommunikation, Opakisierung.
- Quote paper
- Maximilian Schröter (Author), 2006, Liebe als Kommunikationsproblem, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/54631