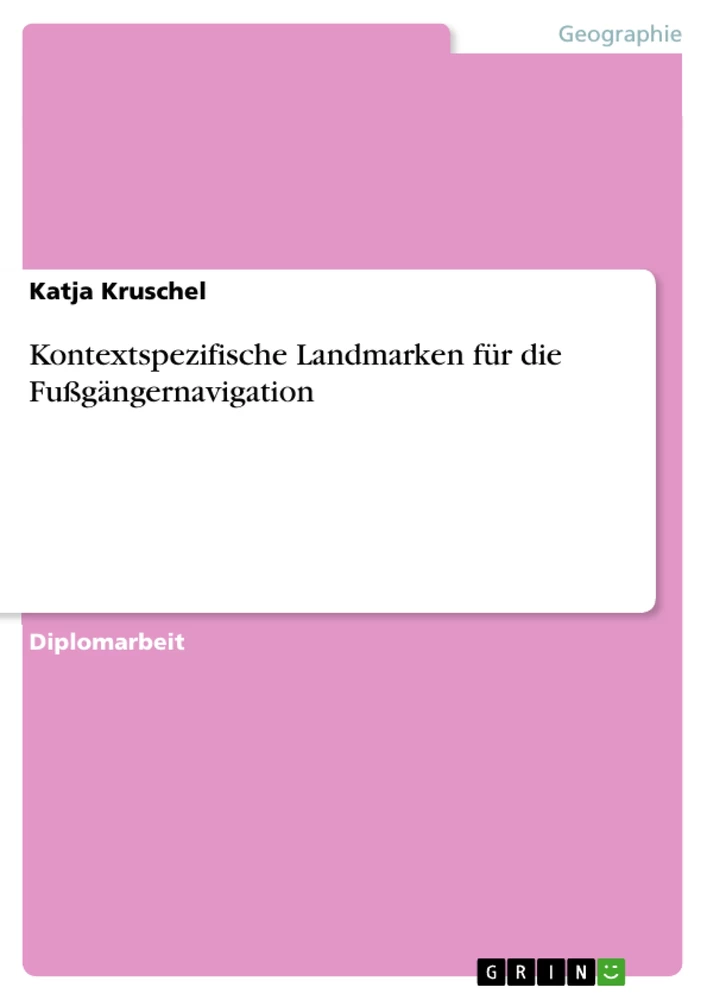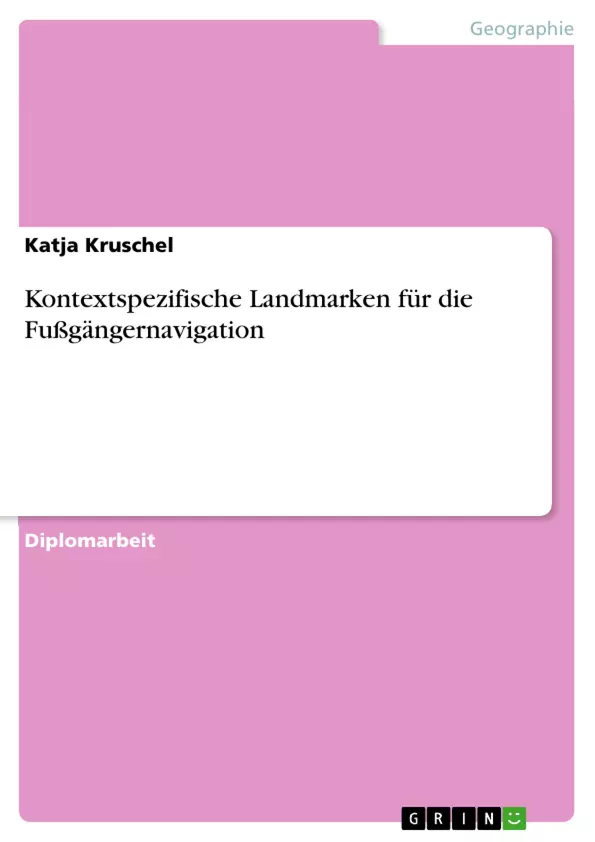Neben den hinweisenden Informationen in der Umwelt, z.B. in Form von Wegeleitsystemen, können Fußgänger mobile Geodienste zur Unterstützung von raumbezogenen Handlungen heranziehen. In Verbindung mit raum- und zeitbezogenen Daten sowie Positionierungstechnologien ermöglichen mobile Darstellungsgeräte erweiterte Einsatzmöglichkeiten für kartographische Informationssysteme. So bieten Location Based Services (LBS) als standortbezogene Dienste spezifische, auf den jeweiligen Kontext des Nutzers ausgerichtete Dienste an (Heidmann und Hermann 2003). Die Kartographie entwickelt deshalb nutzer- und aufga-benorientierte kartographische Kommunikationsformen für mobile Nutzungssituationen. In dieser Hinsicht erfährt das Medium Karte eine Veränderung in ihrer Funktion und wird zum interaktiven, dynamischen Hilfsmittel bei der Lösung räumlicher Aufgaben. Die Karte soll sich einem konkreten Nutzer, seiner Aufgabenstellung und seinem tatsächlichen Informationsbedarf anpassen (Reichenbacher 2004). Spezifische Nutzungssituationen und Nutzertypen werden in der Kartographie identifiziert und formal beschrieben.
Orientierung und Navigationwurden bereits als grundlegende Aufgabe mobiler Nutzer identifiziert und als ein kartographisches Handlungsfeld mit spezifischen Informationsbedürfnissen abgegrenzt. Entsprechende Positionierungs- und Routingdienste werden den Nutzern über mobile Darstellungsgeräte zur Verfügung gestellt, wobei die Qualität der kartographischen Medien in erster Linie an ihrer Aufgabenangemessenheit und ihrer Nutzerfreundlichkeit beurteilt wird. Die kartographische Routendarstellung soll die zielgerichtete Aufnahme und Verarbeitung von raumbezogener Information unter Berücksichtigung des jeweiligen Handlungskontextes unterstützen (Heidmann 1999). Um eine brauchbare, den Nutzerbedürfnissen angepasste kartographische Routengenerierung zu gewährleisten, müssen der Nutzer und sein Handlungskontext bei der kartographischen Konzeptualisierung von Anfang an im Mittelpunkt stehen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung: Der Fußgänger und sein Bedarf an Geoinformation
- 1.1 Die Bedeutung von Landmarken in Routendarstellung und Navigationssystemen
- 1.2 Landmarken im spezifischen Handlungskontext des Fußgängers
- 1.3 Aufbau der Arbeit
- 2. Ansätze zur Unterstützung der Fußgängernavigation
- 2.1 Stand der Entwicklung kartographischen Fußgängernavigationssysteme
- 2.2 Erkenntnisse der Raumkognition zur Entwicklung von Navigationssystemen für Fußgänger
- 2.3 Anforderungen an eine landmarkenbasierte kartographische Routendarstellung
- 3. Grundlagen zur Einbindung kontextspezifischer Landmarken
- 3.1 Das kartographische Handlungsfeld der Orientierung und Navigation
- 3.2 Handlungstheoretische Grundlagen
- 3.3 Der spezifische Handlungskontext des Fußgängers
- 3.3.1 Mentale und physische Handlungen
- 3.3.2 Das Artefakt
- 3.3.3 Der Handelnde und seine Rolle in der Gemeinschaft
- 3.3.4 Der Handlungsraum
- 3.4 Technischer und physikalischer Kontext
- 3.5 Ziele von Fußgänger-Handlungen
- 3.6 Phasen von Fußgänger-Handlungen
- 3.7 Fußgängerspezifische Funktionen von Landmarken
- 4. Kriterien für die landmarkenbasierte Routendarstellung
- 4.1 Kognitive Informationsverarbeitung bei der Orientierung und Navigation
- 4.1.1 Wahrnehmung und Interaktion im Raum
- 4.1.2 Temporal-funktionale Gliederung der Gedächtnissysteme
- 4.1.3 Integrative und handlungsorientierte Informationsverarbeitung
- 4.1.4 Kriterien bei der Wegfindung
- 4.1.5 Ableitung der Funktionen von Landmarken beim Wegfinden
- 4.2 Kartographische Modellierung einer landmarkenbasierten Routenkarte
- 4.2.1 Die Karte im konkreten Kommuniaktionskontext des Fußgängers
- 4.2.2 Ansätze für die kontextorientierte Modellierung von Fußgängerkarten
- 4.2.3 Präsentation raumbezogener Information in Routenkarten für Fußgänger
- 4.2.4 Kartographische Routenführung in Wegfindungsphasen
- 4.1 Kognitive Informationsverarbeitung bei der Orientierung und Navigation
- 5. Zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse und Folgerungen
- 5.1 Zusammenfassung der Ergebnisse
- 5.2 Ausblick auf mögliche Ansatzpunkte für weitere Untersuchungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit untersucht die Bedeutung kontextspezifischer Landmarken für die Fußgängernavigation und deren kartographische Darstellung. Ziel ist die Ermittlung von Kriterien für eine handlungsorientierte Routendarstellung, die die kognitive Informationsverarbeitung des Fußgängers berücksichtigt.
- Analyse des spezifischen Handlungskontextes des Fußgängers
- Kognitive Informationsverarbeitung bei der Orientierung und Navigation
- Kriterien für die Auswahl und Darstellung von Landmarken auf Karten
- Kartographische Modellierung einer landmarkenbasierten Routenkarte
- Entwicklung von Empfehlungen für eine verbesserte Fußgängernavigation
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Der Fußgänger und sein Bedarf an Geoinformation: Dieses Kapitel führt in das Thema ein und beschreibt die Bedeutung von Landmarken für die Orientierung und Navigation von Fußgängern. Es werden die Herausforderungen bei der Entwicklung von Navigationssystemen für Fußgänger angesprochen und der Aufbau der Arbeit erläutert. Der Fokus liegt auf der Notwendigkeit einer handlungsorientierten und kontextspezifischen Darstellung von Routeninformationen für Fußgänger, im Gegensatz zu den Ansätzen der Fahrzeugnavigation.
2. Ansätze zur Unterstützung der Fußgängernavigation: Dieses Kapitel beleuchtet den aktuellen Stand der Entwicklung von kartographischen Navigationssystemen für Fußgänger und die Erkenntnisse der Raumkognitionsforschung, die für die Entwicklung solcher Systeme relevant sind. Es werden bestehende Systeme kritisch bewertet und deren Stärken und Schwächen im Hinblick auf die Berücksichtigung von Landmarken und dem Handlungskontext des Fußgängers analysiert. Die Anforderungen an eine verbesserte, landmarkenbasierte kartographische Routendarstellung werden formuliert.
3. Grundlagen zur Einbindung kontextspezifischer Landmarken: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für die Arbeit fest. Es werden handlungstheoretische Ansätze vorgestellt und der spezifische Handlungskontext des Fußgängers detailliert analysiert, inklusive mentaler und physischer Handlungen, der Rolle des Artefakts (Karte), des Handelnden und seines Handlungsraums. Die Kapitel analysieren die Ziele und Phasen von Fußgängerhandlungen und wie Landmarken dabei eine Rolle spielen. Es wird ein umfassendes Verständnis des komplexen Zusammenspiels von Mensch, Raum und Karte geschaffen.
4. Kriterien für die landmarkenbasierte Routendarstellung: In diesem Kapitel wird die kognitive Informationsverarbeitung bei der Orientierung und Navigation von Fußgängern untersucht. Es werden die relevanten Prozesse der Wahrnehmung, Interaktion im Raum, die Rolle von Gedächtnissystemen und die Bedeutung visueller Reize wie Bewegungsparallaxen und Bewegungsperspektive beleuchtet. Der Fokus liegt auf der Ableitung von Kriterien für die Auswahl und Darstellung von Landmarken, welche die mentale Wegfindung unterstützen. Es wird ein Modell für die kartographische Modellierung einer landmarkenbasierten Routenkarte entwickelt.
Schlüsselwörter
Fußgängernavigation, Landmarken, Kartographie, Raumkognition, Handlungstheorie, Wegfindung, Routendarstellung, kognitive Informationsverarbeitung, mentale Repräsentation, kartographische Modellierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Landmarkenbasierte Routendarstellung für Fußgänger
Was ist das Thema der Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die Bedeutung kontextspezifischer Landmarken für die Fußgängernavigation und deren kartographische Darstellung. Das Hauptziel ist die Ermittlung von Kriterien für eine handlungsorientierte Routendarstellung, die die kognitive Informationsverarbeitung des Fußgängers berücksichtigt.
Welche Aspekte werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit analysiert den spezifischen Handlungskontext des Fußgängers, die kognitive Informationsverarbeitung bei der Orientierung und Navigation, Kriterien für die Auswahl und Darstellung von Landmarken auf Karten, die kartographische Modellierung einer landmarkenbasierten Routenkarte und entwickelt schließlich Empfehlungen für eine verbesserte Fußgängernavigation.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Ansätze zur Unterstützung der Fußgängernavigation, Grundlagen zur Einbindung kontextspezifischer Landmarken, Kriterien für die landmarkenbasierte Routendarstellung und abschließend eine Zusammenfassung der Ergebnisse und ein Ausblick.
Was wird im ersten Kapitel behandelt?
Das erste Kapitel führt in das Thema ein und beschreibt die Bedeutung von Landmarken für die Orientierung und Navigation von Fußgängern. Es werden die Herausforderungen bei der Entwicklung von Navigationssystemen für Fußgänger angesprochen und der Aufbau der Arbeit erläutert. Der Fokus liegt auf der Notwendigkeit einer handlungsorientierten und kontextspezifischen Darstellung von Routeninformationen für Fußgänger.
Was wird im zweiten Kapitel behandelt?
Das zweite Kapitel beleuchtet den aktuellen Stand der Entwicklung kartographischer Navigationssysteme für Fußgänger und die Erkenntnisse der Raumkognitionsforschung. Es werden bestehende Systeme kritisch bewertet und deren Stärken und Schwächen analysiert. Die Anforderungen an eine verbesserte, landmarkenbasierte kartographische Routendarstellung werden formuliert.
Was wird im dritten Kapitel behandelt?
Das dritte Kapitel legt die theoretischen Grundlagen fest. Es werden handlungstheoretische Ansätze vorgestellt und der spezifische Handlungskontext des Fußgängers detailliert analysiert, inklusive mentaler und physischer Handlungen, der Rolle der Karte, des Handelnden und seines Handlungsraums. Die Ziele und Phasen von Fußgängerhandlungen und die Rolle von Landmarken werden analysiert.
Was wird im vierten Kapitel behandelt?
Das vierte Kapitel untersucht die kognitive Informationsverarbeitung bei der Orientierung und Navigation von Fußgängern. Es werden Prozesse der Wahrnehmung, Interaktion im Raum, die Rolle von Gedächtnissystemen und die Bedeutung visueller Reize beleuchtet. Der Fokus liegt auf der Ableitung von Kriterien für die Auswahl und Darstellung von Landmarken, die die mentale Wegfindung unterstützen. Ein Modell für die kartographische Modellierung wird entwickelt.
Was wird im fünften Kapitel behandelt?
Das fünfte Kapitel fasst die Ergebnisse zusammen, zieht Schlussfolgerungen und gibt einen Ausblick auf mögliche Ansatzpunkte für weitere Untersuchungen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Fußgängernavigation, Landmarken, Kartographie, Raumkognition, Handlungstheorie, Wegfindung, Routendarstellung, kognitive Informationsverarbeitung, mentale Repräsentation, kartographische Modellierung.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Zielsetzung der Arbeit ist die Ermittlung von Kriterien für eine handlungsorientierte und kontextspezifische Routendarstellung für Fußgänger, die die kognitive Informationsverarbeitung berücksichtigt.
- Quote paper
- Katja Kruschel (Author), 2005, Kontextspezifische Landmarken für die Fußgängernavigation, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/53907