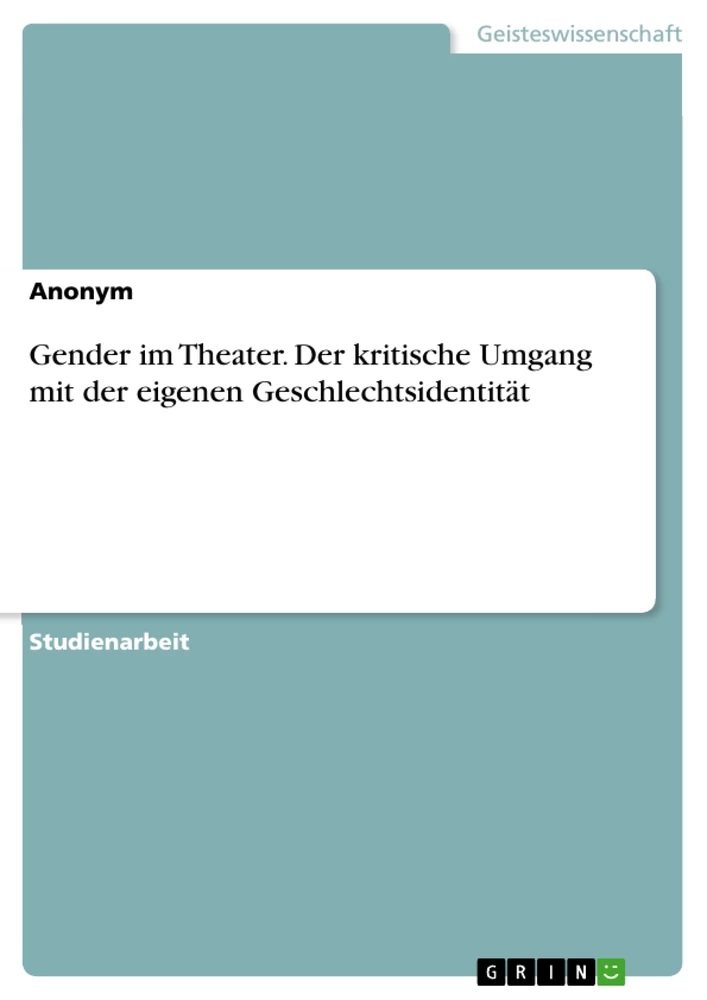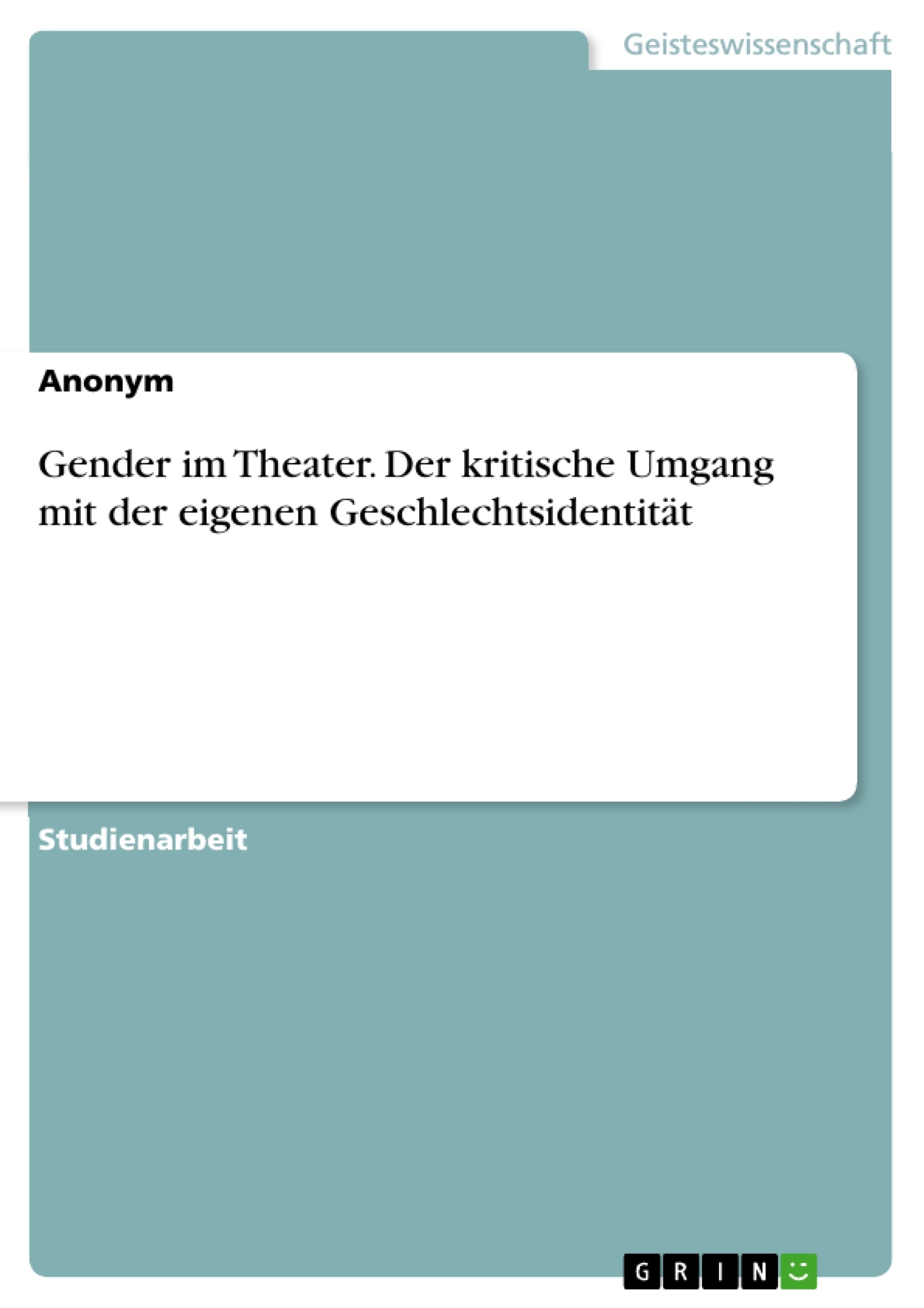Die Arbeit thematisiert den kritischen Umgang mit der eigenen Geschlechtsidentität.
Schon seit Jahren fordern viele Menschen die Abschaffung des binären Geschlechtersystems. Die Eingliederung des dritten, diversen Geschlechts kann man hier als ersten Schritt in eine Gesellschaft der Geschlechterdiversität deuten. Trotzdem ist es damit nicht getan, und genau hier möchte der Autor ansetzen. Was tut ein Mensch, der ausgegrenzt und diskriminiert wird, da sein soziales Verhalten, also sein soziales Geschlecht, nicht seiner biologischen Bestimmung, also seinem biologischen Geschlecht, gleicht? Wie kann eine Diskriminierung verhindert werden?
Diese Seminararbeit stellt die Grundlage einer Performance in Form eines Forumtheaters dar. Das vorgestellte Konfliktthema dreht sich darum, dass die persönliche Entwicklung des/der Protagonist/ -in eingeschränkt ist. Der/die Protagonist/-in fühlt sich in seinem/ihrem biologischen oder sozialen Geschlecht unwohl. Da jedoch die Norm ist, dass das soziale Geschlecht dem biologischen Geschlecht gleicht, erfährt er/sie Diskriminierung. Deshalb stellt sich die Frage, was gemacht werden kann, damit der/die Protagonist/ -in seine/ihre Persönlichkeit ausleben kann.
Inhaltsangabe
Gendern
Recherche
Fragestellung
Textauswahl
Begründungen zur Dramaturgie
Theatrale Mittel
Literaturverzeichnis
Gendern
Laut Diewald/Steinhauer (2017: 5) ist gendern „[…] sehr allgemein gesprochen, ein sprachliches Verfahren, um Gleichberechtigung, d.h. die gleiche und faire Behandlung von Frauen und Männern im Sprachgebrauch zu erreichen.“ Wir nutzen das Prinzip des Gender-Sterns („Sozialarbeiter*innen“). Dieser Stern soll einerseits die Aufmerksamkeit auf die Tatsache lenken, dass in den meisten gesellschaftlichen und sozialen Systemen nicht nur Männer vertreten sind, sondern auch andererseits alle Menschen einschließen, die sich nicht in das binäre Geschlechtersystem Mann/Frau einordnen können oder wollen.
Recherche
Gerade bei der Entwicklung unseres Schwerpunkts, hat es einige Zeit gedauert, bis wir zu einem Resultat kamen. Zunächst half uns das Führen des Projekttagebuchs. Hier konnten wir schon vor Seminarbeginn Gedanken und Erfahrungen über das eigene Körperbewusstsein und das eigene Empfinden zum Thema Geschlecht niederschreiben. Zunächst fiel es uns schwer, beispielsweise darüber nachzudenken, wann wir uns weiblich oder männlich fühlen, oder wann wir gerne unser Geschlecht wechseln würden. Mit der Zeit jedoch, und vor allem nach den Seminartagen, fingen wir an auch im Alltag viele Thematiken stärker wahrzunehmen. Einen großen Teil dazu beigetragen haben auch die Literaturempfehlungen, die der Dozierende uns zu Beginn der Veranstaltung zur Verfügung gestellt hat. Hier konnten wir schnell herausfinden, welche Texte und somit auch Thematiken besonderes Interesse wecken würden. Die einzelnen Texte werden im Kapitel „Textauswahl“ genauer behandelt. Wir waren dementsprechend sensibilisiert und reflektierten im Alltag stätig erlebte Situationen, was das Projekttagebuch allmählich füllte.
Im Umgang miteinander als Gruppe merkten wir schnell, dass uns drei ein Themenschwerpunkt besonders zu interessieren schien: Der kritische Umgang mit der eigenen Geschlechtsidentität. Dementsprechend kreisten sich auch unsere selbstgeschriebenen Texte oder die gebastelten Collagen um diesen Inhalt. Im Folgenden recherchierten wir auch selbstständig zu Hause weiterhin, was wir ebenfalls im Kapitel „Textauswahl“ genauer beleuchten. Des Weiteren halfen uns gemeinsame Treffen, in denen wir, anstatt viel zu diskutieren, einfach ausprobiert haben, viel weiter. Hierbei konnten wir von der Theorie in die Praxis wechseln. Im letzten Schritt schrieben wir unsere Ideen nieder, um Erinnerungslücken möglichst zu vermeiden.
Fragestellung
Bereits im Kapitel „Recherche“ wurde beschrieben, dass das Interessengebiet von allen Gruppenmitgliedern in der Geschlechterproblematik liegt. Gemeint ist hiermit der Unterschied zwischen dem sozialen und biologischen Geschlecht.
Das Konfliktthema, welches wir im Forumstheater vorstellen werden, dreht sich darum, dass die persönliche Entwicklung des*der Protagonist*in eingeschränkt ist. Der*die Protagonist*in fühlt sich in seinem*ihren biologischen oder sozialen Geschlecht unwohl. Da jedoch die Norm ist, dass das soziale Geschlecht dem biologischen Geschlecht gleicht, erfährt er*sie Diskriminierung. Deshalb fragten wir uns, was gemacht werden kann, damit der*die Protagonist*in seine*ihre Persönlichkeit ausleben kann.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Konfliktthema, Sozialer Kontext und Fragestellung in einer schematischen Darstellung.
Begründen möchten wir diese thematische Schwerpunktsetzung mit der aktuellen gesellschaftlichen Relevanz. Schon seit Jahren fordern viele Menschen die Abschaffung des binären Geschlechtersystems. Die Eingliederung des dritten, diversen Geschlechts kann man hier als ersten Schritt in eine Gesellschaft der Geschlechterdiversität deuten. Trotzdem ist es damit nicht getan, und genau hier wollen wir ansetzen. Was tut ein Mensch, der ausgegrenzt und diskriminiert wird, da sein soziales Verhalten, also sein soziales Geschlecht, nicht seiner biologischen Bestimmung, also seinem biologischen Geschlecht, gleicht? Wie kann eine Diskriminierung verhindert werden?
Textauswahl
Thematisch behandeln wir den Text „taz-Männer über #MeToo-Situationen. Wie konnte ich so ein Arsch sein?“, redigiert von Anna Franzke, Marlene Halser und Dina Riese, gedruckt am 08.09.2018 in der Tageszeitung „taz“. Hierbei wird in Bezug auf die #MeToo-Debatte, bei der Frauen von erlebter sexualisierter Gewalt berichten, genommen und Männer sprechen lassen. Die Männer erzählten von Situationen, die sie bis heute beschäftigen. Situationen, in denen sie weggeschaut haben, während eine Frau Opfer sexualisierter Gewalt geworden ist- oder Situationen, in denen sie selbst zum aktiven Täter geworden sind. Weshalb dieser Text uns inspiriert hat, liegt vor allem daran, dass unserer Meinung nach in der #MeToo-Debatte sehr häufig von dem klassischen binären System ausgegangen wird, in dem der Mann der Täter ist und die Frau das Opfer. Wir haben uns beim Lesen die Frage gestellt, inwiefern die soziale Geschlechterrolle des Mannes das Verhalten in derartigen Situationen beeinflusst. Ob der Mann eventuell zum Täter wird, ohne es zu wollen oder ohne es zu wissen, lediglich aus der Erziehung innerhalb des männlichen Wertesystems heraus. Eine interessante, zusammenfassende Aussage eines anonymen Autors (2018: 5f) lautet „Ich fand den Griff an den Hintern schon damals nicht richtig. Aber ich fand ihn auch nicht so richtig schlimm. Zumindest nicht schlimm genug, um einzugreifen. Und das war das Problem.“ Hier wird unserer Meinung nach deutlich, dass die Person im Zwiespalt mit sich selbst war und ist.
Weiterhin beeinflussten uns die Auftritte von Tony Porter, der als Autor, Lehrer und Aktivist bekannt ist. Der auf Ted.com veröffentlichte Vortrag vom Dezember 2010 („A call to men“) spricht unter anderem die beigebrachten stereotypischen Verhaltensweisen an, unter denen Männer leiden. Er sagt beispielsweise aus, dass es völlig in Ordnung ist, wenn Männer ihre Emotionen preis geben- dass sie dies jedoch nie beigebracht bekommen. Dies passt thematisch sehr gut zu unserem Schwerpunkt, der kritischen Auseinandersetzung mit der Diskrepanz zwischen dem sozialen und biologischen Geschlecht.
Das Gedicht „NORMEN NERVEN.“ von Jana_Lou Herbst half uns weiter, da wir selbst ein Thema gewählt haben, welches Normen anzweifelt. Während Herbst über verschiedene Körper schreibt, zeigen wir innerhalb unserer Performance eine*n Protagonist*in, dessen*deren soziale Geschlechtsidentität nicht zur Norm des biologischen Geschlechts passt.
Nicht ausgewählt, jedoch gelesen, wurde unter anderem der Text des Beitrags „Intersektionale Pädagogik. Handreichung für Sozialarbeiter_innen, Erzieher_innen, Lehrkräfte und die, die es noch werden wollen.“ Auch wenn hier sehr interessante Interviews verschriftlicht wurden, haben wir uns entschieden, diesen Text nicht wesentlich in unsere Performance einfließen zu lassen. Die Sichtweise von Kindern und Jugendlichen ist zwar interessant, würde aber eventuell zu viel für die Szene werden. Wir möchten die Gegner*innen des Protagonisten unabhängig vom Alter auftreten lassen.
Begründungen zur Dramaturgie
Als Protagonist*in fungiert Person A. Das Begehren des*der Protagonist*in wird deutlich, indem er*sie eine eigene Persönlichkeit (hier: ein Würfel), fernab von den Geschlechternormen, zusammenbaut. Der*die Protagonist*in kämpft während der gesamten Szene um den Würfel und drückt das Begehren zusätzlich noch am Ende durch die Worte: „Lass mich!“ aus. Durch die Unterdrückung der selbstgewählten Persönlichkeit entsteht die Notwendigkeit für den*die Protagonist*in, für sich zu kämpfen, da ihm*ihr sonst stetige Unzufriedenheit droht. Person B spiegelt die heteronormative, konservative Gesellschaft als Antagonist*in wider. Er*sie unterdrückt die Persönlichkeitsentfaltung des*der Protagonist*in, indem er*sie dem*der Protagonist*in den Würfel entreißt. Außerdem versucht er*sie die Rollenkonformität des*der Protagonist*in wiederherzustellen, indem er*sie die langen Haare des*der Protagonist*in am Ende der Szene abschneiden will. Der*die Verbündete wird von Person C dargestellt. Er*sie befindet sich im Zwiespalt zwischen den gesellschaftlichen Normen (=Antagonist*in) und der individuellen, freien Persönlichkeitsentfaltung (=Protagonist*in). Am Ende der Szene gibt der*die Verbündete jedoch den lauten gesellschaftlichen Normen nach.
[...]
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2019, Gender im Theater. Der kritische Umgang mit der eigenen Geschlechtsidentität, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/535576