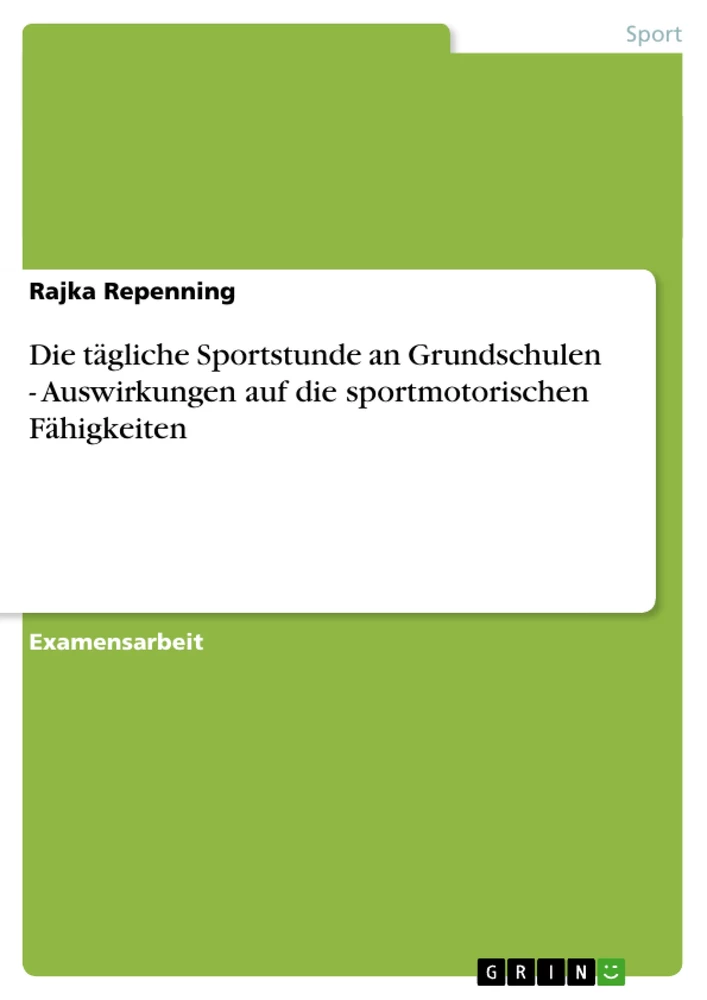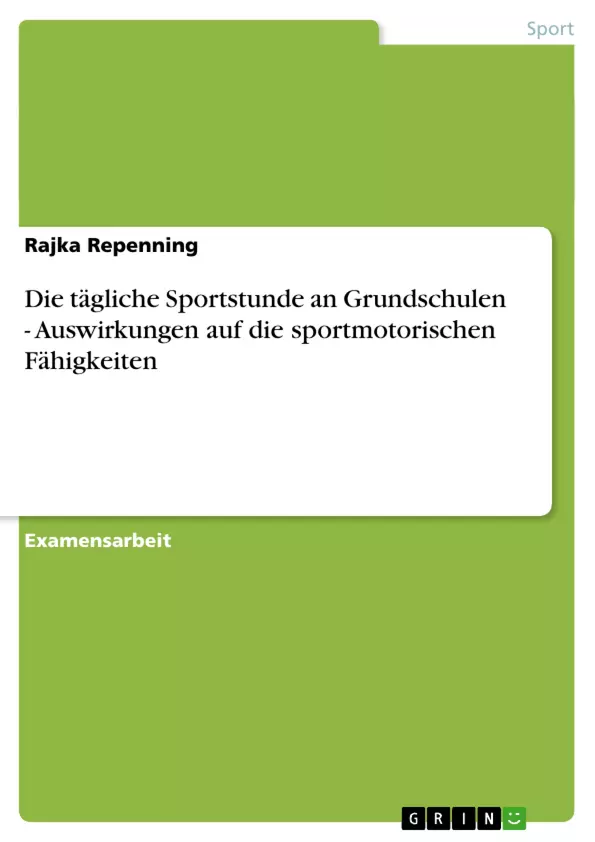„Urbanisierung, Mediatisierung, Verhäuslichung, Sozialumbruch“ „Veränderte Lebensbedingungen = reduzierte Leistungsbedingungen?“ „Unbewegte Kindheit“
„Können Kinder wirklich nicht mehr rückwärts laufen?“
„Motorik von Kindern heute - eine Generation von „Schlaffis und Desinteressierten“?“
So oder so ähnlich lauten die Schlagzeilen, die immer öfter in den Medien zu lesen sind. In der Literatur besteht ein weitestgehender Konsens darüber, dass sich die motorischen Leistungen der Kinder in den letzten Jahren verändert haben. „Statistisch gesehen sind bis zu 65 % der Kinder im Primarschulbereich bereits haltungsgeschwächt bzw. sogar -geschädigt.“
Während einige Wissenschaftler (OBST-KITZMÜLLER, BÖS, ZIMMER u.a.)2über den Verfall der kindlichen Bewegungswelt und dem damit verbundenen Rückgang der motorischen Leistungsfähigkeit klagen, sind andere Wissenschaftler (DORDEL, KRETSCHMER, GIEWALD u.a.)3davon überzeugt, dass dramatisch dargestellte Veränderungen des Gesundheitszustandes und der Leistungsfähigkeit von Kindern stark übertrieben sind. Unstrittig ist allerdings, dass sich die Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten stark gewandelt hat, was nicht zuletzt auch eine veränderte kindliche Lebensumwelt zur Folge hat. Neben starken Veränderungen im familiären Bereich (Zunahme der Ein-Kind-Familien, der Alleinerziehenden und der Scheidungskinder) haben sich auch die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, Erziehungsziele und Erziehungsnormen sowie das Freizeit- und Konsumverhalten verändert. „Daraus ergeben sich weitreichende Konsequenzen für die Kinder und ihre Lebens- sowie Bewegungswelt.“ Eine der möglichen Maßnahmen gegen einen zunehmenden Bewegungsmangel der heutigen Kinder kann die tägliche Bewegungszeit in Schulen darstellen. Sie kann versuchen, das sich aus dem Wandel der Gesellschaft ergebende, zunehmende Bewegungsdefizit zu kompensieren. In diesem Zusammenhang stieß ich auf das Konzept der täglichen Sportstunde. Zunächst suchte ich in Schleswig-Holstein nach Schulen, die eine tägliche Sportstunde eingerichtet haben. Zu meiner Verwunderung fand ich dabei lediglich zwei Schulen, die jeden Schüler jeden Tag im Fach Sport unterrichten. Nach Aussagen der beiden Schulen richteten sie sich nach dem Modell der Friedrich-Ebert-Schule in Bad Homburg, welche die tägliche Sportstunde seit gut zehn Jahren in ihren Stundenplan aufgenommen hat. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Grundlagen
- Kindheit im Wandel
- Kindheit früher und heute
- Kindheit und Medien
- Kindheit und Bewegung
- Kindheit und Schulsport
- Vorstellung Konzept „Tägliche Sportstunde“ am Beispiel der Friedrich-Ebert-Schule in Bad Homburg
- Motorische Fähigkeiten
- Konditionelle Fähigkeiten
- Kraft
- Schnelligkeit
- Ausdauer
- Beweglichkeit
- Koordinative Fähigkeiten
- Konditionelle Fähigkeiten
- Definition Sportmotorischer Test
- Kindheit im Wandel
- Methodik
- Zielsetzung und Fragestellung
- Untersuchungsdesign
- Vorstellung der Versuchsschulen
- Friedrich-Ebert-Schule Bad Homburg
- Hermann-Ehlers-Schule Preetz
- Beschreibung der Versuchsgruppen
- Beschreibung der Tests
- Gütekriterien
- Ergebnisse
- Diskussion der Ergebnisse im Hinblick auf die Fragestellung und Zielsetzung
- Fazit
- Zusammenfassung
- Literaturverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der Untersuchung der Auswirkungen einer täglichen Sportstunde an Grundschulen auf die sportmotorischen Fähigkeiten von Schülern. Die Arbeit analysiert die Entwicklung der motorischen Fähigkeiten in zwei verschiedenen Schulformen, einer mit täglicher Sportstunde und einer mit dem traditionellen Stundenplan.
- Die Entwicklung und der Wandel der Kindheit im Kontext von Medien und Bewegung
- Das Konzept der "Täglichen Sportstunde" und seine Implementierung an Grundschulen
- Die Bedeutung sportmotorischer Fähigkeiten für die kindliche Entwicklung
- Die Analyse der Effekte der "Täglichen Sportstunde" auf die motorischen Fähigkeiten von Schülern
- Die methodische Herangehensweise an die Untersuchung der sportmotorischen Fähigkeiten
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt das Thema der Hausarbeit vor und erläutert die Bedeutung der sportmotorischen Fähigkeiten im Kontext der kindlichen Entwicklung.
- Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel beleuchtet den Wandel der Kindheit und die Bedeutung von Bewegung im heutigen Kontext. Es beleuchtet das Konzept der "Täglichen Sportstunde" und definiert die relevanten sportmotorischen Fähigkeiten.
- Methodik: Hier wird das Untersuchungsdesign der Arbeit vorgestellt, die Versuchsschulen und Versuchsgruppen beschrieben und die verwendeten Tests erläutert.
- Ergebnisse: Die Ergebnisse der durchgeführten Untersuchungen werden in diesem Kapitel zusammengefasst und dargestellt.
- Diskussion der Ergebnisse im Hinblick auf die Fragestellung und Zielsetzung: Dieses Kapitel analysiert die Ergebnisse der Untersuchung im Hinblick auf die Forschungsfrage und die Zielsetzung der Arbeit.
Schlüsselwörter
Tägliche Sportstunde, Grundschule, sportmotorische Fähigkeiten, Konditionelle Fähigkeiten, Koordinative Fähigkeiten, Bewegungsentwicklung, Kindheit, Schulsport, empirische Untersuchung.
Häufig gestellte Fragen
Welche Auswirkungen hat die tägliche Sportstunde auf Grundschüler?
Die tägliche Sportstunde zielt darauf ab, dem zunehmenden Bewegungsmangel entgegenzuwirken und die sportmotorischen Fähigkeiten (Kraft, Ausdauer, Koordination) der Kinder nachhaltig zu verbessern.
Warum wird über einen Verfall der kindlichen Motorik diskutiert?
Durch Urbanisierung, Mediatisierung und veränderte Freizeitgewohnheiten bewegen sich Kinder weniger. Studien zeigen, dass viele Primarschüler bereits Haltungsschäden oder Defizite bei einfachen Übungen wie dem Rückwärtslaufen haben.
Was beinhaltet das Konzept der Friedrich-Ebert-Schule?
Die Schule in Bad Homburg integriert seit über zehn Jahren eine tägliche Sportstunde in den Stundenplan, um die körperliche Entwicklung der Schüler als festen Bestandteil des Schulalltags zu fördern.
Welche motorischen Fähigkeiten werden im Test untersucht?
Untersucht werden konditionelle Fähigkeiten (Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer, Beweglichkeit) sowie koordinative Fähigkeiten, die für die allgemeine Bewegungssteuerung wichtig sind.
Wie wurde die Wirksamkeit der täglichen Sportstunde wissenschaftlich geprüft?
In einer empirischen Untersuchung wurden Versuchsgruppen an Schulen mit täglichem Sportunterricht mit Schulen verglichen, die einen traditionellen Stundenplan führen, um Unterschiede in der Leistungsentwicklung festzustellen.
- Quote paper
- Rajka Repenning (Author), 2004, Die tägliche Sportstunde an Grundschulen - Auswirkungen auf die sportmotorischen Fähigkeiten, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/53121