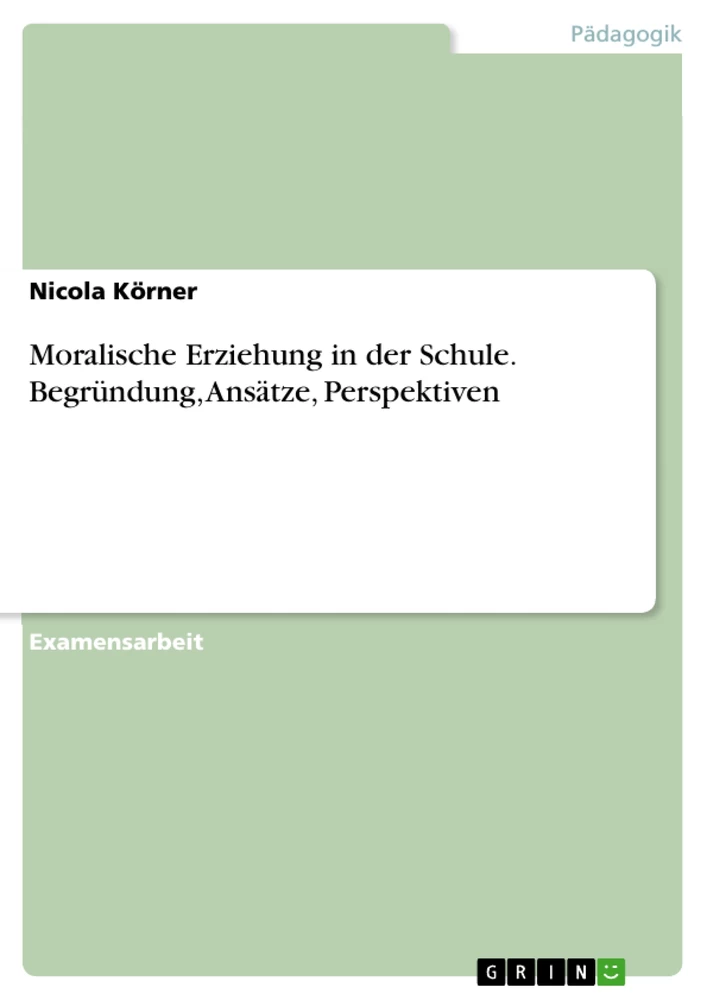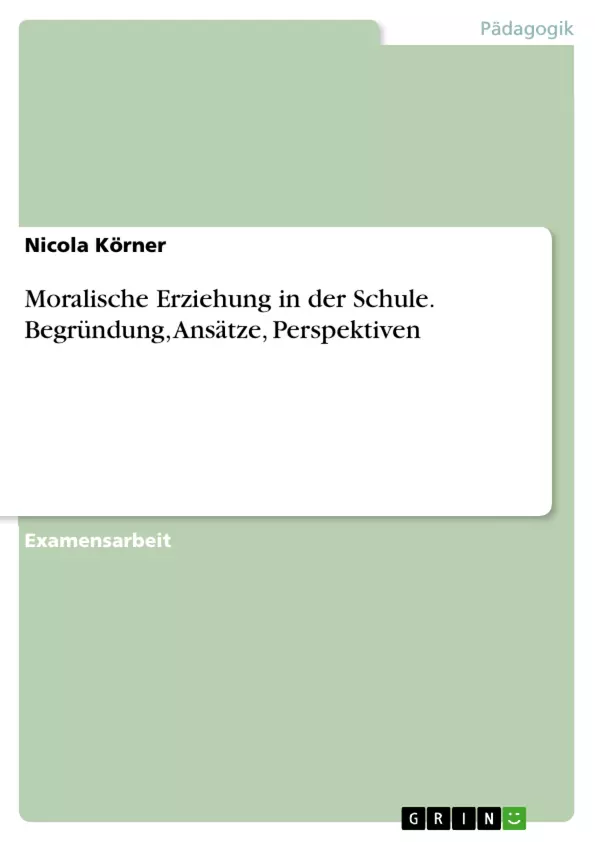In den ständig diskutierten internationalen Schulvergleichsuntersuchungen wird der Focus ausschließlich auf Fachleistungen gelenkt. Dabei kann es passieren, dass man wesentliche Ziele von Schule, zu denen auch außerfachliche Ziele gehören, übersieht.
Moralerziehung rückt immer dann in den Fokus, wenn aktuelle Ereignisse die Diskussion erneut entfachen. Oft handelt es sich dabei um Brutalität Jugendlicher gegenüber Gleichaltrigen oder aber auch Kindern.
Die vorliegende Veröffentlichung beschäftigt sich mit der Frage, ob eine bewusste moralische Erziehung in der Schule tatsächlich möglich ist, d.h. ob sie erstens geeignet ist, das Verhalten und die moralischen Fähigkeiten von Schülerinnen und Schülern positiv zu beeinflussen und zweitens, ob ein solches Unterfangen in der staatlichen Schule eines Staates, der sich verpflichtet selbst Weltanschauungsneutral zu sein, überhaupt legitimiert werden kann. In diesem Rahmen werden auch die Erwartungen, die hinter der Forderung schulischer Moralerziehung stehen erörtert sowie Grundbedingungen, von denen jede Moralerziehung ausgehen muss.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zum Begriff der Moral und seiner terminologischen Umgebung
- Werte und Normen
- Ethik und Moral
- Psychologische und empirische Grundlagen
- Kohlbergs Theorie moralischer Entwicklung
- Ausgangspunkte der Theorie
- Das Stufenmodell der moralischen Entwicklung
- Kritik an Kohlbergs Theorie
- Zur Kulturübergreifenden Gültigkeit von Kohlbergs Theorie
- Frühkindliche Moralentwicklung
- Verhältnis von Inhalt und Struktur in Kohlbergs Theorie
- Geschlechtsunterschiede im moralischen Urteil
- Zusammenfassung
- Relevanz von Kohlbergs Theorie für die pädagogische Praxis
- Vom Urteilen zum Handeln
- Was charakterisiert moralisches Handeln?
- Verantwortungsurteile und moralische Typen
- Moralisches Selbst
- Außermoralische Einflussfaktoren
- Empathie und moralische Gefühle
- Die moralische Atmosphäre
- Erziehungsziele der Schule und Einstellungen und Verhaltensweisen der Jugend
- Welche Art von Menschen soll die Schule hervorbringen?
- Erziehungsziele in den Grundsatzerlassen der Grund-, Haupt- und Realschule
- Der Bildungsauftrag der Schule im Niedersächsischen Schulgesetz
- Ergebnisse empirischer Studien zur politischen Bildung, Wertorientierungen Rechtsextremismus und Gewalt
- Bereitschaft zu politischem und sozialem Engagement
- Akzeptanz und Umsetzung freiheitlich-demokratischer Werte
- Rechtsextremismus und Gewalt
- Ist die Schule selbst Schuld am Nicht-Erreichen ihrer Ziele?
- Ziele von Moralerziehung
- Umsetzung gesetzlicher Vorgaben in praktizierbare Verhaltensnormen
- Moralische Erziehung als Grundlage für beruflichen Erfolg?
- Erhalt der demokratisch-freiheitlichen Gesellschaft
- Entwicklung einer moralischen Persönlichkeit
- Mündigkeit und Autonomie
- Moralerziehung in der Diskussion: Begründungsansätze und Rechtfertigungsproblematiken
- Moralerziehung im Pluralismus. Zur (Un?)-möglichkeit eines Wertekonsens
- Zur Vereinbarkeit staatlicher Neutralität und moralischer Erziehung
- Ist Schule und Unterricht ohne Moralerziehung möglich?
- Moralerziehung – Privileg der Eltern?
- Ist moralische Erziehung eine Überforderung der Schule?
- Chancen der Intervention
- Umsetzung von Moralerziehung in der Schule
- Theoretische Grundlagen der Moralentwicklung
- Ziele und Herausforderungen der Moralerziehung in der Schule
- Begründungsansätze für die Notwendigkeit von Moralerziehung
- Diskussion der Möglichkeiten und Grenzen der Moralerziehung im schulischen Kontext
- Analyse des Einflusses der Schule auf die Entwicklung moralischen Verhaltens
- Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema der Moralentwicklung und die Bedeutung von Moralerziehung ein. Sie zeigt die Relevanz des Themas im aktuellen Kontext und stellt die Fragestellung der Arbeit vor.
- Zum Begriff der Moral und seiner terminologischen Umgebung: Dieses Kapitel erläutert grundlegende Begriffe wie Werte, Normen, Ethik und Moral und verdeutlicht die Bedeutung dieser Begriffe im Kontext der Moralentwicklung.
- Psychologische und empirische Grundlagen: In diesem Kapitel wird die Theorie der moralischen Entwicklung nach Lawrence Kohlberg vorgestellt. Die verschiedenen Stufen der moralischen Entwicklung werden erläutert und die Kritik an Kohlbergs Theorie beleuchtet.
- Vom Urteilen zum Handeln: Dieses Kapitel befasst sich mit der Verbindung zwischen moralischem Denken und Handeln. Es werden wichtige Aspekte wie Verantwortungsurteile, moralische Typen, moralisches Selbst und außermoralische Einflussfaktoren auf das moralische Verhalten betrachtet.
- Erziehungsziele der Schule und Einstellungen und Verhaltensweisen der Jugend: Dieses Kapitel analysiert die Erziehungsziele der Schule und untersucht den Einfluss der Schule auf die Entwicklung von Werten und Einstellungen bei Kindern und Jugendlichen.
- Ziele von Moralerziehung: Dieses Kapitel diskutiert die unterschiedlichen Ziele der Moralerziehung und ihre Relevanz für die gesellschaftliche Entwicklung.
- Moralerziehung in der Diskussion: Begründungsansätze und Rechtfertigungsproblematiken: Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene Begründungsansätze für die Notwendigkeit von Moralerziehung und diskutiert die Herausforderungen und Problematiken in der Umsetzung.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert die Bedeutung von Moralerziehung im Kontext der schulischen Bildung. Ziel ist es, die theoretischen Grundlagen der Moralentwicklung zu beleuchten, die Ziele und Herausforderungen der Moralerziehung in der Schule zu diskutieren und verschiedene Begründungsansätze für deren Notwendigkeit zu untersuchen.
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themen Moralentwicklung, Moralerziehung, Werte, Normen, Kohlbergs Theorie, schulische Bildung, Erziehungsziele, gesellschaftliche Verantwortung, Rechtfertigungsproblematiken und den Einfluss der Schule auf die Entwicklung moralischer Einstellungen und Verhaltensweisen.
Häufig gestellte Fragen
Ist moralische Erziehung in der staatlichen Schule zulässig?
Ja, obwohl der Staat zur weltanschaulichen Neutralität verpflichtet ist, gehört die Vermittlung von Werten und Normen zum verfassungsmäßigen Bildungsauftrag, um das Zusammenleben in einer demokratischen Gesellschaft zu sichern.
Was besagt Kohlbergs Theorie der moralischen Entwicklung?
Lawrence Kohlberg beschreibt ein Stufenmodell, nach dem sich das moralische Urteilsvermögen von Kindern über verschiedene Ebenen – von der Angst vor Strafe bis hin zu universellen ethischen Prinzipien – entwickelt.
Warum führt ein moralisches Urteil nicht immer zu moralischem Handeln?
Zwischen Urteilen und Handeln liegen Faktoren wie Empathie, das moralische Selbstbild und die "moralische Atmosphäre" des Umfelds, die beeinflussen, ob man seinen Werten Taten folgen lässt.
Welche Ziele verfolgt die Moralerziehung in der Schule?
Ziele sind die Entwicklung einer moralischen Persönlichkeit, die Förderung von Mündigkeit und Autonomie sowie der Erhalt einer demokratisch-freiheitlichen Grundordnung.
Stellt Moralerziehung eine Überforderung für Lehrer dar?
Diese Frage wird oft diskutiert. Kritiker sehen die Gefahr einer Überlastung, Befürworter betonen jedoch, dass Unterricht ohne moralische Dimension ohnehin nicht möglich ist.
- Arbeit zitieren
- Nicola Körner (Autor:in), 2005, Moralische Erziehung in der Schule. Begründung, Ansätze, Perspektiven, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/52522