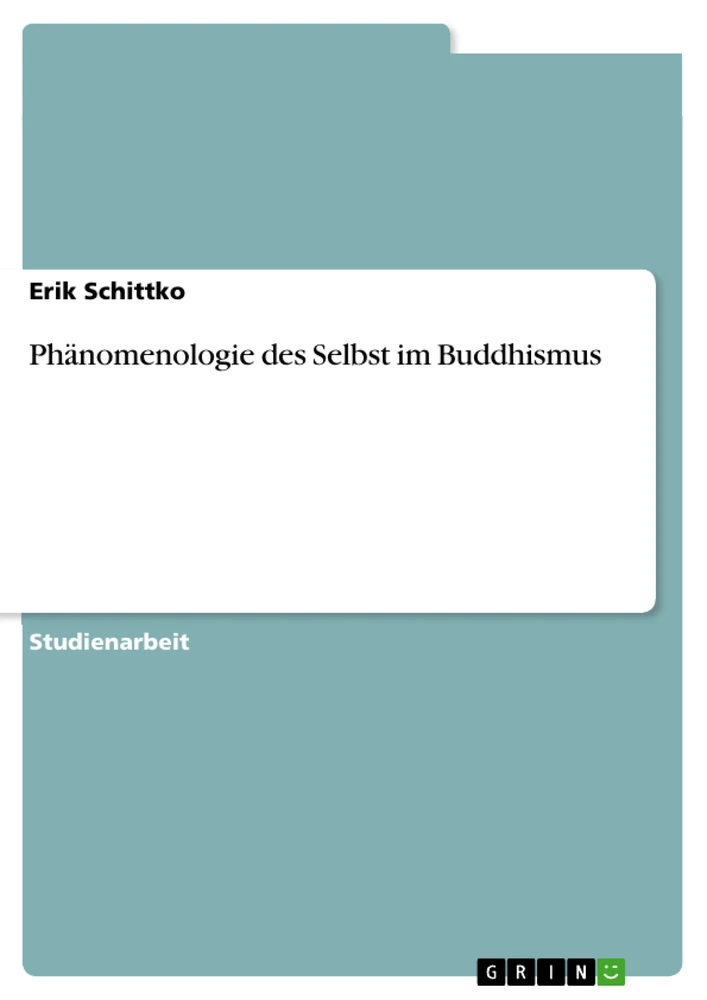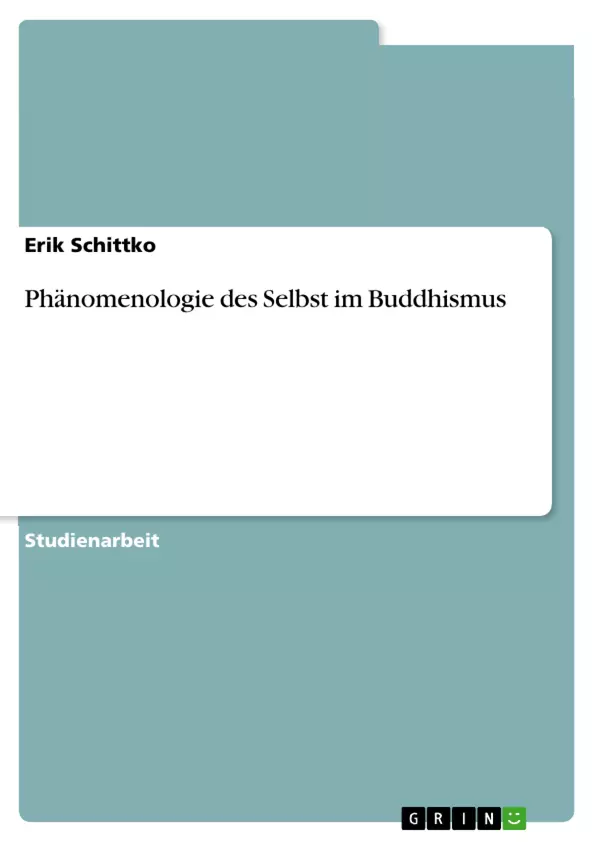Das Ziel der vorliegenden Arbeit besteht darin, zu klären, in welcher Art und Weise innerhalb der buddhistischen Schulen die Negierung des Egos begründet wird. In diesem Kontext erfolgt die Auseinandersetzung mit dem Gleichnis des Wagens, welches die attributive Zusammensetzung von Objekten auf die Individuationsbeschaffenheit von Subjekten überträgt. Darüber hinaus werden hinsichtlich ethischer Konsequenzen der Anatta-Lehre Parallelen zu Philosophen des deutschen Idealismus aufgezeigt. Hierbei steht vor allem die kritische Frage im Fokus, ob die Entsagung der individuellen Wesenhaftigkeit einer Person, totalitäre Kollektivierungsprozesse in verschiedenen buddhistischen Ländern begünstigen konnte.
Der moderne Mensch befindet sich in einem beständigen Prozess der Selbstfindung und Selbstverwirklichung. Nicht nur in zahlreichen Ratgebern, Workshops, Seminaren, Gruppenaktivitäten und Entdeckungsreisen wird mit dem Motiv der Selbsterkenntnis geworben, auch der Werdegang eines Menschen und dessen berufliche Handlungspraxis werden von einem gewissen Maß an Selbstkompetenzen geprägt. Man sollte hierbei seine Talente und Fähigkeiten, Zielvorstellungen, sowie seine Schwachstellen kennen. Schon im Grundschulalter wird das Ziel der individuellen Persönlichkeitsentwicklung stets forciert. Es scheint darüber hinaus essentiell für die alltägliche Interaktion mit anderen Menschen innerhalb der Gesellschaft zu sein, über eine gewisse Selbstreflexion seiner Handlungen und Handlungsmotive, sowie Selbstkenntnis zu verfügen. Zudem besteht ein Leitgedanke der Menschenrechte und Menschenwürde in der Annahme der schützenswerten Natur einer substanziellen Person, die das Recht auf Selbstbestimmung und freie Entfaltung besitzt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Die Nicht-Ich-Lehre im Kontext der Daseinsfaktoren und des Leidens
- 3 Das Gleichnis des Wagens als Partikularisierung der Persönlichkeit
- 4 Altruismus als ethische Konsequenz der Selbstlosigkeit
- 5 Negation des Egos als Basis kollektivistisch-egalitärer Ideologie
- 6 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die buddhistische Anatta-Lehre (Nicht-Ich-Lehre) und deren philosophischen Implikationen. Sie klärt, wie die Negierung des Egos in buddhistischen Schulen begründet wird, beleuchtet das Gleichnis des Wagens und untersucht ethische Konsequenzen der Anatta-Lehre, insbesondere die Frage nach möglichen Verbindungen zu kollektivistisch-egalitären Ideologien.
- Die buddhistische Anatta-Lehre und ihre Kritik an der Vorstellung eines festen Selbst
- Das Gleichnis des Wagens und seine Bedeutung für das Verständnis der Persönlichkeit
- Ethische Konsequenzen der Selbstlosigkeit im Buddhismus
- Der Zusammenhang zwischen Anatta und kollektivistisch-egalitären Ideologien
- Vergleich der buddhistischen Sichtweise mit westlichen Konzepten des Selbst
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Selbstverständnisses ein und stellt den Gegensatz zwischen dem westlichen Streben nach Selbsterkenntnis und der buddhistischen Anatta-Lehre heraus. Sie beschreibt das Ziel der Arbeit: die Klärung der Begründung der Ego-Negierung in buddhistischen Schulen, die Auseinandersetzung mit dem Gleichnis des Wagens und die Untersuchung ethischer Konsequenzen der Anatta-Lehre im Hinblick auf mögliche Verbindungen zu totalitären Kollektivierungsprozessen.
2 Die Nicht-Ich-Lehre im Kontext der Daseinsfaktoren und des Leidens: Dieses Kapitel untersucht die Anātman-Doktrin, die besagt, dass es kein unvergängliches, ewiges, einheitliches und unabhängiges Selbst gibt. Es erklärt das Ich-Konstrukt als zusammengesetzt aus den fünf Daseinsfaktoren (Skandhas), die veränderlich und vergänglich sind und damit leidhafte empirische Persönlichkeit bedingen. Detailliert werden die fünf Skandhas – Körper, Empfindung, Wahrnehmung, Gestaltungsimpulse und Bewusstsein – beschrieben und ihre Vergänglichkeit als Grundlage des Leides erläutert. Der Glaube an ein festes Selbst wird als Irrtum dargestellt, der aus der falschen Interpretation der vergänglichen Skandhas entsteht.
Schlüsselwörter
Anatta, Nicht-Ich-Lehre, Buddhismus, Selbst, Identität, Daseinsfaktoren (Skandhas), Leid, Gleichnis des Wagens, Altruismus, Kollektivismus, Ego, Selbsterkenntnis.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Die buddhistische Nicht-Ich-Lehre (Anatta)
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich mit der buddhistischen Anatta-Lehre (Nicht-Ich-Lehre) und ihren philosophischen Implikationen. Sie untersucht die Begründung der Ego-Negierung in buddhistischen Schulen, das Gleichnis des Wagens und die ethischen Konsequenzen der Anatta-Lehre, insbesondere im Hinblick auf mögliche Verbindungen zu kollektivistisch-egalitären Ideologien.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunktthemen: die buddhistische Anatta-Lehre und ihre Kritik an der Vorstellung eines festen Selbst; das Gleichnis des Wagens und seine Bedeutung für das Verständnis der Persönlichkeit; ethische Konsequenzen der Selbstlosigkeit im Buddhismus; den Zusammenhang zwischen Anatta und kollektivistisch-egalitären Ideologien; und einen Vergleich der buddhistischen Sichtweise mit westlichen Konzepten des Selbst.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in Kapitel gegliedert, beginnend mit einer Einleitung, gefolgt von Kapiteln, die die Nicht-Ich-Lehre im Kontext der Daseinsfaktoren und des Leidens, das Gleichnis des Wagens, Altruismus als ethische Konsequenz der Selbstlosigkeit und die Negation des Egos als Basis kollektivistisch-egalitärer Ideologie behandeln. Sie endet mit einem Fazit.
Was ist die zentrale Aussage der Nicht-Ich-Lehre (Anatta)?
Die Anatta-Doktrin besagt, dass es kein unvergängliches, ewiges, einheitliches und unabhängiges Selbst gibt. Das Ich-Konstrukt wird als zusammengesetzt aus den fünf Daseinsfaktoren (Skandhas) beschrieben, die veränderlich und vergänglich sind und damit leidhafte empirische Persönlichkeit bedingen.
Welche Rolle spielen die fünf Daseinsfaktoren (Skandhas)?
Die fünf Skandhas – Körper, Empfindung, Wahrnehmung, Gestaltungsimpulse und Bewusstsein – sind die Bestandteile des Ich-Konstrukts. Ihre Vergänglichkeit wird als Grundlage des Leides erläutert. Der Glaube an ein festes Selbst entsteht aus der falschen Interpretation dieser vergänglichen Skandhas.
Welche Bedeutung hat das Gleichnis des Wagens?
Das Gleichnis des Wagens wird in der Arbeit verwendet, um das Verständnis der Persönlichkeit zu veranschaulichen und die buddhistische Sichtweise auf das Selbst zu erklären. Es dient als Partikularisierung der Persönlichkeit.
Welche ethischen Konsequenzen werden mit der Anatta-Lehre verbunden?
Die Arbeit untersucht die ethischen Konsequenzen der Selbstlosigkeit im Buddhismus und deren mögliche Verbindungen zu kollektivistisch-egalitären Ideologien, wobei ein Fokus auf Altruismus liegt.
Wie wird die buddhistische Sichtweise mit westlichen Konzepten des Selbst verglichen?
Die Einleitung hebt den Gegensatz zwischen dem westlichen Streben nach Selbsterkenntnis und der buddhistischen Anatta-Lehre hervor. Ein detaillierter Vergleich wird im Text jedoch nicht explizit erwähnt.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Anatta, Nicht-Ich-Lehre, Buddhismus, Selbst, Identität, Daseinsfaktoren (Skandhas), Leid, Gleichnis des Wagens, Altruismus, Kollektivismus, Ego, Selbsterkenntnis.
- Arbeit zitieren
- Erik Schittko (Autor:in), 2019, Phänomenologie des Selbst im Buddhismus, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/520501