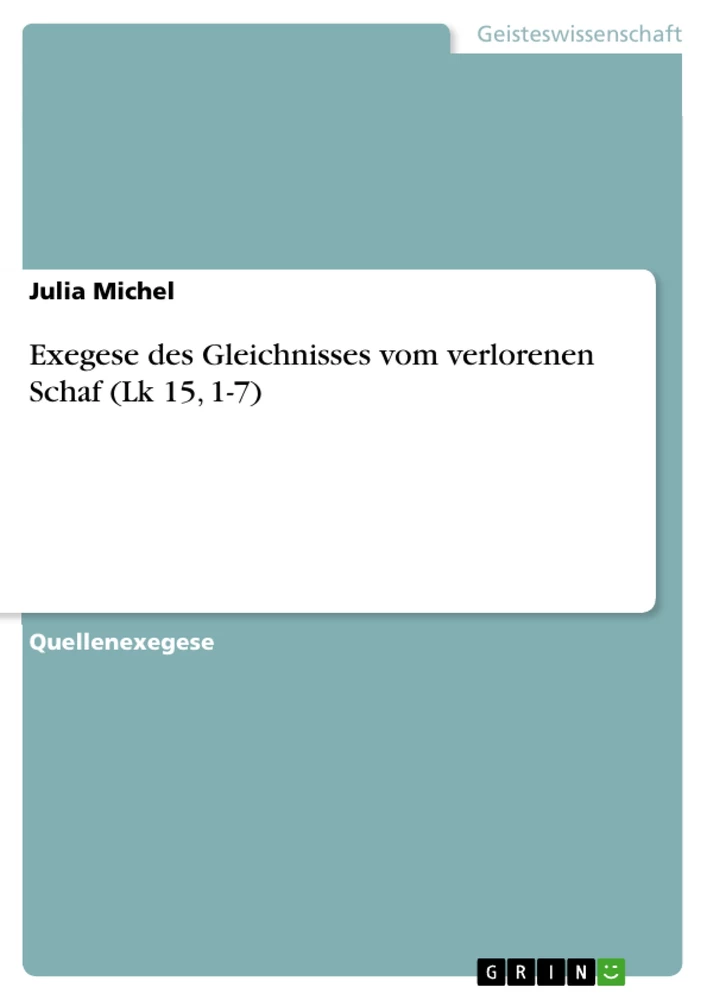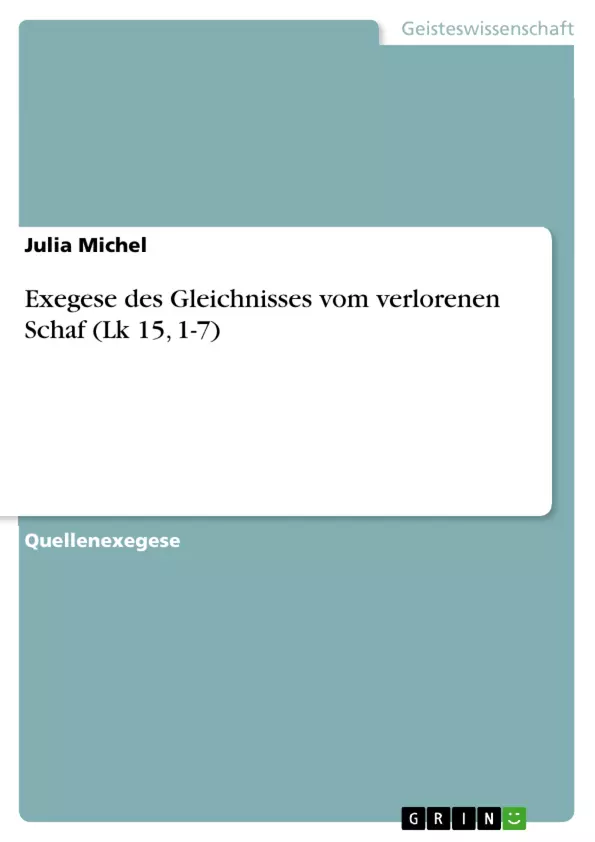In dieser Arbeit wird das Gleichnis „vom verlorenen Schaf“ genauer analysiert. Dieses Gleichnis ist sowohl im Lukasevangelium 15,1-7, als auch im Evangelium nach Matthäus 18,12-13 zu finden. In dem Gleichnis wird von dem Verlust und dem Wiederfinden eines Schafes erzählt.
Wenn man sich den Verlauf der Gleichnisforschung anschaut, findet man viele Definitionen einzelner Theologen, wie die von A. Jülicher, Bultmann oder Jeremias. Zunächst wurden Gleichnisse als Allegorien verstanden. Also mehrere Metaphern, die aneinandergereiht sind und einzeln verstanden werden müssen. A. Jülicher wandte sich jedoch von dieser Theorie ab und erweiterte die Gleichnisforschung vor knapp 100 Jahren mit seiner eigenen Theorie. Er behauptet, man müsse zwischen Gleichnissen im engeren Sinne, Parabeln und Allegorien unterscheiden. Gleichnisse im engeren Sinne sieht er als alltägliche Vorgänge an. Parabeln beschreibt er als außergewöhnliche Vorgänge und Allegorien als metaphorische Deutungen der späteren Tradition. Jülicher sagt, Gleichnisse bestehen immer aus zwei Hälften. Zum einen die Sachhälfte und zum anderen die Bildhälfte, welche durch das „tertium comparationis“ verbunden sind. Diese neue Deutung von A. Jülicher hatte den Grundzug der konstituierten Rätselhaftigkeit dieser Texte verstellt.
Allgemein kann man sagen, dass ein Gleichnis eine Redegattung ist, bei der die bestimmten Aussagen des Textes mit Hilfe eines Bildwortes veranschaulicht werden. Ähnlich wie bei Metaphern. Daher werden sie auch als „entfaltete Metapher“ bezeichnet, die das Bild eines alltäglichen Geschehens verstärkt ausschmücken sollen. Gleichnisse haben als Aufgabe, Erfahrungen und Visionen in Sprache zu bringen, die auf andere Weise schwer auszudrücken sind. Sie tragen außerdem eine Rätselhaftigkeit mit sich, die herausfordert, sich genauer mit der Aussage des Textes zu beschäftigen und sind somit Diskussionsstarter und Handlungsappell zugleich. Selbst die zunächst scheinbar einleuchtenden Texte, sind auf den zweiten Blick eher irritierend. So stellt man sich bei dem Gleichnis „vom verlorenen Schaf“ in Lk 15,1-7 [...].
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Definition Gleichnis
- 3. Form
- 4. Geschichtlicher Kontext
- 5. Textanalyse
- 5.1 Aufbau und Inhalt
- 5.2 Interpretation
- 6. Ezechiel 34, 11-16
- 6.1 Inhaltliche Analyse und Interpretation
- 6.2 Vergleich Lk15, 1-7 und Ez34, 11-16
- 7. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert das Gleichnis vom verlorenen Schaf (Lk 15,1-7) im Hinblick auf seine Definition, Form, den geschichtlichen Kontext und seine theologische Aussage. Dabei wird ein Vergleich mit einem alttestamentlichen Text (Ezechiel 34, 11-16) gezogen.
- Definition und Charakteristika von Gleichnissen
- Formale Analyse des Gleichnisses vom verlorenen Schaf
- Geschichtlicher und theologischer Kontext des Gleichnisses
- Interpretation des Gleichnisses und seiner Aussage
- Vergleich mit dem alttestamentlichen Text Ezechiel 34, 11-16
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt den Fokus der Arbeit auf das Gleichnis vom verlorenen Schaf nach Lukas, inklusive der Begründung für die Nicht-Berücksichtigung der Matthäus-Version. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit, der die Definition von Gleichnissen, die formale Analyse, den Kontext, die Textanalyse und den Vergleich mit Ezechiel 34, 11-16 umfasst. Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach der tieferen Intention und der Form des Gleichnisses nach Lukas und begründet die Auswahl des Lukasevangeliums.
2. Definition Gleichnis: Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene Definitionen von Gleichnissen aus der theologischen Forschung, beginnend mit älteren Auffassungen als Allegorie bis hin zu A. Jülichers differenzierter Betrachtung von Gleichnissen im engeren Sinne, Parabeln und Allegorien. Es wird der Begriff des "tertium comparationis" eingeführt und die konstitutive Rätselhaftigkeit von Gleichnissen hervorgehoben. Das Kapitel betont die Funktion von Gleichnissen als Veranschaulichung mittels Bildworten, als "entfaltete Metapher", die Erfahrungen und Visionen auszudrücken und als Diskussionsstarter und Handlungsappell.
3. Form: Hier wird die Zuordnung des Gleichnisses vom verlorenen Schaf zur Gattung "Gleichnis" anhand seiner formalen Merkmale begründet. Die Dramaturgie der Erzählung, mit der szenischen Gliederung und dem verantwortungslosen Handeln des Hirten, wird als zentrales Merkmal hervorgehoben. Der Bezug zur bekannten Realität, die appellative Frage und die kurze, narrative Form werden als weitere typische Kennzeichen von Gleichnissen identifiziert und im Kontext des untersuchten Textes analysiert. Die Übertragbarkeit der Metapher auf verschiedene Situationen wird als wesentlicher Aspekt der Gleichnisform betont.
4. Geschichtlicher Kontext: Das Kapitel beschreibt den geschichtlichen Kontext, indem der geläufige biblische Bildbereich von Hirte und Schaf im Gleichnis vom verlorenen Schaf betont wird. Es unterstreicht die Bedeutung des Kontextes für die Deutung von Gleichnissen und bietet einen kurzen Überblick über die Rahmenhandlung, um das Verständnis des Gleichnisses zu verbessern. Der Fokus liegt auf der Verortung des Gleichnisses innerhalb des biblischen Bildsprachenkontexts.
5. Textanalyse: Dieses Kapitel beinhaltet die Untersuchung des Aufbaus und Inhalts des Gleichnisses vom verlorenen Schaf sowie seine Interpretation. Es wird die Frage nach Jesu Intention und der Zielgruppe des Appells behandelt. Die Textanalyse bildet den Kern der Arbeit und analysiert sowohl den Aufbau des Gleichnisses als auch seinen Inhalt, um die Aussage Jesu herauszuarbeiten.
6. Ezechiel 34, 11-16: Dieses Kapitel vergleicht das Gleichnis vom verlorenen Schaf mit dem alttestamentlichen Text Ezechiel 34, 11-16, der ebenfalls das Bild vom Hirten und seinen Schafen verwendet. Der Vergleich zielt darauf ab, Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Darstellung und der Aussage der beiden Texte zu beleuchten und das Verständnis des Gleichnisses aus dem Lukasevangelium zu vertiefen. Die inhaltliche Analyse und Interpretation von Ezechiel 34, 11-16 bildet die Grundlage für diesen Vergleich.
Schlüsselwörter
Gleichnis vom verlorenen Schaf, Lukasevangelium, Ezechiel 34, 11-16, Gleichnisforschung, Textanalyse, Interpretation, Hirte, Schaf, alttestamentlicher Kontext, neutestamentlicher Kontext, Form, Dramaturgie, theologische Aussage.
Häufig gestellte Fragen zum Gleichnis vom verlorenen Schaf (Lk 15,1-7)
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert das Gleichnis vom verlorenen Schaf (Lk 15,1-7) umfassend. Sie beinhaltet eine Einleitung, eine Definition von Gleichnissen, eine formale Analyse des Gleichnisses, eine Betrachtung des geschichtlichen Kontextes, eine detaillierte Textanalyse inklusive Interpretation und einen Vergleich mit dem alttestamentlichen Text Ezechiel 34, 11-16. Der Fokus liegt auf der Intention und der Aussage des Gleichnisses im Lukasevangelium und der Begründung für die Auswahl des Lukasevangeliums gegenüber der Matthäusversion.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition und Charakteristika von Gleichnissen, formale Analyse des Gleichnisses vom verlorenen Schaf, geschichtlicher und theologischer Kontext des Gleichnisses, Interpretation des Gleichnisses und seiner Aussage, Vergleich mit dem alttestamentlichen Text Ezechiel 34, 11-16. Es werden verschiedene Definitionen von Gleichnissen aus der theologischen Forschung diskutiert, der Begriff des "tertium comparationis" erläutert und die Funktion von Gleichnissen als Veranschaulichung, Metapher und Handlungsappell hervorgehoben.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit ist in sieben Kapitel gegliedert: Einleitung, Definition Gleichnis, Form, Geschichtlicher Kontext, Textanalyse (Aufbau und Inhalt, Interpretation), Ezechiel 34, 11-16 (inhaltliche Analyse und Interpretation, Vergleich mit Lk 15,1-7), und Fazit. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel detailliert beschrieben.
Welche Forschungsfrage wird gestellt?
Die Arbeit untersucht die tiefere Intention und die Form des Gleichnisses nach Lukas. Es wird die Frage nach Jesu Intention und der Zielgruppe des Appells behandelt.
Warum wird der Text Ezechiel 34, 11-16 herangezogen?
Der alttestamentliche Text Ezechiel 34, 11-16 wird herangezogen, um einen Vergleich mit dem Gleichnis vom verlorenen Schaf zu ermöglichen. Dieser Vergleich soll Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Darstellung und Aussage der beiden Texte beleuchten und das Verständnis des Gleichnisses aus dem Lukasevangelium vertiefen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Gleichnis vom verlorenen Schaf, Lukasevangelium, Ezechiel 34, 11-16, Gleichnisforschung, Textanalyse, Interpretation, Hirte, Schaf, alttestamentlicher Kontext, neutestamentlicher Kontext, Form, Dramaturgie, theologische Aussage.
Welche Definition von Gleichnissen wird verwendet?
Die Arbeit beleuchtet verschiedene Definitionen von Gleichnissen aus der theologischen Forschung, von älteren Auffassungen als Allegorie bis hin zu A. Jülichers differenzierter Betrachtung von Gleichnissen im engeren Sinne, Parabeln und Allegorien. Der Begriff des "tertium comparationis" und die konstitutive Rätselhaftigkeit von Gleichnissen werden hervorgehoben.
Wie wird der geschichtliche Kontext berücksichtigt?
Der geschichtliche Kontext wird durch die Betrachtung des bekannten biblischen Bildbereichs von Hirte und Schaf im Gleichnis vom verlorenen Schaf berücksichtigt. Die Bedeutung des Kontextes für die Deutung von Gleichnissen wird unterstrichen, und es wird ein kurzer Überblick über die Rahmenhandlung gegeben, um das Verständnis des Gleichnisses zu verbessern.
Wie wird die Textanalyse durchgeführt?
Die Textanalyse untersucht den Aufbau und den Inhalt des Gleichnisses vom verlorenen Schaf. Sie analysiert sowohl den Aufbau des Gleichnisses als auch seinen Inhalt, um die Aussage Jesu herauszuarbeiten. Die Dramaturgie der Erzählung mit der szenischen Gliederung und dem verantwortungslosen Handeln des Hirten wird als zentrales Merkmal hervorgehoben.
- Arbeit zitieren
- Julia Michel (Autor:in), 2019, Exegese des Gleichnisses vom verlorenen Schaf (Lk 15, 1-7), München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/515132