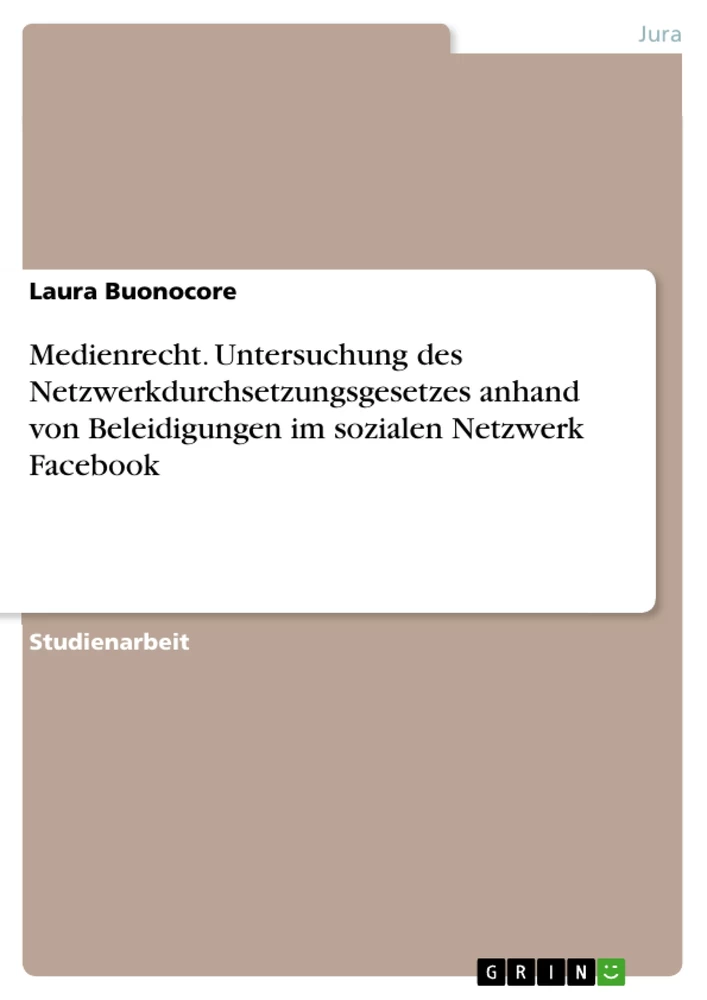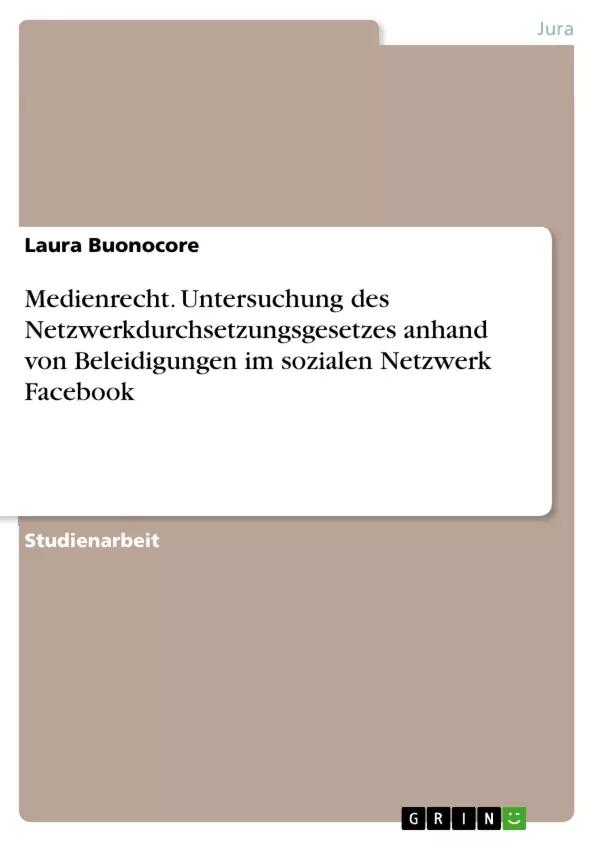Seit der Entstehung von sozialen Netzwerken (SN) hat sich die Massenkommunikation grundlegend verändert. Mittlerweile können Internetnutzer ihre Inhalte weltweit sowie jederzeit teilen oder empfangen. Einige Inhalte sind dabei aggressiv, verletzend oder hasserfüllt. Sie stellen eine große Gefahr für ein friedliches Zusammenleben in einer freien demokratischen Gesellschaft dar.
Die SN-Plattformen stellen zwar Gemeinschaftsrichtlinien auf und bieten Meldefunktionen an, um ihre User vor den rechtswidrigen Beiträgen zu schützen. Dennoch kämpfen die SN mit einem hohen Aufkommen von herabwürdigenden sowie rassistischen Inhalten. Diese strafbaren Posts oder Kommentare werden von Unternehmen nicht sehr transparent bearbeitet. Für Außenstehende ist es oft nicht ersichtlich, aus welchem Grund Beiträge gelöscht werden und sie können daher kaum gegen Falschmeldungen, Hass oder Hetze vorgehen.
Auch die deutsche Politik hat die Diskriminierung gegen Andersdenkende sowie die Beleidigungen und Falschmeldungen erkannt. Mittlerweile gelten diese rechtswidrigen Inhalte als fester Bestandteil auf SN. Um dem entgegenzuwirken, sollen strafbare Beiträge auf Plattformen schneller und umfassender gelöscht werden. Seit dem 1. Oktober 2017 gilt aufgrund dessen in Deutschland das „Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken“, auch Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) oder Facebook-Gesetz genannt.
Durch das NetzDG sind Anbieter von SN verpflichtet, gemeldete Inhalte auf deren Rechtswidrigkeit zu prüfen und gegebenenfalls unverzüglich zu entfernen. Ansonsten besteht das Risiko, ein hohes Bußgeld zahlen zu müssen. Um dies zu vermeiden, werden Unternehmen höchstwahrscheinlich Inhalte vorsichtshalber löschen und sich somit gegen die Meinungsäußerungsfreiheit entscheiden. Kritiker warnen daher vor erheblichen Folgen.
Die Projektarbeit soll das NetzDG am Beispiel von Beleidigungen im SN Facebook un-tersuchen. Dafür wird zunächst bestimmt, was unter einer Beleidigung sowie Kollektivbeleidigung zu verstehen ist. Zudem werden kriminelle Äußerungen im Internet unter-sucht. Im Anschluss wird das NetzDG definiert und die Gründe für die Entstehung des Gesetztes untersucht. Im vierten Kapitel wird das Grundrecht der Meinungsfreiheit beschrieben. Die Entscheidungshoheit der SN und der Schutz vor Löschung zulässiger Kommentare wird im Anschluss erläutert. Danach werden die unterschiedlichen Folgen des NetzDG am Beispiel von Facebook und der Justiz untersucht. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einführung
- 2 Beleidigung
- 2.1 Bestimmtheit einer Beleidigung
- 2.2 Kollektivbeleidigung
- 2.3 Kriminelle Äußerungen im Internet
- 3 Netzwerkdurchsetzungsgesetz
- 3.1 Entstehung des Gesetzes
- 4 Grundrecht auf freie Meinungsäußerung
- 4.1 Entscheidungshoheit der Netzwerke
- 4.2 Löschung zulässiger Kommentare
- 5 Folgen des Netzwerkdurchsetzungsgesetz
- 5.1 Überforderter Netzwerkbetreiber Facebook
- 5.1.1 Transparenzberichte von Facebook
- 5.2 Überforderte Gerichtswesen
- 5.1 Überforderter Netzwerkbetreiber Facebook
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) anhand von Beleidigungen auf der Plattform Facebook. Ziel ist es, den Tatbestand der Beleidigung im Kontext des Internets zu definieren, die Entstehung und die Auswirkungen des NetzDG zu analysieren und dessen Folgen für Netzwerkbetreiber und die Justiz zu beleuchten. Die Arbeit berücksichtigt dabei das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung.
- Definition und Abgrenzung von Beleidigung im digitalen Raum
- Entstehung und rechtliche Grundlagen des NetzDG
- Auswirkungen des NetzDG auf die Meinungsfreiheit
- Folgen des NetzDG für Facebook als Netzwerkbetreiber
- Belastung der Justiz durch das NetzDG
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einführung: Die Einführung beschreibt die Veränderungen der Massenkommunikation durch soziale Netzwerke und die Herausforderungen, die durch aggressive, verletzende oder hasserfüllte Inhalte entstehen. Sie führt das Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) ein und benennt die Ziele der Arbeit, die darin bestehen, das NetzDG anhand von Beleidigungen auf Facebook zu untersuchen, den Tatbestand der Beleidigung zu definieren und die Folgen des Gesetzes für Netzwerkbetreiber und die Justiz zu analysieren. Die Arbeit betont die Relevanz des Themas im Kontext der Meinungsfreiheit.
2 Beleidigung: Dieses Kapitel definiert den juristischen Tatbestand der Beleidigung gemäß § 185 Strafgesetzbuch. Es wird diskutiert, ob die Definition des Tatbestandes im Strafgesetzbuch ausreichend bestimmt ist und ob sie den Anforderungen des Artikels 103 Absatz 2 Grundgesetz genügt. Das Kapitel beleuchtet die Unschärfe der Definition und die daraus resultierenden Herausforderungen für die Anwendung des Gesetzes in der Praxis, insbesondere im Kontext von sozialen Netzwerken. Es wird der Konflikt zwischen dem Schutz der Ehre und der Meinungsfreiheit thematisiert.
3 Netzwerkdurchsetzungsgesetz: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) selbst. Es beleuchtet die Entstehungsgeschichte des Gesetzes und die Gründe für seine Einführung. Das Kapitel erläutert die Pflichten von sozialen Netzwerken bezüglich der Prüfung und Löschung rechtswidriger Inhalte und die damit verbundenen Bußgelder. Es stellt die verschiedenen Perspektiven auf das Gesetz dar, einschließlich der Kritik an den potentiellen Eingriffen in die Meinungsfreiheit.
4 Grundrecht auf freie Meinungsäußerung: Dieses Kapitel behandelt das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung im Kontext des NetzDG. Es analysiert den Konflikt zwischen dem Schutz der Ehre und dem Recht auf freie Meinungsäußerung im digitalen Raum. Das Kapitel diskutiert die Entscheidungshoheit der sozialen Netzwerke bei der Löschung von Inhalten und die Frage, wie der Schutz vor der Löschung zulässiger Kommentare gewährleistet werden kann. Die Problematik der Abwägung zwischen den verschiedenen Grundrechten steht im Mittelpunkt.
5 Folgen des Netzwerkdurchsetzungsgesetz: Dieses Kapitel untersucht die Folgen des NetzDG, insbesondere am Beispiel von Facebook und der Justiz. Es analysiert die Herausforderungen für Facebook als Netzwerkbetreiber und die damit verbundenen Schwierigkeiten bei der Umsetzung des Gesetzes. Zusätzlich werden die Auswirkungen auf die Justiz beleuchtet, einschließlich der Frage, ob die Gerichte mit der Bearbeitung der zahlreichen Fälle überfordert sind. Die Kapitel analysiert die Transparenzberichte von Facebook als ein Beispiel der praktischen Umsetzung des NetzDG.
Schlüsselwörter
Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG), Beleidigung, Meinungsfreiheit, soziale Netzwerke, Facebook, Rechtsdurchsetzung, Internet, Hassrede, Zensur, Grundrechte, Justiz, Transparenz.
Häufig gestellte Fragen zum Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) - Eine Analyse anhand von Beleidigungen auf Facebook
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert das Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) anhand von Beleidigungen auf der Plattform Facebook. Sie untersucht den Tatbestand der Beleidigung im Internet, die Entstehung und Auswirkungen des NetzDG und dessen Folgen für Netzwerkbetreiber und die Justiz unter Berücksichtigung des Grundrechts auf freie Meinungsäußerung.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Definition und Abgrenzung von Beleidigung im digitalen Raum, Entstehung und rechtliche Grundlagen des NetzDG, Auswirkungen des NetzDG auf die Meinungsfreiheit, Folgen des NetzDG für Facebook als Netzwerkbetreiber und die Belastung der Justiz durch das NetzDG.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Kapitel 1 bietet eine Einführung in das Thema. Kapitel 2 definiert den juristischen Tatbestand der Beleidigung. Kapitel 3 befasst sich mit dem NetzDG selbst, seiner Entstehung und den Pflichten der Netzwerke. Kapitel 4 behandelt das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung im Kontext des NetzDG. Kapitel 5 analysiert die Folgen des NetzDG für Facebook und die Justiz, inklusive der Analyse von Transparenzberichten von Facebook.
Was ist die Definition von Beleidigung im Kontext dieser Arbeit?
Kapitel 2 definiert den juristischen Tatbestand der Beleidigung gemäß § 185 Strafgesetzbuch und diskutiert dessen Bestimmtheit und die Anforderungen des Artikels 103 Absatz 2 Grundgesetz. Es beleuchtet die Unschärfe der Definition und die daraus resultierenden Herausforderungen für die Anwendung im Kontext sozialer Netzwerke, insbesondere den Konflikt zwischen dem Schutz der Ehre und der Meinungsfreiheit.
Welche Rolle spielt das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung?
Kapitel 4 analysiert den Konflikt zwischen dem Schutz der Ehre und dem Recht auf freie Meinungsäußerung im digitalen Raum im Kontext des NetzDG. Es diskutiert die Entscheidungshoheit der sozialen Netzwerke bei der Löschung von Inhalten und den Schutz vor der Löschung zulässiger Kommentare, sowie die Abwägung der verschiedenen Grundrechte.
Welche Folgen des NetzDG werden untersucht?
Kapitel 5 untersucht die Folgen des NetzDG für Facebook als Netzwerkbetreiber und die Justiz. Es analysiert die Herausforderungen für Facebook bei der Umsetzung des Gesetzes und die Belastung der Gerichte. Die Analyse der Transparenzberichte von Facebook dient als Beispiel für die praktische Umsetzung des NetzDG.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG), Beleidigung, Meinungsfreiheit, soziale Netzwerke, Facebook, Rechtsdurchsetzung, Internet, Hassrede, Zensur, Grundrechte, Justiz, Transparenz.
Welche konkreten Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die konkreten Schlussfolgerungen lassen sich aus der Zusammenfassung der Kapitel und der Zielsetzung entnehmen. Die Arbeit analysiert die Herausforderungen der Durchsetzung des NetzDG, den Konflikt zwischen Meinungsfreiheit und dem Schutz der Ehre im digitalen Raum, sowie die Belastungen für Netzwerkbetreiber und Justiz. Die detaillierten Schlussfolgerungen sind im Text selbst zu finden.
- Quote paper
- Laura Buonocore (Author), 2019, Medienrecht. Untersuchung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes anhand von Beleidigungen im sozialen Netzwerk Facebook, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/513560