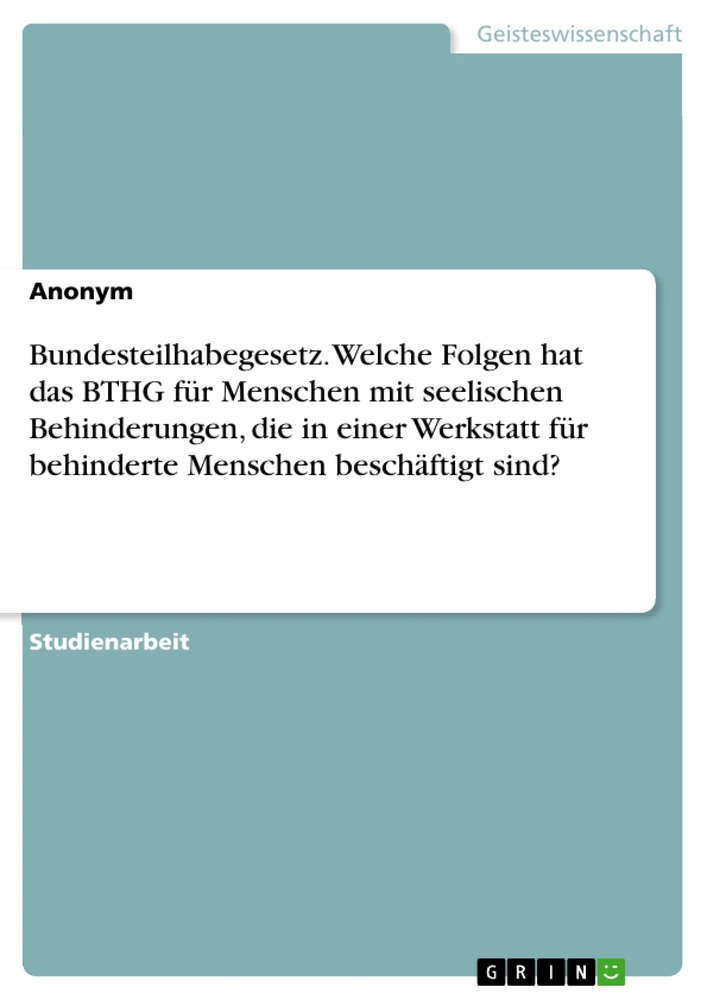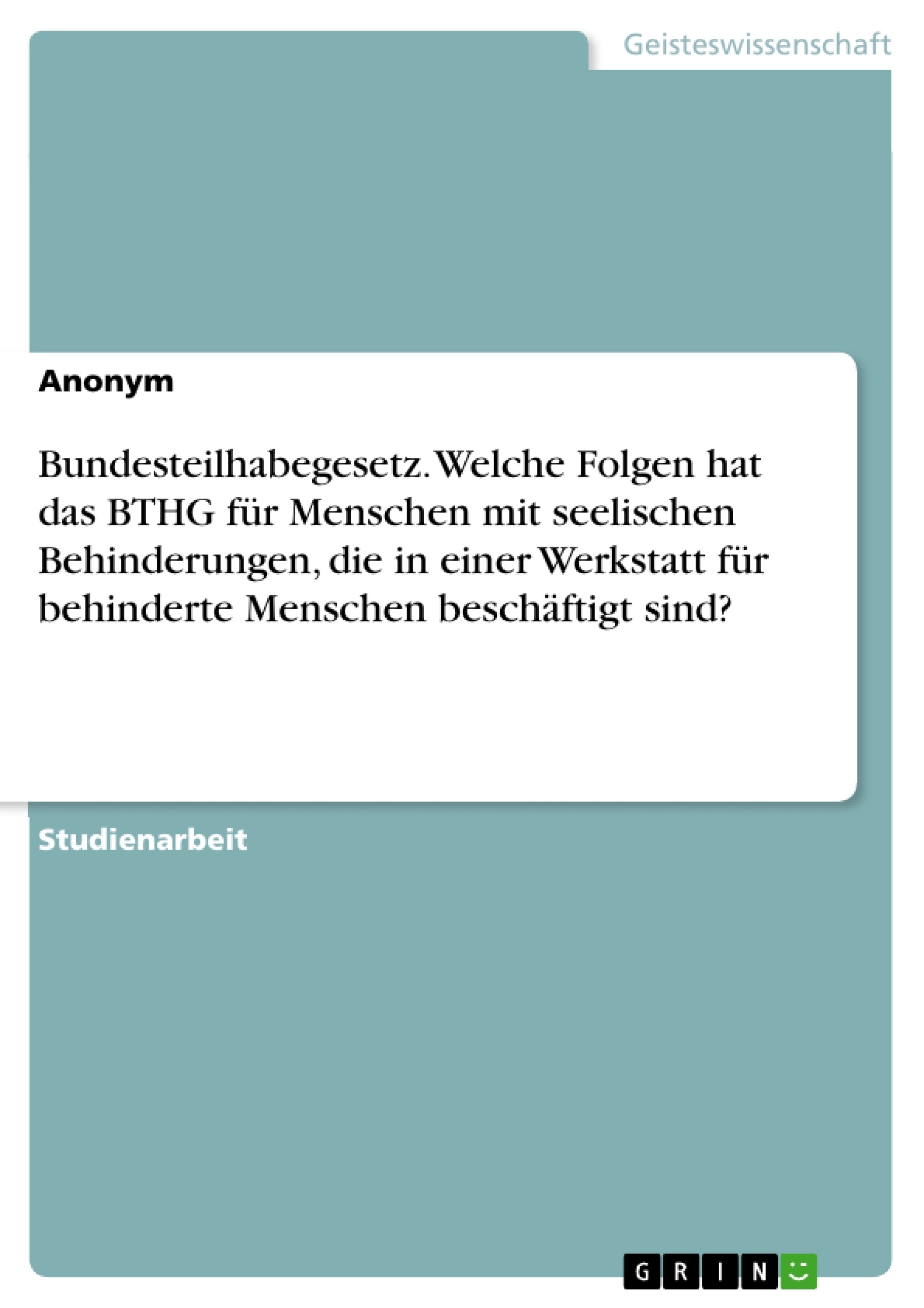Die Hausarbeit befasst sich thematisch mit dem Bundesteilhabegesetz. Beschrieben wird die Entstehung und die Bedeutung für das deutsche Rechtssystem. Insbesondere hervorgehoben wird die Bedeutung für Werkstätten für Menschen mit Behinderungen und speziell für Menschen mit seelischen Behinderungen.
Um nachzuvollziehen, warum und inwiefern die Veränderungen des BTHG's eine WfbM für seelisch Behinderte Menschen betreffen, ist es notwendig, die rechtlichen Hintergründe zu kennen, auf die die Arbeit einer WfbM sich stützt. Hierbei ist es wichtig die rechtliche Legitimation und die Vorgaben für eine WfbM durch das SGB IX zu kennen. Zudem ist eine Auseinandersetzung mit dem SGB XII erforderlich, da die Leistungen dieses Gesetzbuches vielen Beschäftigten den Lebensunterhalt sichert und ihnen darüber hinaus die soziale Teilhabe ermöglichen sowie ein selbstbestimmtes Leben fördern sollen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Rechtliche Hintergründe
- 2.1 Recht auf Rehabilitation und Teilhabe (SGB IX)
- 2.2 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen SGB XII
- 3. Behinderungsbegriff
- 4. Konzept einer WfbM
- 4.1 Aufgaben einer WfbM
- 4.2 Aufbau und Organisation einer WfbM (SGB IX, WVO)
- 5. Bundesteilhabegesetz (BTHG)
- 5.1 Historie
- 5.2 Umsetzung
- 5.3 Teilhabeverfahren/Gesamtplanverfahren
- 5.4 Bedarfsermittlung
- 5.5 Alternativen zur WfbM
- 5.5.1 Andere Leistungsanbieter
- 5.5.2 Budget für Arbeit
- 6. UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK)
- 6.1 Inklusion
- 7. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den Auswirkungen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) auf die Arbeit in Werkstätten für Menschen mit seelischen Behinderungen (WfbM). Die Untersuchung befasst sich mit möglichen strukturellen Veränderungen in den Werkstätten und den direkten Auswirkungen auf das Leben der Beschäftigten.
- Rechtliche Grundlagen des BTHG und seine Relevanz für WfbM
- Wandel des Behinderungsbegriffs im Kontext des BTHG
- Konzept und Aufgaben von WfbM im Hinblick auf das BTHG
- Einfluss des BTHG auf die Arbeitsbedingungen und Teilhabe von Beschäftigten in WfbM
- Bedeutung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) für die Inklusion und das BTHG
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und erläutert die Relevanz des BTHG für die Arbeit in WfbM. Anschließend werden die rechtlichen Grundlagen des SGB IX und SGB XII betrachtet, die die Arbeit einer WfbM betreffen. Das Kapitel 3 beleuchtet den sich wandelnden Behinderungsbegriff, bevor Kapitel 4 das Konzept und die Aufgaben einer WfbM näher beschreibt. Im fünften Kapitel wird das BTHG ausführlich behandelt, einschließlich seiner Historie, Umsetzung, und Auswirkungen auf die Arbeit in WfbM für Menschen mit seelischen Behinderungen. Schließlich werden die wichtigsten Aspekte der UN-Behindertenrechtskonvention und ihre Bedeutung für die Inklusion im Zusammenhang mit dem BTHG erläutert.
Schlüsselwörter
Bundesteilhabegesetz (BTHG), Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM), seelische Behinderung, Inklusion, Teilhabe, Rehabilitation, UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK), SGB IX, SGB XII.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2018, Bundesteilhabegesetz. Welche Folgen hat das BTHG für Menschen mit seelischen Behinderungen, die in einer Werkstatt für behinderte Menschen beschäftigt sind?, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/512205