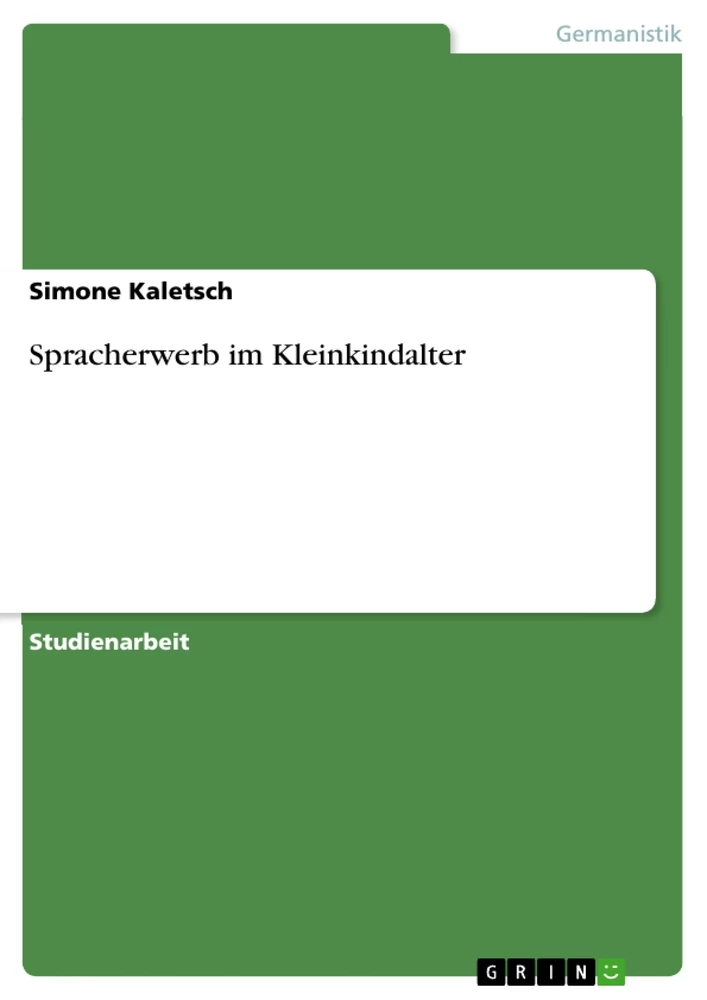Wenn man sich mit dem Spracherwerb beim Kleinkind auseinandersetzt, so stellt man fest, dass es sich dabei um einen sehr komplexen Themenbereich handelt. Die Arbeit befasst sich mit relevanten Punkten des Spracherwerbs beim Kleinkind. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf den verschiedenen Spracherwerbsstilen. Nach einem einem theoretischen Teil, wird am Beispiel eines kleinen Jungen versucht, die Theorie in der Praxis zu überprüfen.
Zu Beginn ist es wichtig, erst einmal zu klären, was Sprache überhaupt ist. Danach wird sich mit dem Verlauf und den Theorien des Spracherwerbs befasst. Nach einer Einführung, die nur kurz den Zeitpunkt des Spracherwerbs darstellt, kommen die verschiedenen Theorien der Spracherwerbsforschung zur Sprache. An die Erläuterung der verschiedenen Ansätze schließt sich dann ein Kapitel über die Phasen des Spracherwerbs an. In diesem Teil tauchen dann noch einmal etwas ausführlicher die relevanten zeitlichen Abläufe auf. Während sich die Theorien und die Phasen des Spracherwerbs mit Aspekten befassen, die bei allen Kindern gleich sind, liegt bei der Erforschung von Spracherwerbsstilen der Schwerpunkt auf den Unterschieden zwischen individuellen Kindern. Dieses Thema wird als Abschluss für das zweite Kapitel gewählt. Die Existenz einer an das Kind gerichtete Sprache kommt im letzten Kapitel zur Darstellung.
Im zweiten Teil der Arbeit sind noch einmal die Spracherwerbsstile thematisiert. Es wird ein kleiner Junge beobachtet, um herauszufinden, ob er auf solche verschiedenen Strategien zurückgreift. Anschließend finden sich einige Anmerkungen sowie das Literaturverzeichnis.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Teil I: Theorien zum Spracherwerbsprozess
- Was ist Sprache?
- Verlauf und Theorien des Spracherwerbs
- Zeitpunkt des Spracherwerbs
- Positionen in der Spracherwerbstheorie
- Nativistischer Ansatz
- Lerntheoretischer Ansatz
- Kognitivistischer Ansatz
- Interaktionistischer Ansatz
- Phasen des Spracherwerbs
- Vorstufen des Spracherwerbs
- Einwortäußerungen und erste Wortkombinationen
- Ausbau des Systems: die Drei- und Mehrwortphase
- Spracherwerbsstile
- Die an das Kind gerichtete Sprache (KGS)
- Teil II: Angewandte Theorie
- Beobachtungen zu Spracherwerbsstilen
- Anmerkungen
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem komplexen Thema des Spracherwerbs im Kleinkindalter. Sie konzentriert sich auf die theoretischen Grundlagen des Spracherwerbsprozesses und untersucht die verschiedenen Theorien, Phasen und Stile, die diesen Prozess prägen. Darüber hinaus werden praktische Beobachtungen zu Spracherwerbsstilen analysiert.
- Definition von Sprache und ihre Funktionen
- Verschiedene Theorien des Spracherwerbs (nativistisch, lerntheoretisch, kognitivistisch, interaktionistisch)
- Phasen des Spracherwerbs (Vorstufen, Einwortphase, Mehrwortphase)
- Spracherwerbsstile und ihre Auswirkungen auf den Sprachentwicklungsprozess
- Die Rolle der an das Kind gerichteten Sprache (KGS)
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Thematik des Spracherwerbs im Kleinkindalter vor und erläutert die Struktur der Arbeit. Sie betont die Komplexität des Themas und die Notwendigkeit, sowohl theoretische als auch praktische Aspekte zu beleuchten.
Was ist Sprache?
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Definition von Sprache und analysiert die verschiedenen Aspekte, die diesen Begriff prägen. Es betrachtet Sprache als eine komplexe Fähigkeit, die sich sowohl nach ihrer Beschaffenheit (Struktur) als auch nach ihrer Funktion (Kommunikation) definieren lässt.
Verlauf und Theorien des Spracherwerbs
Dieses Kapitel befasst sich mit dem Verlauf des Spracherwerbsprozesses und den verschiedenen Theorien, die diesen Prozess zu erklären versuchen. Es stellt die verschiedenen Ansätze (nativistisch, lerntheoretisch, kognitivistisch, interaktionistisch) vor und diskutiert ihre Stärken und Schwächen.
Phasen des Spracherwerbs
Dieses Kapitel erläutert die verschiedenen Phasen des Spracherwerbs, angefangen von den Vorstufen bis hin zur Drei- und Mehrwortphase. Es analysiert die spezifischen Merkmale jeder Phase und zeigt die Fortschritte, die Kinder in ihrer Sprachentwicklung machen.
Spracherwerbsstile
Dieses Kapitel befasst sich mit den verschiedenen Spracherwerbsstilen, die bei Kindern beobachtet werden können. Es stellt die unterschiedlichen Strategien und Ansätze vor, die Kinder beim Erlernen der Sprache anwenden.
Die an das Kind gerichtete Sprache (KGS)
Dieses Kapitel beleuchtet die Bedeutung der an das Kind gerichteten Sprache (KGS) für den Spracherwerbsprozess. Es analysiert die Besonderheiten dieser Sprachform und ihre Auswirkungen auf die Entwicklung des Kindes.
Schlüsselwörter
Spracherwerb, Kleinkindalter, Theorien, Nativismus, Lerntheorie, Kognitivismus, Interaktionismus, Phasen, Spracherwerbsstile, an das Kind gerichtete Sprache, KGS.
- Quote paper
- Simone Kaletsch (Author), 2001, Spracherwerb im Kleinkindalter, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/51154