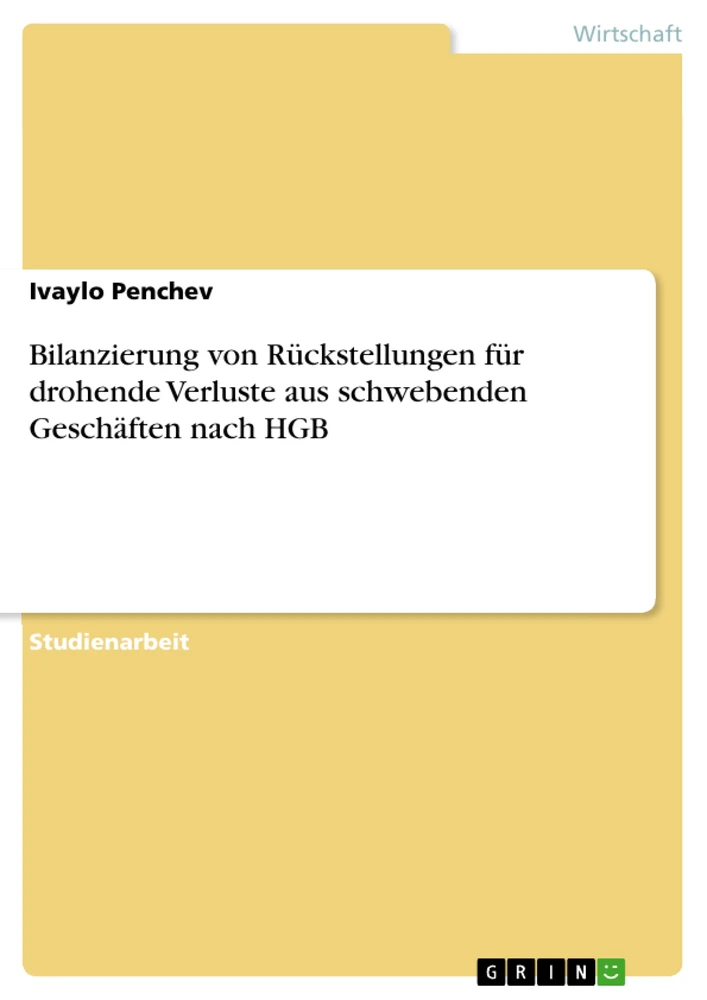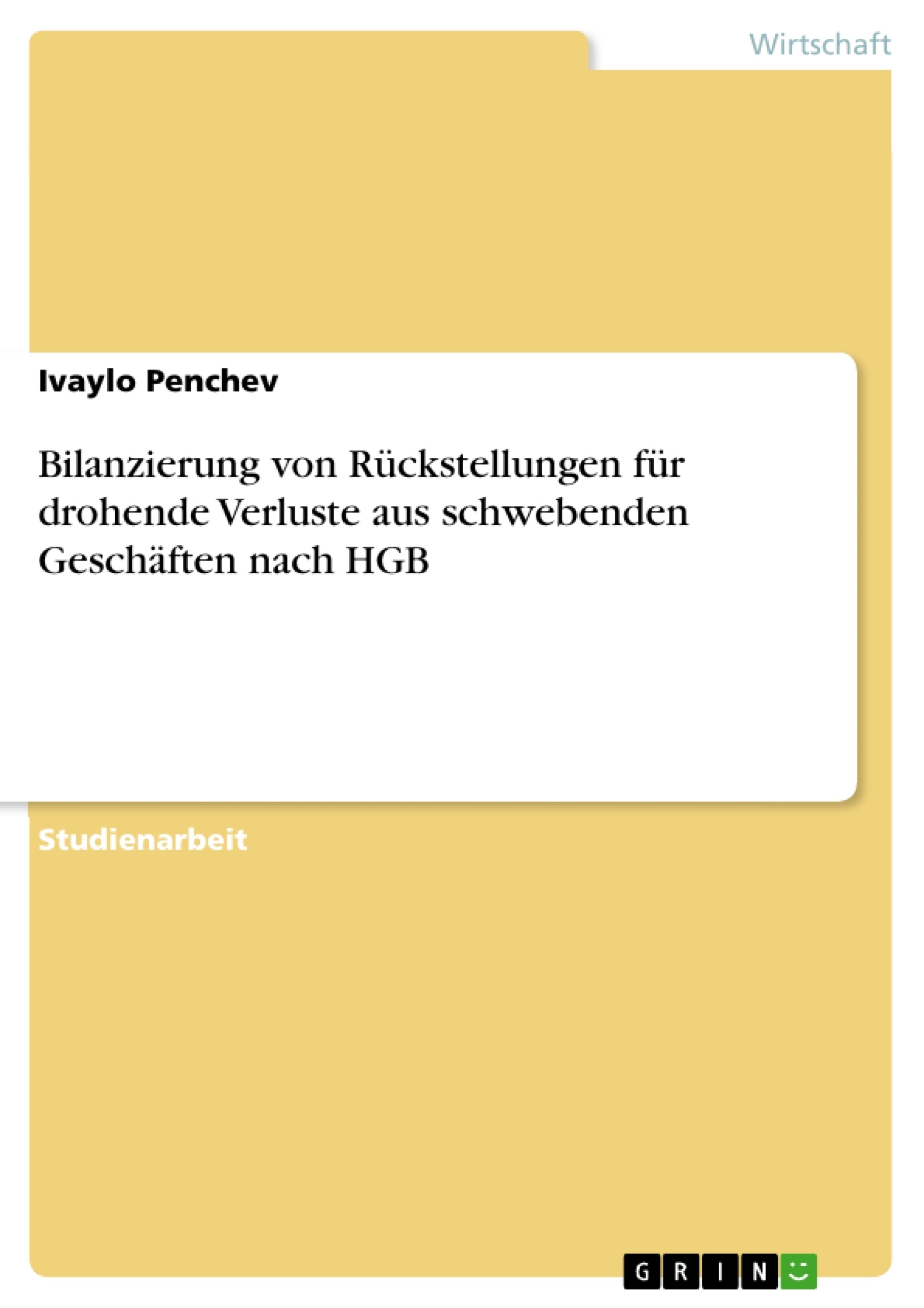Diese Arbeit thematisiert die Bilanzierung von Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften nach HGB. Rückstellungen sind ein in der Literatur oft diskutierter Bilanzposten. Keine andere Position in der Bilanz unterliegt größeren Unsicherheiten und daraus resultierenden bilanzpolitischen Spielräumen. Schon der Begriff "Rückstellungen" ist ein Ausgangspunkt für Diskussionen, da er im Gesetz nicht eindeutig definiert ist. Im § 249 HGB steht nun zu lesen, für welche Rückstellungen Passivierungspflicht besteht.
Die Rückstellungen sind Passivposten für künftige Verpflichtungen. Im Gegensatz zu den Verbindlichkeiten, wo Verpflichtungsgrund und Höhe der Schuld bekannt sind, sind die Rückstellungen durch ihre Unsicherheit gekennzeichnet. Dies bedeutet, dass ihr Bestehen, die Höhe der Verpflichtung und der Fälligkeitszeitpunkt nicht sicher feststehen. Rückstellungen sind auch sehr effektive Bilanzierungsinstrumente. Durch sie können nachträgliche Ausgaben vollständig erfasst, gebuchte Erträge nachträglich korrigiert oder ungewisse Verbindlichkeiten passiviert werden. Es ist der Zweck der Rückstellungen, auch solche Verbindlichkeiten zu berücksichtigen, die rechtlich erst in der Zukunft entstehen, jedoch bereits in einem vergangenen Wirtschaftsjahr verursacht worden sind. Diese besondere Art von Verpflichtungen stellen die Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften dar. Zum ersten Mal wurden die Drohverlustrückstellung im § 152 Abs. 7 S.1 AktG im Jahr 1965 definiert. Mitte der 90er Jahre standen diese im Mittelpunkt der bilanzpolitischen Diskussionen, da im Jahr 1997 das steuerliche Ansatzverbot von Drohverlustrückstellungen gemäß § 5 Abs.4 EstG eingeführt wurde
Inhaltsverzeichnis
- Problemstellung
- Sinn und Zweck des Jahresabschlusses
- Grundsatz der Nichtbilanzierung von schwebenden Geschäften
- Verlustdefinition
- Einzelfälle von Drohverlustrückstellungen
- Wann entstehen Drohverlustrückstellungen und Kategorien des schwebenden Geschäfts
- Einmaliger Leistungsaustausch
- Beschaffungsgeschäfte
- Anlagevermögen
- Umlaufvermögen
- Absatzgeschäfte
- Beschaffungsgeschäfte
- Dauerschuldverhältnisse
- Grundsatz der Bilanzierung von Drohverlustrückstellung bei Dauerschuldverhältnissen
- Bewertung und Abzinsung
- Saldierungsbereich
- Thesenförmige Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit zielt darauf ab, das Verständnis der Bilanzierung von Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften nach HGB zu verbessern und anhand von Beispielen zu veranschaulichen. Die Arbeit beleuchtet die komplexen Aspekte der Bilanzierung solcher Rückstellungen im Kontext des Handelsgesetzbuches.
- Definition und Voraussetzungen für die Bildung von Drohverlustrückstellungen
- Unterscheidung zwischen schwebenden Geschäften und dem Grundsatz der Nichtbilanzierung
- Analyse von Einzelfällen im Kontext von Beschaffungs- und Absatzgeschäften
- Behandlung von Dauerschuldverhältnissen und deren Besonderheiten
- Der Saldierungsbereich und die Berücksichtigung wirtschaftlicher Vorteile
Zusammenfassung der Kapitel
1. Problemstellung: Das Kapitel beleuchtet die Unsicherheiten und bilanzpolitischen Spielräume im Zusammenhang mit Rückstellungen, insbesondere bei Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften. Es betont die fehlende eindeutige Definition des Begriffs „Rückstellungen“ im Gesetz und führt in die Thematik ein.
2. Sinn und Zweck des Jahresabschlusses: Dieses Kapitel beschreibt die strengen Rechnungslegungs- und Offenlegungspflichten von Kapital- und Personengesellschaften. Es differenziert die Größenklassen von Kapitalgesellschaften gemäß § 267 HGB und erklärt die Pflicht zur Jahresabschlussprüfung. Der Fokus liegt auf den Informations- und Zahlungsbemessungszwecken des Jahresabschlusses, der die Grundlage für entscheidungsrelevante Informationen und die Besteuerung bildet.
3. Grundsatz der Nichtbilanzierung von schwebenden Geschäften: Hier wird der Grundsatz der Nichtbilanzierung von schwebenden Geschäften erläutert. Es werden die Merkmale schwebender Geschäfte definiert, die Ausgeglichenheitsvermutung dargelegt, und die Bedingungen für die Ausnahme von diesem Grundsatz bei einem Verpflichtungsüberschuss beschrieben. Der Schwebezustand und sein Ende werden detailliert erklärt.
4. Verlustdefinition: Dieses Kapitel definiert die zweite Voraussetzung für die Bilanzierung von Drohverlustrückstellungen: das drohende Verlustrisiko. Es unterscheidet zwischen theoretischer Verlustmöglichkeit und dem tatsächlichen Drohen eines Verlustes, der auf konkreten Anzeichen und vorhersehbaren Verpflichtungsüberschüssen beruht. Das Imparitätsprinzip und die erfolgswirksame Behandlung antizipierter Verluste werden diskutiert.
5. Einzelfälle von Drohverlustrückstellungen: Dieses Kapitel untersucht verschiedene Szenarien, in denen Drohverlustrückstellungen relevant werden. Es differenziert zwischen einmaligem und wiederholtem Leistungsaustausch (Beschaffungs- und Absatzgeschäfte) sowie Anlage- und Umlaufvermögen. Es präsentiert detaillierte Beispiele und erläutert die spezifischen Kriterien für die Rückstellungsbildung in diesen Fällen, einschließlich der Berücksichtigung von Wertminderungen und Marktpreisen.
6. Saldierungsbereich: Das Kapitel konzentriert sich auf den Saldierungsbereich bei der Ermittlung des rückstellungsfähigen Verpflichtungsüberschusses. Es erläutert die Berücksichtigung wechselseitiger Leistungen und wirtschaftlicher Vorteile, die im Zusammenhang mit dem Vertrag stehen, einschließlich des Beispiels des BFH-Urteils im Apothekerfall. Die Bedeutung des Kausalitätszusammenhangs für die Berücksichtigung von Vorteilen wird hervorgehoben. Hoffnungen und vage Erwartungen werden als nicht berücksichtigungsfähig kategorisiert.
Schlüsselwörter
Rückstellungen, Drohverlustrückstellungen, schwebendes Geschäft, HGB, Bilanzierung, Verpflichtungsüberschuss, Ausgeglichenheitsvermutung, Imparitätsprinzip, Beschaffungsgeschäft, Absatzgeschäft, Dauerschuldverhältnis, Bewertung, Abzinsung, Saldierungsbereich, wirtschaftliche Vorteile, Kausalität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Bilanzierung von Drohverlustrückstellungen aus schwebenden Geschäften nach HGB
Was ist der Gegenstand dieses Textes?
Der Text befasst sich umfassend mit der Bilanzierung von Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften nach dem Handelsgesetzbuch (HGB). Er erklärt die relevanten Grundsätze, unterscheidet verschiedene Szenarien und bietet detaillierte Beispiele zur Veranschaulichung.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Der Text behandelt unter anderem die Problemstellung der Bilanzierung von Drohverlustrückstellungen, den Sinn und Zweck des Jahresabschlusses, den Grundsatz der Nichtbilanzierung schwebender Geschäfte, die Definition von Verlusten, Einzelfälle von Drohverlustrückstellungen (einschließlich Beschaffungs- und Absatzgeschäfte, Dauerschuldverhältnisse), den Saldierungsbereich und eine thesenförmige Zusammenfassung der wichtigsten Punkte. Die Zielsetzung ist die Verbesserung des Verständnisses der komplexen Bilanzierungsregeln in diesem Bereich.
Was versteht man unter „schwebenden Geschäften“ im Kontext der Bilanzierung?
Schwebenden Geschäfte sind Geschäfte, bei denen die Leistungspflichten beider Vertragsparteien noch nicht vollständig erfüllt sind. Der Text erläutert den Grundsatz der Nichtbilanzierung solcher Geschäfte, unter welchen Bedingungen eine Ausnahme von diesem Grundsatz (bei einem Verpflichtungsüberschuss) gemacht wird und wie der Schwebezustand endet.
Wann entstehen Drohverlustrückstellungen?
Drohverlustrückstellungen entstehen, wenn ein drohender Verlust aus einem schwebenden Geschäft besteht. Der Text definiert die Voraussetzungen: Es muss ein Verpflichtungsüberschuss vorliegen und ein tatsächliches, auf konkreten Anzeichen beruhendes Verlustrisiko bestehen. Eine bloße theoretische Verlustmöglichkeit reicht nicht aus.
Wie werden Drohverlustrückstellungen bei einmaligem und wiederholtem Leistungsaustausch bilanziert?
Der Text unterscheidet zwischen einmaligem Leistungsaustausch (z.B. einzelne Beschaffungs- oder Absatzgeschäfte) und Dauerschuldverhältnissen. Für jeden Fall werden spezifische Kriterien für die Rückstellungsbildung erläutert, einschließlich der Berücksichtigung von Wertminderungen und Marktpreisen. Beispiele für Beschaffungsgeschäfte (Anlage- und Umlaufvermögen) und Absatzgeschäfte werden detailliert dargestellt.
Welche Rolle spielt der Saldierungsbereich bei der Ermittlung des rückstellungsfähigen Verpflichtungsüberschusses?
Im Saldierungsbereich werden wechselseitige Leistungen und wirtschaftliche Vorteile berücksichtigt, die im Zusammenhang mit dem Vertrag stehen. Der Text betont die Bedeutung des Kausalitätszusammenhangs und erklärt, dass Hoffnungen und vage Erwartungen nicht berücksichtigungsfähig sind. Ein Beispiel aus der Rechtsprechung (BFH-Urteil im Apothekerfall) wird angeführt.
Welche Schlüsselbegriffe sind für das Verständnis des Textes wichtig?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Rückstellungen, Drohverlustrückstellungen, schwebendes Geschäft, HGB, Bilanzierung, Verpflichtungsüberschuss, Ausgeglichenheitsvermutung, Imparitätsprinzip, Beschaffungsgeschäft, Absatzgeschäft, Dauerschuldverhältnis, Bewertung, Abzinsung, Saldierungsbereich, wirtschaftliche Vorteile und Kausalität.
Welche Zielsetzung verfolgt der Text?
Der Text zielt darauf ab, das Verständnis der Bilanzierung von Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften nach HGB zu verbessern und anhand von Beispielen zu veranschaulichen. Er beleuchtet die komplexen Aspekte der Bilanzierung solcher Rückstellungen im Kontext des Handelsgesetzbuches.
- Arbeit zitieren
- Ivaylo Penchev (Autor:in), 2019, Bilanzierung von Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften nach HGB, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/507665