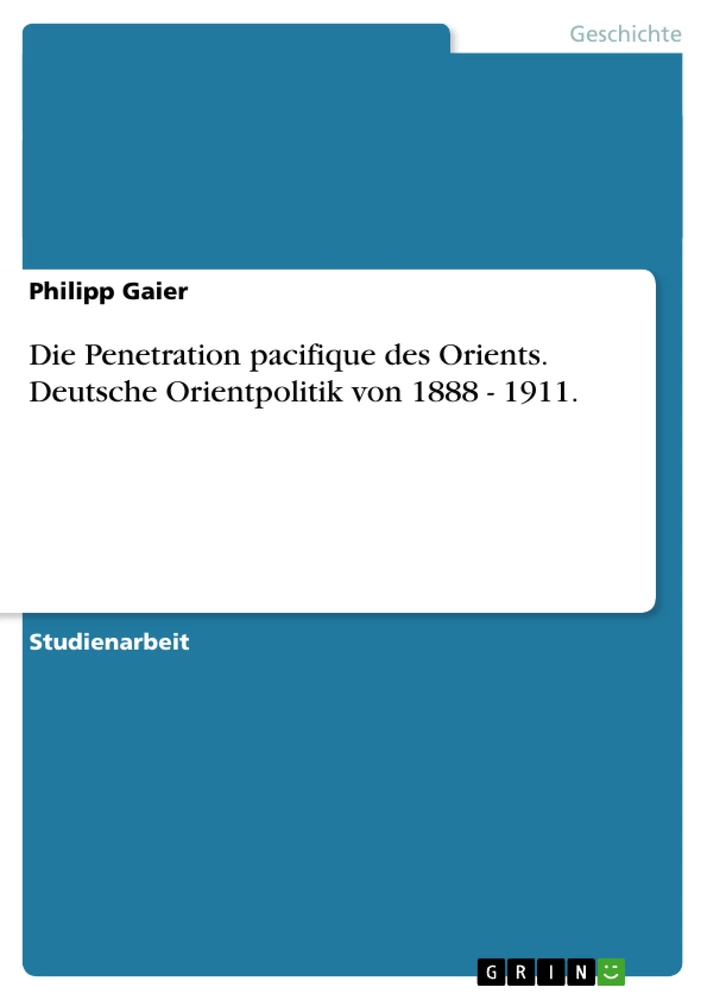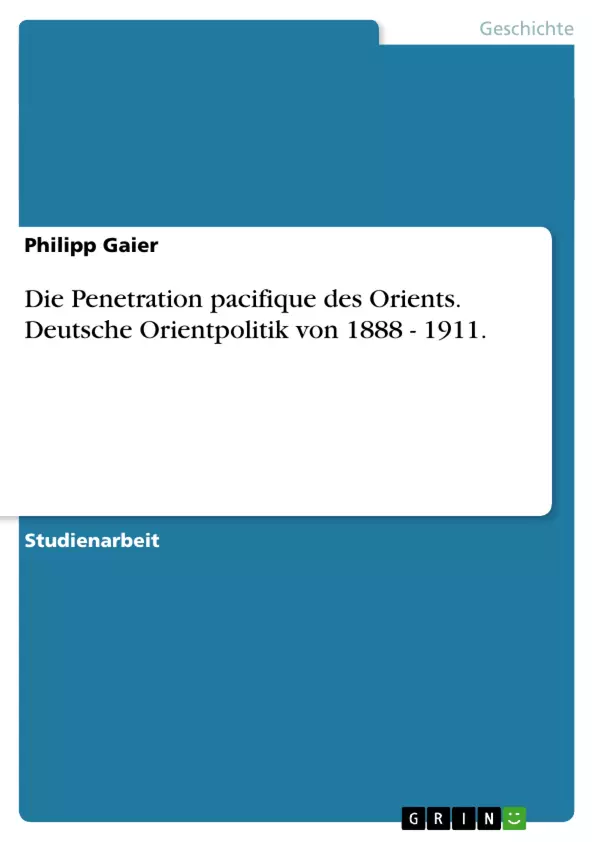Als Deutschland mit dem Bau der Bagdadbahn begann, drang es in eine Region ein, die von England, Frankreich und Russland bereits in Interessenssphären aufgeteilt worden war. Russland versuchte die beiden Meerengen, den Bosporus und die Dardanellen, in seinen Einflussbereich einzugliedern, um einen Zugang zum Mittelmeer zu erhalten. Gleichzeitig war es an einem Vorstoß zum Persischen Golf interessiert. Frankreich hatte in erster Linie wirtschaftliche Interessen und machte seinen Einfluss u. a. durch zahlreiche Missionsschulen und kleinere Eisenbahnprojekte im heutigen Libanon, Syrien und Palästina geltend. England befürchtete durch den deutschen Vorstoß den kürzesten Weg nach Indien und China, des Weiteren seine wirtschaftliche Position in Ägypten und Persien zu verlieren.
Das deutsche Engagement im Vorderen Orient erlangte allerdings erst in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts eine erwähnungswürdige Gewichtung. Die Außenpolitik Bismarcks sah eine umfangreichere Nahostpolitik nicht vor, was dieser immer wieder betonte, weltberühmt seine Formulierung, dass der Orient nicht die Knochen eines pommerschen Grenadiers wert sei, und das deutsche Wirken beschränkte sich zunächst auf Militärhilfe und geringere Investitionen. Vielmehr setzte Bismarck auf die bestehenden Gegensätze zwischen Frankreich, Russland und Britannien, um sie sich zunutze zu machen. Nach der Ära Bismarck demonstrierte Wilhelm II., „in dessen Person sich sowohl das religiöse, biblisch – archäologische und wissenschaftliche Interesse seiner Zeit am Heiligen Land als auch die Morgenlandsehnsüchte und alldeutsche Nahostträumereien wie in einem Brennspiegel sammelten, während seiner zweiten Orientreise 1898 auf provokante Art und Weise, die Bestrebung der Deutschen, bei dem Ringen der anderen Großmächte Frankreich, Großbritannien und Russland um den „kranken Mann am Bosporus“ kräftig mitzumischen. Die wirtschaftlichen Projekte des Reiches, wie sie Bismarck zunächst eingeschränkt vorsah, bekamen eine deutlich politische Note, was der Kaiser auch bewusst provozierte. War 1888 der Zuschlag für die türkische Bahnstrecke Konstantinopel – Ankara von den ausländischen Rivalen zumindest größtenteils relativ gelassen aufgenommen worden, so stieß das breitbeinige Auftreten Wilhelms auf weniger Gegenliebe.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Anfänge im Orient
- Der Hilferuf des Sultans
- Bismarck und das deutsche Desinteresse am Orient
- Die Eisenbahnkonzession
- Ein Wandel in Bismarcks Orientpolitik?
- Die Jahre 1890 - 1898
- Der neue Kurs unter Wilhelm II.
- Die Orientreise Wilhelms II. im Jahre 1898
- Die Bagdadbahn
- Ein deutsch-russisches - französisches Unternehmen?
- Von der englischen Zustimmung bis zur Gegnerschaft 1898–1903
- Der deutsche „Alleingang“ bis 1911
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit verfolgt das Ziel, die deutsche Außenpolitik im Vorderen Orient zwischen 1880 und 1911 zu beleuchten, insbesondere den Wandel von einer zurückhaltenden Politik unter Bismarck hin zu einer offensiveren Strategie unter Wilhelm II. Es werden die außenpolitischen Ziele Deutschlands und deren Auswirkungen auf die Beziehungen zu anderen Großmächten analysiert.
- Bismarcks zurückhaltende Orientpolitik
- Der Wandel der Orientpolitik unter Wilhelm II.
- Der Streit um die Bagdadbahnkonzessionen
- Die wirtschaftlichen und politischen Interessen Deutschlands im Nahen Osten
- Die Reaktion der anderen Großmächte auf das deutsche Engagement
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung skizziert den Kontext des deutschen Engagements im Vorderen Orient, das in eine Region eingriff, die bereits von England, Frankreich und Russland in Interessenssphären aufgeteilt war. Sie hebt die strategische Bedeutung der Region für die Großmächte hervor und benennt die Zielsetzung der Arbeit: die Analyse der deutschen außenpolitischen Ziele und deren Entwicklung unter Bismarck und Wilhelm II., sowie deren Auswirkungen auf die Beziehungen zu anderen europäischen Mächten. Die Arbeit fokussiert auf die wichtigsten Ereignisse im Zeitraum 1888-1911.
Die Anfänge im Orient 1880-1888: Dieses Kapitel beschreibt die frühen Phasen des deutschen Engagements im Orient. Es beginnt mit dem Hilferuf des Sultans nach dem russisch-türkischen Krieg von 1877/78, der die Türken zu militärischer Zusammenarbeit mit Deutschland bewegte, da Deutschland im Gegensatz zu anderen Mächten als neutral wahrgenommen wurde. Das Kapitel beleuchtet Bismarcks anfängliches Desinteresse am Orient, seine strategische Ausnutzung bestehender Konflikte zwischen den Großmächten und den Beginn deutscher Rüstungslieferungen an das Osmanische Reich. Der Fokus liegt auf der allmählichen Zunahme deutschen Einflusses durch Militärhilfe und den darauf folgenden Rüstungsaufträgen, die zu einer wirtschaftlichen und politischen Präsenz Deutschlands in der Region führten.
Die Jahre 1890 - 1898: Dieses Kapitel konzentriert sich auf den Wandel der deutschen Orientpolitik unter Wilhelm II. Es beschreibt den neuen, offensiveren Kurs des Kaisers, der deutlich von Bismarcks Zurückhaltung abwich. Die Orientreise Wilhelms II. 1898 wird als ein Schlüsselmoment dargestellt, der die politischen Ambitionen Deutschlands im Nahen Osten verdeutlichte und die Rivalität mit anderen europäischen Mächten verschärfte. Das Kapitel zeigt, wie die anfänglich eher wirtschaftlichen Projekte unter Bismarck nun eine deutlichere politische Färbung erhielten, und wie die deutschen Bestrebungen, am „Ringen um den kranken Mann am Bosporus“ teilzunehmen, zu wachsender internationaler Spannung führten.
Die Bagdadbahn: Dieses Kapitel analysiert den Streit um die Bagdadbahn als zentralen Punkt der deutschen Orientpolitik. Es untersucht die anfängliche Hoffnung auf eine Kooperation mit Russland und Frankreich, den Wandel zur Konkurrenz mit England, sowie den „deutschen Alleingang“ im Bau der Bahnlinie. Das Kapitel betont die strategische Bedeutung der Bagdadbahn für Deutschland, die den Zugang zu wichtigen Ressourcen und Märkten im Nahen Osten und in Asien eröffnen sollte, aber gleichzeitig zu verstärkten Spannungen mit den anderen europäischen Großmächten führte. Der Fokus liegt auf dem zunehmenden Konfliktpotenzial, das durch das deutsche Vorpreschen ausgelöst wurde.
Schlüsselwörter
Deutsche Orientpolitik, Bismarck, Wilhelm II., Bagdadbahn, Osmanisches Reich, Großmachtpolitik, Kolonialismus, wirtschaftliche Interessen, militärische Intervention, internationale Beziehungen, Pénétration pacifique.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Deutschen Orientpolitik 1880-1911
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die deutsche Außenpolitik im Vorderen Orient zwischen 1880 und 1911, insbesondere den Wandel von einer zurückhaltenden Politik unter Bismarck zu einer offensiveren Strategie unter Wilhelm II. Der Fokus liegt auf den außenpolitischen Zielen Deutschlands, ihren Auswirkungen auf die Beziehungen zu anderen Großmächten und der Rolle der Bagdadbahn.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Bismarcks zurückhaltende Orientpolitik, den Wandel unter Wilhelm II., den Streit um die Bagdadbahnkonzessionen, die wirtschaftlichen und politischen Interessen Deutschlands im Nahen Osten und die Reaktionen anderer Großmächte. Sie beleuchtet die Anfänge des deutschen Engagements, die Orientreise Wilhelms II. 1898 und den "deutschen Alleingang" beim Bau der Bagdadbahn.
Welche Zeitspanne wird untersucht?
Die Arbeit konzentriert sich auf den Zeitraum zwischen 1880 und 1911, wobei der Schwerpunkt auf der Entwicklung der deutschen Orientpolitik nach Bismarcks Rücktritt liegt.
Welche Rolle spielte Bismarck in der deutschen Orientpolitik?
Bismarck verfolgte anfänglich eine zurückhaltende Orientpolitik, nutzte aber strategisch die Konflikte zwischen den Großmächten aus. Seine Politik war primär auf wirtschaftliche Interessen ausgerichtet und vermeidet eine direkte Konfrontation.
Wie veränderte sich die deutsche Orientpolitik unter Wilhelm II.?
Unter Wilhelm II. wurde die deutsche Orientpolitik deutlich offensiver. Der Kaiser verfolgte aktivere politische Ambitionen und suchte nach einer größeren Rolle Deutschlands im Nahen Osten, was zu verstärkter Konkurrenz und Spannungen mit anderen europäischen Mächten führte.
Welche Bedeutung hatte die Bagdadbahn?
Die Bagdadbahn war ein zentrales Element der deutschen Orientpolitik. Sie sollte den Zugang zu wichtigen Ressourcen und Märkten im Nahen Osten und Asien ermöglichen. Der Streit um die Konzessionen und der "deutsche Alleingang" beim Bau der Bahnlinie steigerten die Spannungen mit anderen Großmächten erheblich.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Deutsche Orientpolitik, Bismarck, Wilhelm II., Bagdadbahn, Osmanisches Reich, Großmachtpolitik, Kolonialismus, wirtschaftliche Interessen, militärische Intervention, internationale Beziehungen, Pénétration pacifique.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zu den Anfängen des deutschen Engagements im Orient (1880-1888), den Jahren 1890-1898, der Bagdadbahn und ein Fazit. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte der deutschen Orientpolitik in diesem Zeitraum.
- Quote paper
- Philipp Gaier (Author), 2005, Die Penetration pacifique des Orients. Deutsche Orientpolitik von 1888 - 1911., Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/50714