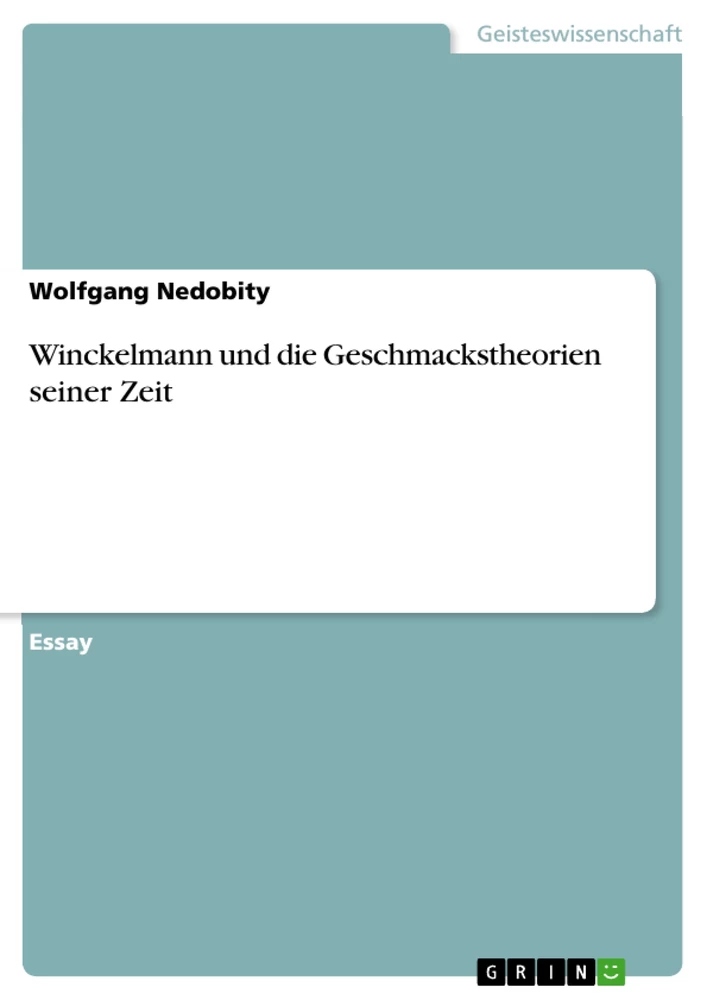Seit der Aufklärung ist der „Geschmack“ einer der Schlüsselbegriffe der Ästhetik, mit dem sich durchwegs Ansprüche der Erkenntnis, Moral und sozialer Differenzierung verbinden. Der Begriff des Geschmacks war, seiner Herkunft aus dem Bereich der Sinneswahrnehmungen entsprechend, eng mit dem Begriff der Empfindung und Empfindsamkeit verknüpft. Ursprünglich der Vernunft untergeordnet, wurde der Empfindung als der primären Instanz der Verarbeitung sinnlicher Wahrnehmungen im 18. Jahrhundert zunehmend größere Bedeutung zugewiesen. Dennoch blieb dieser Begriff mehrdeutig und schillernd; so wurde er u.a. auch für die Kennzeichnung der sexuellen Orientierung verwendet.
Inhaltsverzeichnis
- Winckelmann und die Geschmackstheorien seiner Zeit
- Geschmack im 18. Jahrhundert
- Aufklärung und der Begriff des Geschmacks
- Der Einfluss der Sinne und der Vernunft
- Geschmack und soziale Differenzierung
- Der Geschmack in der Kunst und Literatur
- Kants Kritik der ästhetischen Urteilskraft
- Frankreich und das Interesse am „Geschmack“
- Der Geschmack in England
- Klarheit der Vernunft und Finsternis der Leidenschaften
- Die Erhabenheit als Komponente des Geschmacks
- Winckelmann und Mengs in Rom
- Winckelmanns „Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke“
- Winckelmann und der Begriff „Geschmack“
- Winckelmanns Beziehung zu Mengs
- Mengs als Geschmackstheoretiker
- Ludwig Tiecks „Reise nach dem guten Geschmack“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Bedeutung des Begriffs „Geschmack“ im 18. Jahrhundert und beleuchtet insbesondere die Rolle des deutschen Kunsthistorikers Johann Joachim Winckelmann in der Entwicklung der Geschmackstheorien dieser Zeit.
- Die Entwicklung des Begriffs „Geschmack“ in der Aufklärung
- Die Rolle der Vernunft und der Sinne in der Geschmacksbildung
- Die Bedeutung von Winckelmanns Werk für die Geschichte der Geschmacksdebatte
- Die Beziehung zwischen Geschmack und Kunst
- Die Bedeutung von „Geschmack“ in der Kunsttheorie und -kritik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Definition des Begriffs „Geschmack“ und erläutert seine Bedeutung im Kontext der Aufklärung. Dabei werden die Ansätze von bedeutenden Denkern dieser Zeit wie Shaftesbury, Kant, Voltaire und Herder vorgestellt. Im Fokus steht die Rolle des Geschmacks in der Kunst und Literatur, insbesondere in der Malerei und Bildhauerkunst. Die Arbeit beleuchtet Winckelmanns Werk und seine Bedeutung für die Entwicklung des „guten Geschmacks“ im 18. Jahrhundert. Es wird analysiert, wie er den Geschmack in der Antike erforscht und seine Theorien auf die Gegenwart übertragen hat. Die Bedeutung von „Geschmack“ im Zusammenhang mit Winckelmanns eigenem Leben und seinen persönlichen Vorlieben wird ebenfalls beleuchtet. Weiterhin wird die Beziehung zwischen Winckelmann und Anton Raphael Mengs, einem weiteren wichtigen Vertreter der damaligen Kunstbewegung, untersucht. Die Arbeit endet mit einer Betrachtung von Ludwig Tiecks Drama „Prinz Zerbino oder die Reise nach dem guten Geschmack“ und den dort dargestellten Ideen über den „guten Geschmack“ und die Kunst.
Schlüsselwörter
Geschmack, Aufklärung, Kunstgeschichte, Winckelmann, Mengs, ästhetische Urteilskraft, Sinneswahrnehmung, Vernunft, Kunsttheorie, Antike, Klassizismus, Rokoko, Italien, England, Deutschland, „sensus communis aestheticus“
- Arbeit zitieren
- Wolfgang Nedobity (Autor:in), 2009, Winckelmann und die Geschmackstheorien seiner Zeit, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/506699