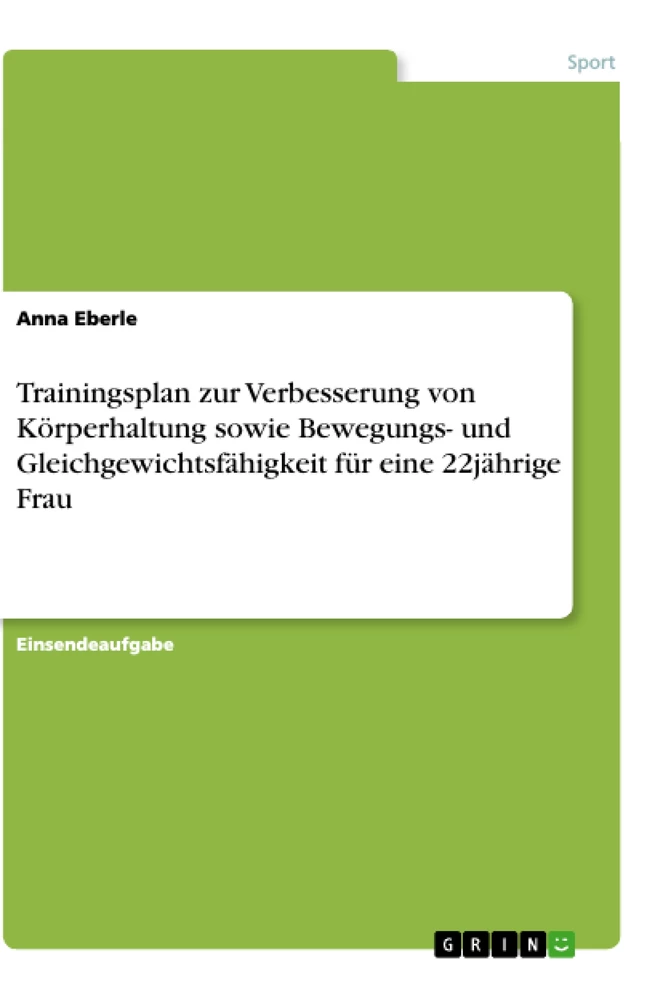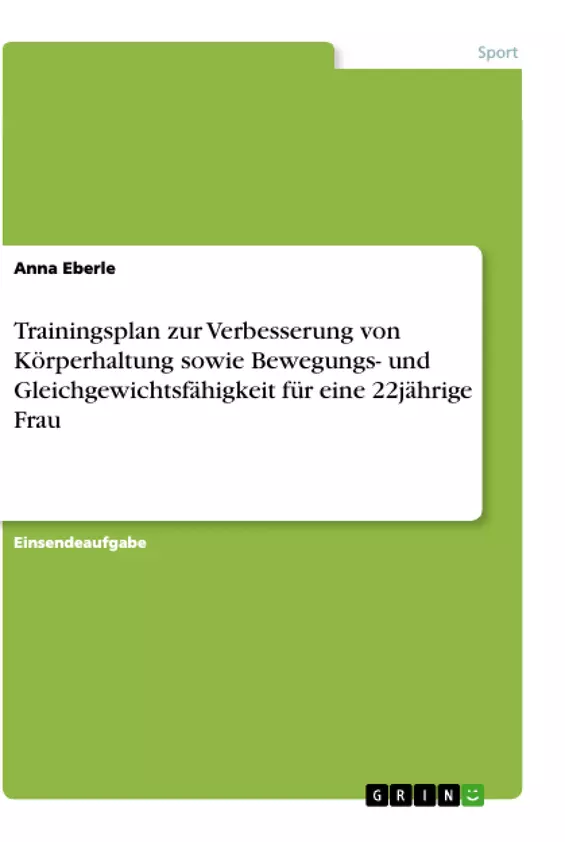Diese Einsendeaufgabe stellt einen Trainingsplan vor für eine 22jährige Frau vor, die ihre Beweglichkeit, Koordination sowie Körperhaltung verbessern möchte. Zuerst erfolgt eine Beweglichkeitstestung nach Janda. Der Fokus liegt hierbei auf der Brust-, Hüftbeuge-, Kniestreck- und Kniebeuge sowie Wadenmuskulatur. Im Anschluss wird der Trainingsplan vorgestellt. Das Beweglichkeitstraining sieht vor allem Dehnübunge vor, das Koordinationstraining besteth aus Gleichgewichtsübungen.
Inhaltsverzeichnis
- PERSONENDATEN
- BEWEGLICHKEITSTESTUNG
- Brustmuskulatur (M. pectoralis major)
- Hüftbeugemuskulatur (speziell M. iliopsoas)
- Kniestreckmuskulatur (speziell M. rectus femoris)
- Kniebeugemuskulatur (Mm. ischiocrurales)
- Wadenmuskulatur (Mm. triceps surae)
- Bewertung und Interpretation
- TRAININGSPLANUNG BEWEGLICHKEITSTRAINING
- Dehnübung 1
- Dehnübung 2
- Dehnübung 3
- Dehnübung 4
- Dehnübung 5
- Dehnübung 6
- Dehnübung 7
- Dehnübung 8
- Dehnübung 9
- Dehnübung 10
- Dehnübung 11
- Belastungsgefüge und Begründung
- TRAININGSPLANUNG KOORDINATIONSTRAINING
- Gleichgewichtsübung 1
- Gleichgewichtsübung 2
- Gleichgewichtsübung 3
- Gleichgewichtsübung 4
- Gleichgewichtsübung 5
- Gleichgewichtsübung 6
- Gleichgewichtsübung 7
- Gleichgewichtsübung 8
- Gleichgewichtsübung 9
- Gleichgewichtsübung 10
- Belastungsgefüge und Begründung
- LITERATURRECHERCHE
- LITERATURVERZEICHNIS
- TABELLENVERZEICHNIS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Einsendeaufgabe befasst sich mit der Analyse und Planung von Trainingsmaßnahmen im Bereich Beweglichkeit und Koordination. Im Fokus steht die Erstellung eines individuellen Trainingsplans für eine weibliche Testperson, der auf ihren persönlichen Trainingsmotiven, ihrem körperlichen Zustand und ihren spezifischen Bedürfnissen basiert.
- Individuelle Trainingsbedürfnisse und -ziele
- Beweglichkeitstests und -bewertung
- Planung und Durchführung von Beweglichkeitstraining
- Koordinationstests und -bewertung
- Planung und Durchführung von Koordinationstraining
Zusammenfassung der Kapitel
Personendaten
Dieses Kapitel präsentiert die persönlichen Daten der Testperson, einschliesslich Alter, Geschlecht, Körpermasse, Trainingsmotive und allgemeinem Gesundheitszustand.
Beweglichkeitstestung
In diesem Kapitel wird die Beweglichkeit der Testperson anhand des Janda-Tests (2009) bewertet. Die fünf getesteten Muskelgruppen werden detailliert beschrieben und die Ergebnisse anhand von Richt- und Normwerten analysiert.
Trainingsplanung Beweglichkeitstraining
Dieses Kapitel beinhaltet die Planung eines individuellen Trainingsplans für die Verbesserung der Beweglichkeit. Der Plan umfasst elf verschiedene Dehnübungen und die Begründung der gewählten Belastungsgefüge.
Trainingsplanung Koordinationstraining
Dieses Kapitel beschreibt die Planung eines individuellen Trainingsplans zur Verbesserung der Koordination. Der Plan umfasst zehn verschiedene Gleichgewichtsübungen und die Begründung der gewählten Belastungsgefüge.
Schlüsselwörter
Individuelle Trainingsplanung, Beweglichkeit, Koordination, Janda-Test, Dehnübungen, Gleichgewichtsübungen, Belastungsgefüge, Gesundheitsmanagement.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel des vorgestellten Trainingsplans?
Der Plan dient der Verbesserung der Beweglichkeit, Koordination, Körperhaltung sowie der Gleichgewichtsfähigkeit einer 22-jährigen Frau.
Wie wird die Beweglichkeit in dieser Untersuchung getestet?
Es erfolgt eine Beweglichkeitstestung nach der Methode von Janda (2009), die spezifische Muskelgruppen auf Verkürzungen prüft.
Welche Muskelgruppen stehen im Fokus der Beweglichkeitstestung?
Getestet werden die Brustmuskulatur, Hüftbeuger, Kniestrecker, Kniebeuger und die Wadenmuskulatur.
Was beinhaltet das Koordinationstraining?
Das Koordinationstraining besteht aus zehn spezifischen Gleichgewichtsübungen, für die jeweils das Belastungsgefüge begründet wird.
Wie viele Dehnübungen umfasst der Beweglichkeits-Trainingsplan?
Der Plan sieht insgesamt elf verschiedene Dehnübungen vor, um die Beweglichkeit der Probandin gezielt zu steigern.
Warum ist die Erfassung von Personendaten wie Blutdruck wichtig?
Diese Daten sind für ein sicheres Gesundheitsmanagement unerlässlich, um die Belastbarkeit der Person vor Trainingsbeginn einzuschätzen.
- Arbeit zitieren
- Anna Eberle (Autor:in), 2019, Trainingsplan zur Verbesserung von Körperhaltung sowie Bewegungs- und Gleichgewichtsfähigkeit für eine 22jährige Frau, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/506498