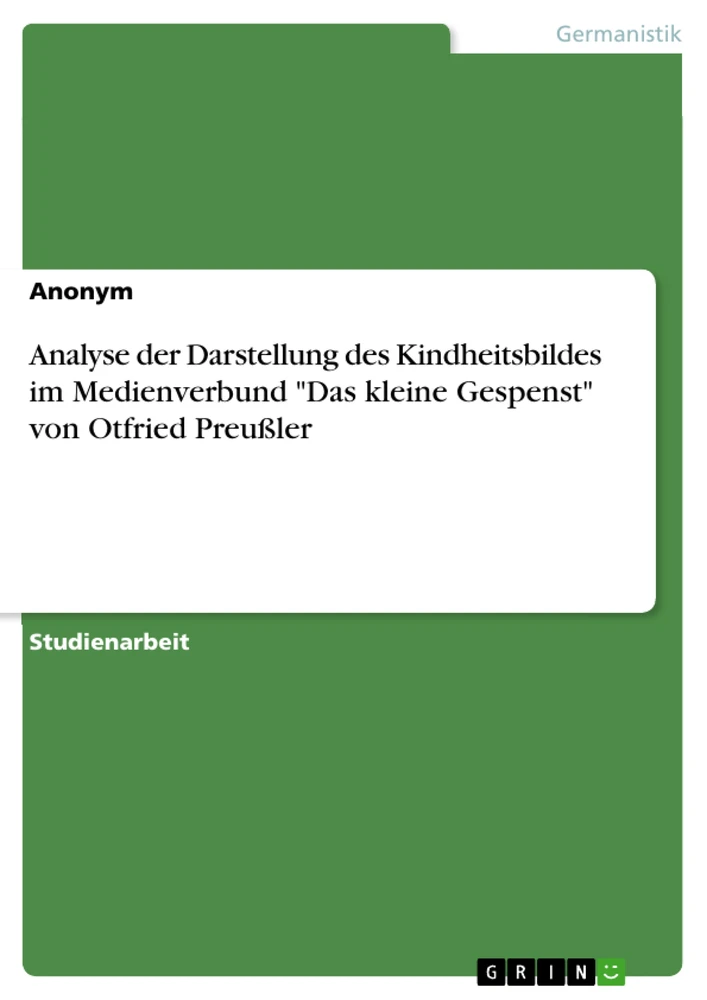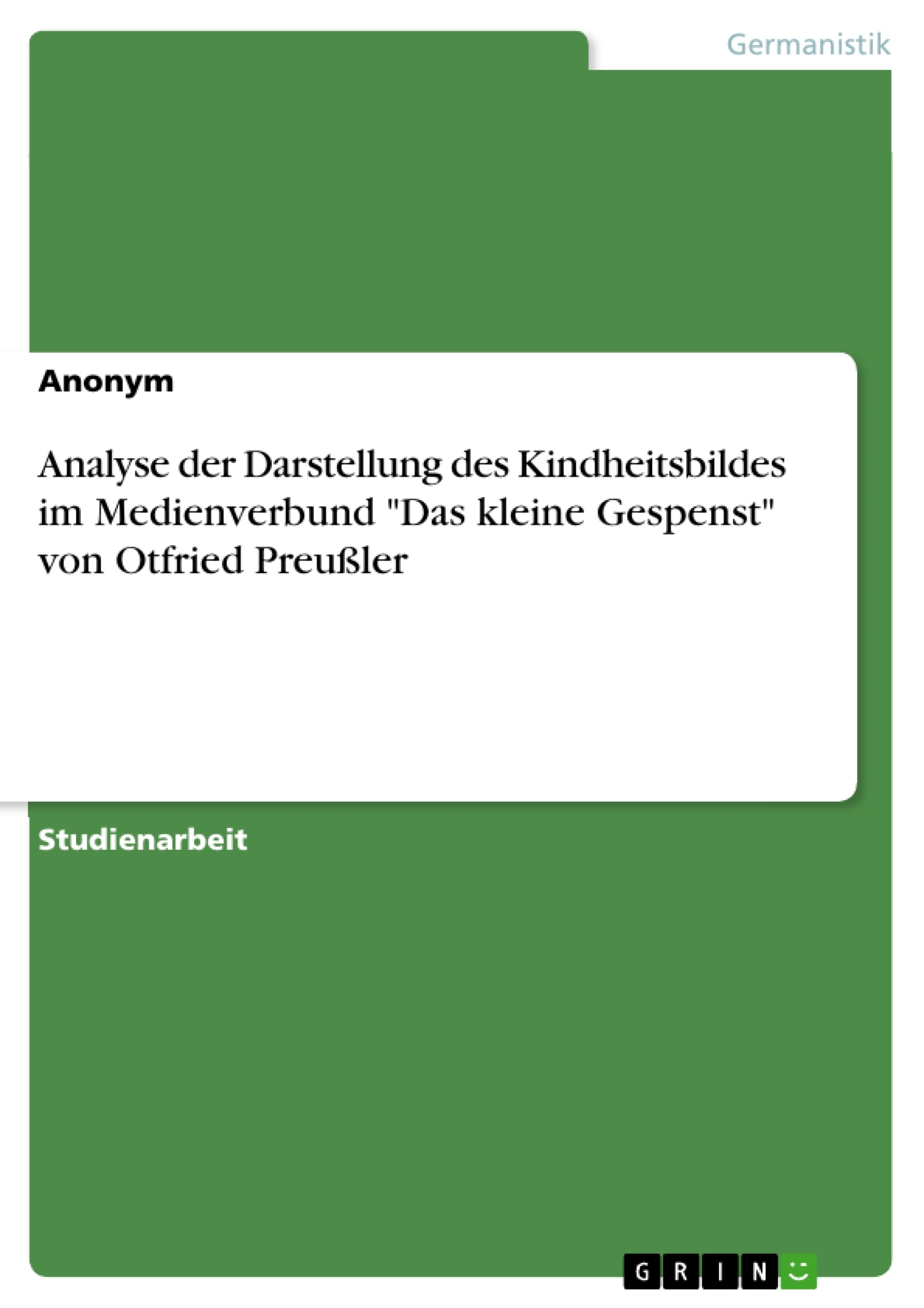Das moderne Kind ist ein schlechtes Kind. Es ist gewalttätig. […] Es sitzt vor dem Fernseher und ißt Pommes Frites. Am Computer spielt es mit Killer-Software. Es ist hoffnungslos konsumorientiert, will alles kaufen, was die Freunde haben, und kümmert sich ansonsten nicht um andere. (Daubert und Ewers 1995)
Diese, von Daubert überspitze Darstellung von Kindheit in den 2000ern verdeutlicht, dass Kindheit und Medien in einem direkten Zusammenhang zueinander-stehen und dass sie einem stetigen Wandel unterliegt. Aus diesem Grund richtet die Hausarbeit zunächst den Blick auf die epochale Entwicklung von Kinder- und Jugendliteratur (KJL) ab 1945 und damit einhergehend auf die Veränderungen des Kindheitsbildes.
Ein gutes Beispiel für die Darstellung der Veränderungen des Kindheitsbildes in der KJL ist Das kleine Gespenst von Otfried Preußler, dessen Medienverbund im Fokus dieser Arbeit steht.
Anhand dieses Verbundes soll analysiert werden, ob und wie sich das Kindheitsbild von 1966 bis 2014 gewandelt hat und wie es in den unterschiedlichen Medien dargestellt wird. Ein besonderes Augenmerk liegt somit auf narrativen, auditiven und visuellen Elementen zur Darstellung des Kindheitsbildes.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Epochale Entwicklung der KJL und ihrer Kindheitsbilder
- 2.1 Nachkriegszeit (1945-1968)
- 2.2 Die neue Aufklärung (1968-1978)
- 2.3 Gegenwart (1978-2019)
- 3 Das kleine Gespenst
- 3.1 Autor: Otfried Preußler
- 3.2 Inhaltsangabe
- 3.3 Das kleine Gespenst im Medienverbund
- 3.4 Bibliographische Angaben der Primärmedien & Epochale Einordnung
- 4 Analyse des Kindheitsbildes in Otfried Preußlers „Das kleine Gespenst“
- 4.1 Darstellung des Kindheitsbildes im Buch
- 4.2 Darstellung des Kindheitsbildes im Film
- 4.3 Vergleich des Kindheitsbildes dieser Medienarten
- 5 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Wandel des Kindheitsbildes in der Kinder- und Jugendliteratur (KJL) seit 1945 und analysiert dessen Darstellung im Medienverbund von Otfried Preußlers „Das kleine Gespenst“. Ziel ist es, die Entwicklung des Kindheitsbildes anhand verschiedener Epochen zu beleuchten und die unterschiedlichen medialen Repräsentationen zu vergleichen.
- Entwicklung des Kindheitsbildes in der KJL seit 1945
- Analyse des Kindheitsbildes in Otfried Preußlers „Das kleine Gespenst“
- Vergleich der Darstellung des Kindheitsbildes im Buch und im Film
- Einfluss gesellschaftlicher Veränderungen auf das Kindheitsbild
- Der Medienverbund als Spiegel des sich wandelnden Kindheitsbildes
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung stellt die These auf, dass das Kindheitsbild eng mit dem Medienkonsum verwoben ist und einem ständigen Wandel unterliegt. Sie argumentiert für die Notwendigkeit einer epochenübergreifenden Analyse des Kindheitsbildes in der Kinder- und Jugendliteratur und wählt Otfried Preußlers „Das kleine Gespenst“ als Fallbeispiel aufgrund seines Medienverbundes. Die Arbeit fokussiert sich auf die narrativen, auditiven und visuellen Elemente zur Darstellung des Kindheitsbildes.
2 Epochale Entwicklung der KJL und ihrer Kindheitsbilder: Dieses Kapitel unterteilt die Entwicklung des Kindheitsbildes in der Kinder- und Jugendliteratur in drei Epochen: Nachkriegszeit, Neue Aufklärung und Gegenwart. Die Nachkriegszeit wird durch Werke wie „Das doppelte Lottchen“ und „Pippi Langstrumpf“ charakterisiert, die ein selbstständigeres, freieres und weniger von Erwachsenen kontrolliertes Kindheitsbild präsentieren. Die „Neue Aufklärung“ sieht eine Annäherung der Kinder- und Erwachsenenliteratur, mit realistischerer Darstellung von Problemen und einem Ende der idealisierten Kindheitsvorstellung. Die Gegenwart zeichnet sich durch eine kritische Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Themen wie Scheidung und Mobbing aus, wobei die kindliche Innenwelt stärker thematisiert wird, aber gleichzeitig eine gewisse Rückkehr zu stärkerer elterlicher Kontrolle spürbar ist. Die Kapitelteile beleuchten die jeweiligen gesellschaftlichen und literarischen Entwicklungen, die das Bild des Kindes formten.
Schlüsselwörter
Kindheitsbild, Kinder- und Jugendliteratur, Medienverbund, Otfried Preußler, Das kleine Gespenst, Nachkriegszeit, Neue Aufklärung, Gegenwart, Autonomie, Emanzipation, Gesellschaftliche Veränderungen, Medienwirkung.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse des Kindheitsbildes in Otfried Preußlers „Das kleine Gespenst“
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Wandel des Kindheitsbildes in der Kinder- und Jugendliteratur (KJL) seit 1945 und analysiert dessen Darstellung im Medienverbund von Otfried Preußlers „Das kleine Gespenst“. Der Fokus liegt auf dem Vergleich der Darstellung des Kindheitsbildes im Buch und im Film und dem Einfluss gesellschaftlicher Veränderungen.
Welche Epochen werden in der Analyse des Kindheitsbildes betrachtet?
Die Arbeit unterteilt die Entwicklung des Kindheitsbildes in drei Epochen: Die Nachkriegszeit (1945-1968), die Neue Aufklärung (1968-1978) und die Gegenwart (1978-2019). Jede Epoche wird hinsichtlich ihrer gesellschaftlichen und literarischen Einflüsse auf das Kindheitsbild untersucht.
Wie wird das Kindheitsbild in Otfried Preußlers „Das kleine Gespenst“ analysiert?
Die Analyse betrachtet das Kindheitsbild in „Das kleine Gespenst“ sowohl in der Buchfassung als auch in der filmischen Adaption. Es wird ein Vergleich der narrativen, auditiven und visuellen Elemente zur Darstellung des Kindheitsbildes vorgenommen.
Welche Schlüsselwerke oder -autoren werden in der Arbeit erwähnt?
Als Beispiel für die Nachkriegszeit werden Werke wie „Das doppelte Lottchen“ und „Pippi Langstrumpf“ genannt. Die Arbeit konzentriert sich hauptsächlich auf Otfried Preußlers „Das kleine Gespenst“ und dessen Medienverbund.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung des Kindheitsbildes in der KJL seit 1945, die Analyse des Kindheitsbildes in „Das kleine Gespenst“, den Vergleich der Darstellung im Buch und Film, den Einfluss gesellschaftlicher Veränderungen auf das Kindheitsbild und den Medienverbund als Spiegel des sich wandelnden Kindheitsbildes.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit besteht aus einer Einleitung, einem Kapitel zur epochalen Entwicklung der KJL und ihrer Kindheitsbilder, einem Kapitel zu „Das kleine Gespenst“ (inkl. Autor, Inhaltsangabe, Medienverbund und bibliographischen Angaben), einem Kapitel zur Analyse des Kindheitsbildes in „Das kleine Gespenst“ (Buch und Film im Vergleich) und einem Fazit.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Kindheitsbild, Kinder- und Jugendliteratur, Medienverbund, Otfried Preußler, Das kleine Gespenst, Nachkriegszeit, Neue Aufklärung, Gegenwart, Autonomie, Emanzipation, Gesellschaftliche Veränderungen, Medienwirkung.
Welches ist die zentrale These der Arbeit?
Die zentrale These ist, dass das Kindheitsbild eng mit dem Medienkonsum verwoben ist und einem ständigen Wandel unterliegt. Die Arbeit argumentiert für die Notwendigkeit einer epochenübergreifenden Analyse des Kindheitsbildes in der Kinder- und Jugendliteratur.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2019, Analyse der Darstellung des Kindheitsbildes im Medienverbund "Das kleine Gespenst" von Otfried Preußler, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/498213