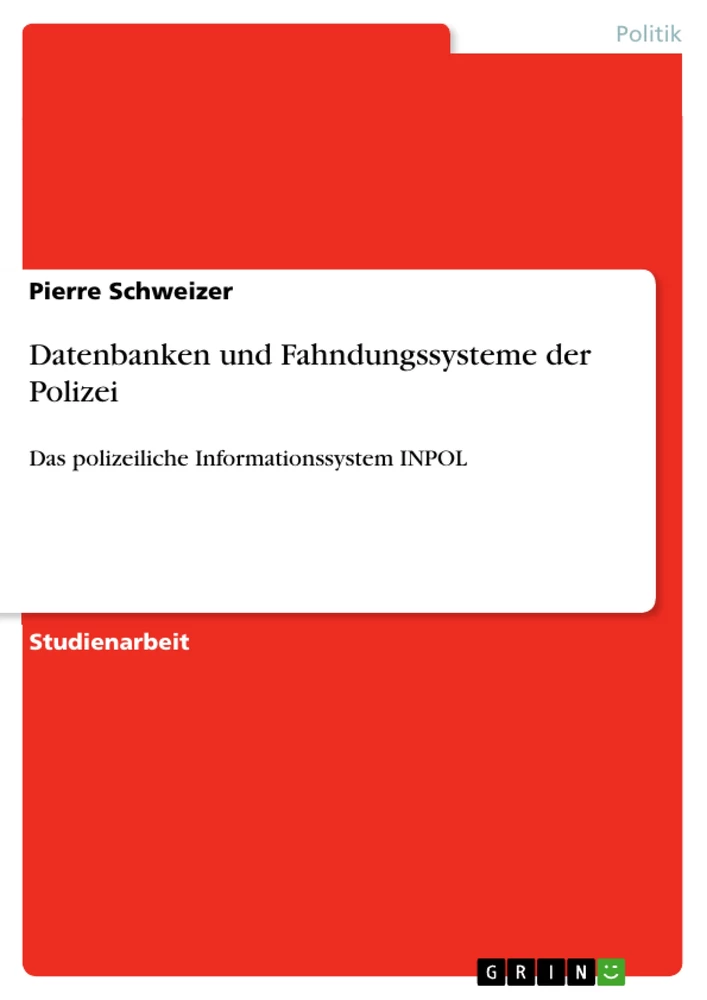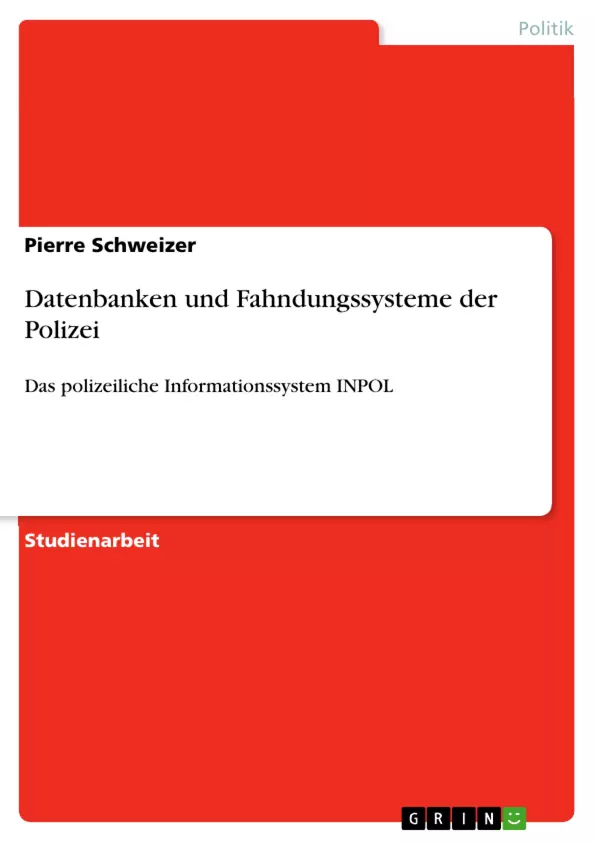Die Arbeit befasst sich mit der Frage was unter polizeilichen Datenbanken und Fahndungssystemen zu verstehen ist und welche rechtlichen Vorgaben damit verbunden sind.
Zu Beginn setzt sich die Arbeit mit dem geschichtlichen Kontext des polizeilichen Informationssystems in der Bundesrepublik Deutschland auseinander und legt dar, worin die Probleme eines zentral geführten EDV-Systems bestanden. Es folgt die Betrachtung der Einführung des Informationssystems der Polizei (INPOL) und dessen Ziele. Daraufhin werden die relevantesten Rechtsnormen und die wichtigsten Begriffe erläutert. Anschließend werden die europäische Variante von INPOL und das Schengener Informationssystem SIS vorgestellt. Abschließend befasst sich die Arbeit mit einer konkreten Verbunddatei, um den Zweck und den Umfang einer Datei im polizeilichen Informationssystem zu veranschaulichen.
Kriminalität ist ein Phänomen, das häufig über die regionalen Grenzen hinausgeht und die Zusammenarbeit verschiedener Polizeibehörden erforderlich macht. Daher ist es von zentraler Bedeutung, dass es einen funktionierenden länderübergreifenden Informationsaustausch zu Straftaten und -tätern gibt. Das BKA ist in Deutschland die zentrale Behörde zur Strafverfolgung und Schnittstelle für den Informationsaustausch zwischen den Polizeien der Länder und des Bundes.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Allgemeiner Teil
- 2.1 Anfänge eines zentralen EDV-Systems
- 2.2 Einführung INPOL
- 2.3 Ziel des Verbundsystems
- 3 Rechtliche Grundlagen
- 3.1 Zuständigkeiten
- 3.2 Datenverbundsystem
- 3.3 Verbunddateien, Zentraldateien
- 3.4 Automatisierte Dateien
- 3.5 Erhebung und Verarbeitung von Dateien
- 3.6 Speicherung von personenbezogenen Informationen
- 4 Das Schengener Informationssystem
- 5 Datei „Gewalttäter Sport“
- 6 Zusammenfassung und Bewertung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das polizeiliche Informationssystem INPOL in Deutschland, seine rechtlichen Grundlagen und seine Bedeutung für den internen und internationalen Informationsaustausch im Strafverfolgungsbereich. Sie beleuchtet die Herausforderungen der Einführung eines zentralen EDV-Systems in einem föderalen System und analysiert die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Erhebung, Verarbeitung und Speicherung personenbezogener Daten.
- Entwicklung und Einführung des polizeilichen Informationssystems INPOL
- Rechtliche Rahmenbedingungen für polizeiliche Datenbanken und Fahndungssysteme
- Der Vergleich zwischen nationalen und supranationalen (z.B. Schengen) Systemen
- Die Funktionsweise von Verbunddateien am Beispiel einer konkreten Datei
- Herausforderungen und Problemfelder im Umgang mit polizeilichen Daten
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung betont die Notwendigkeit eines funktionierenden, länderübergreifenden Informationsaustausches im Strafverfolgungsbereich aufgrund der grenzüberschreitenden Natur von Kriminalität. Sie führt in die Thematik polizeilicher Datenbanken und Fahndungssysteme ein und skizziert den Aufbau der Arbeit, der sich mit dem historischen Kontext, den rechtlichen Grundlagen, dem Schengener Informationssystem und einer konkreten Verbunddatei auseinandersetzt. Der Fokus liegt auf den Herausforderungen und rechtlichen Aspekten eines zentralen polizeilichen Informationssystems.
2 Allgemeiner Teil: Dieses Kapitel beleuchtet die Anfänge der zentralen EDV im deutschen Polizeibereich, beginnend mit der Inbetriebnahme des ersten zentralen Rechenzentrums beim BKA im Jahr 1972. Es wird der Vergleich mit den USA und dem dort bereits bestehenden NCIC gezogen. Die Arbeit beschreibt die „Computerisierung von unten“ auf Landesebene und die anfänglichen Widerstände gegen ein gemeinsames, bundesweites System aufgrund von Länderkompetenzen und Investitionen in bereits bestehende Ländersysteme. Die Einführung von INPOL im Jahr 1973 als Ergebnis eines Kompromisses wird detailliert dargestellt, inklusive der Herausforderungen bei der Zusammenführung unterschiedlicher Landessysteme und dem bestehenden Bestand an Fahndungsdatensätzen.
Schlüsselwörter
INPOL, Polizeidatenbanken, Fahndungssysteme, Datenschutz, Rechtsgrundlagen, Datenverarbeitung, Schengener Informationssystem (SIS), Verbunddateien, elektronische Datenverarbeitung, föderale Strukturen, Länderkompetenzen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Polizeilichen Informationssystem INPOL
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert das deutsche polizeiliche Informationssystem INPOL, seine rechtlichen Grundlagen und seine Bedeutung für den nationalen und internationalen Informationsaustausch im Strafverfolgungsbereich. Der Fokus liegt auf den Herausforderungen der Einführung eines zentralen EDV-Systems in einem föderalen System und den rechtlichen Rahmenbedingungen für den Umgang mit personenbezogenen Daten.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung und Einführung von INPOL, die rechtlichen Rahmenbedingungen für polizeiliche Datenbanken und Fahndungssysteme, einen Vergleich zwischen nationalen und supranationalen Systemen (wie Schengen), die Funktionsweise von Verbunddateien anhand eines Beispiels und die Herausforderungen und Problemfelder im Umgang mit polizeilichen Daten.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, einen allgemeinen Teil, einen Abschnitt zu den rechtlichen Grundlagen, einen Abschnitt zum Schengener Informationssystem, einen Abschnitt zu einer konkreten Datei ("Gewalttäter Sport") und eine Zusammenfassung mit Bewertung. Der allgemeine Teil beleuchtet die Anfänge der zentralen EDV im deutschen Polizeibereich und die Einführung von INPOL.
Welche rechtlichen Aspekte werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich ausführlich mit den rechtlichen Grundlagen für die Erhebung, Verarbeitung und Speicherung personenbezogener Daten im Kontext von INPOL. Sie untersucht die Zuständigkeiten, die Definition von Verbund- und Zentraldateien, den Umgang mit automatisierten Dateien und die Speicherung personenbezogener Informationen.
Welche Rolle spielt das Schengener Informationssystem (SIS)?
Die Arbeit behandelt das SIS im Kontext des internationalen Informationsaustauschs im Strafverfolgungsbereich und vergleicht es mit dem nationalen System INPOL.
Was ist die "Datei 'Gewalttäter Sport'"?
Die Arbeit analysiert eine konkrete Verbunddatei ("Gewalttäter Sport") als Beispiel für die Funktionsweise von Verbunddateien innerhalb des INPOL-Systems.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: INPOL, Polizeidatenbanken, Fahndungssysteme, Datenschutz, Rechtsgrundlagen, Datenverarbeitung, Schengener Informationssystem (SIS), Verbunddateien, elektronische Datenverarbeitung, föderale Strukturen, Länderkompetenzen.
Welche Herausforderungen werden im Zusammenhang mit INPOL beschrieben?
Die Arbeit beschreibt die Herausforderungen der Einführung eines zentralen EDV-Systems in einem föderalen System, die Zusammenführung unterschiedlicher Landessysteme und den Umgang mit bestehenden Fahndungsdatensätzen. Auch die rechtlichen und datenschutzrechtlichen Herausforderungen werden beleuchtet.
- Arbeit zitieren
- Pierre Schweizer (Autor:in), 2019, Datenbanken und Fahndungssysteme der Polizei, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/496626