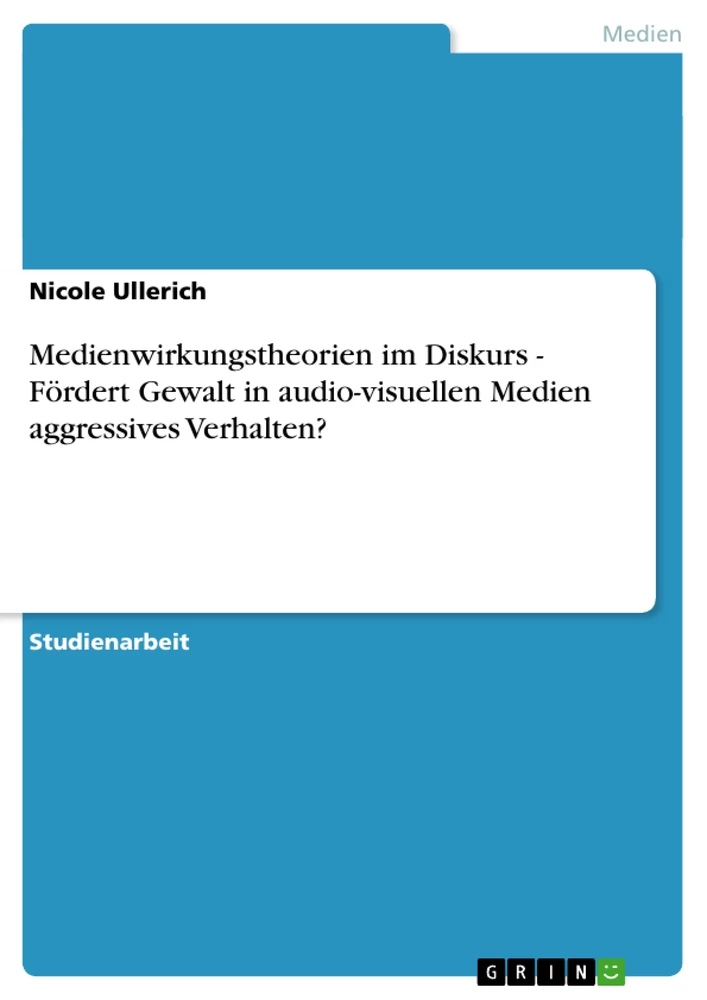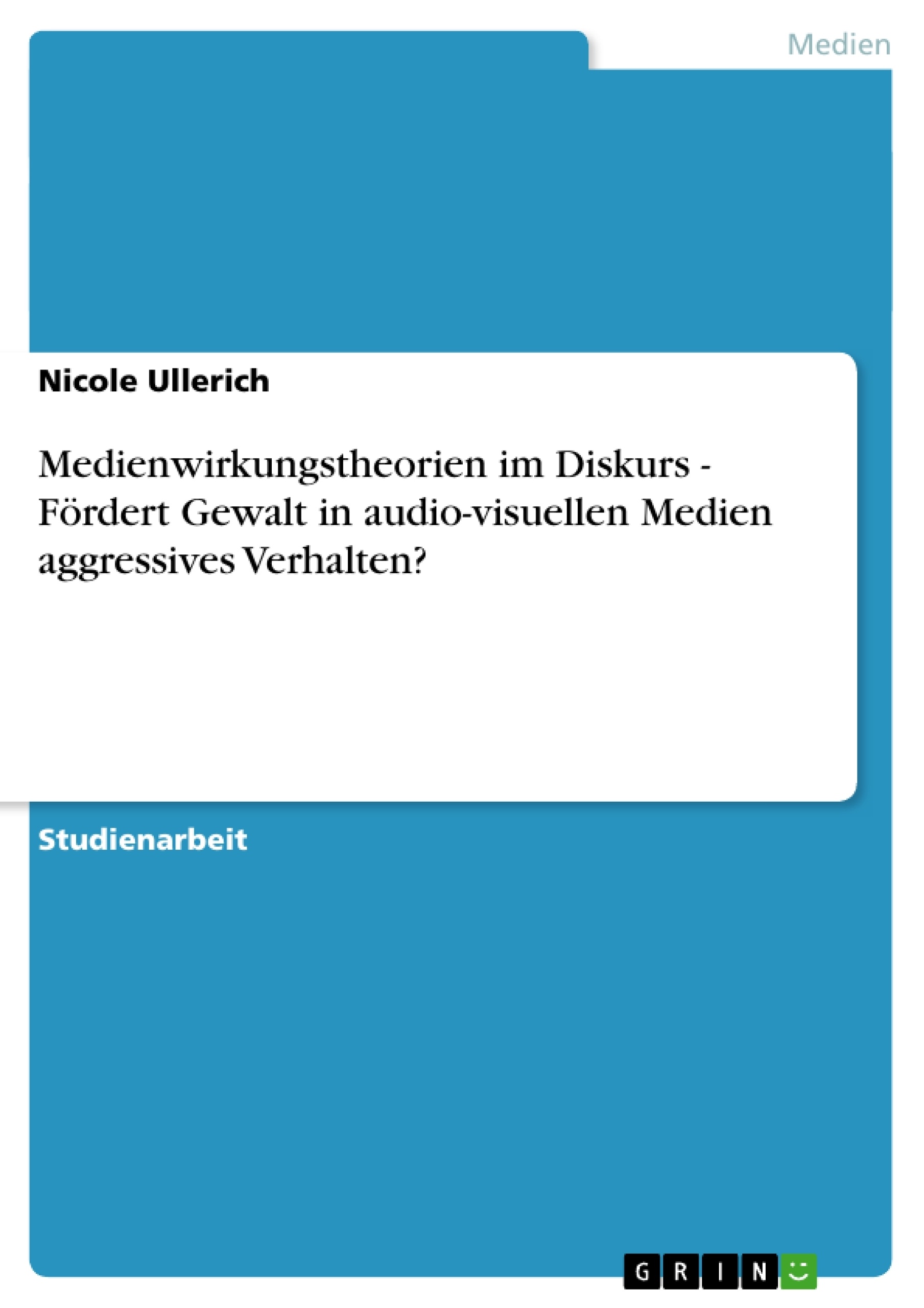In der folgenden Arbeit beschäftige ich mich mit dem Einfluss von Gewalt in Medien auf die Gewaltbereitschaft vor allem bei Jugendlichen. Die unzähligen Überlegungen und Thesen, die hierzu aufgestellt wurden, zeigen, dass dieses Phänomen bis heute nicht geklärt ist und dass es vermutlich immer unterschiedliche Meinungen dazu geben wird, inwiefern die zunehmende Gewalt in Film und Fernsehen ein Argument für die steigende Aggressivität und Gewalttätigkeit ist. Ich persönlich stimme keiner These ohne Einschränkung zu, bin aber überzeugt, dass ein Zusammenhang besteht, der nicht verleugnet werden kann und er bestimmt nicht darin liegt, dass Gewaltdarstellung Gewalt verhindert (s.u.). Nicht ohne Grund hat sich die Anzahl von registrierten Körperverletzungen seit 1970 mehr als verdoppelt. Ich habe selbst in meiner Kindheit infolge einer Überdosis an Bud Spencer und Terence Hill Filmen getestet, wie wirksam die Faust in der Magengegend des Gegners ist. Doch bei mir blieb es bei diesen kurzen Entgleisungen, was andere Jugendliche leider nicht von sich behaupten können.
Im ersten Teil werde ich eine These vorstellen, die meines Erachtens in sich unstimmig, überholt und zudem schon durch diverse Experimente widerlegt ist. Somit möchte ich im zweiten Teil überzeugende Gegenargumente gegen diesen Ansatz bringen und versuchen, tatsächliche Ursachen für die steigende Gewaltbereitschaft bei Jugendlichen zu finden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Katharsis-These
- 3. divergente Ansätze und entkräftende Studien
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss von medial dargestellter Gewalt auf die Gewaltbereitschaft von Jugendlichen. Ziel ist es, die Katharsis-These zu hinterfragen und alternative Erklärungen für steigende Gewaltbereitschaft zu finden. Die Arbeit berücksichtigt dabei die gesellschaftlichen Veränderungen und den Einfluss von Lerntheorien.
- Einfluss von medial dargestellter Gewalt auf Jugendliche
- Kritik und Widerlegung der Katharsis-These
- Alternative Erklärungsansätze für steigende Gewaltbereitschaft
- Rolle von Lerntheorien (Modelllernen, operante Konditionierung)
- Auswirkungen von exzessivem Fernsehkonsum
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema des Einflusses von Gewalt in Medien auf die Gewaltbereitschaft von Jugendlichen ein. Sie stellt die Problematik dar, dass die Frage nach einem Zusammenhang zwischen medialer Gewalt und realer Gewaltbereitschaft bis heute ungeklärt ist und unterschiedliche Meinungen dazu existieren. Die Autorin erwähnt ihre persönliche Überzeugung von einem bestehenden Zusammenhang, lehnt aber eine einseitige These ab und kündigt die kritische Auseinandersetzung mit der Katharsis-These an. Es wird der eigene Bezug der Autorin zu diesem Thema in ihrer Kindheit dargestellt. Die Arbeit gliedert sich in die Vorstellung der Katharsis-These, die Präsentation von Gegenargumenten und die Suche nach Ursachen für steigende Gewaltbereitschaft.
2. Die Katharsis-These: Dieses Kapitel befasst sich mit der Katharsis-These, die besagt, dass das passive Erleben von Gewalt in Medien angestaute Aggressionen abbaut und somit reale Gewalttätigkeit reduziert. Die Autorin präsentiert verschiedene Ansätze zur Bestätigung dieser These, welche jedoch empirisch widerlegt wurden. Es werden Studien und Experimente erwähnt, die eher aggressionshemmende Faktoren hervorheben. Die Autorin kritisiert die Popularität der Katharsis-These bei Medienproduzenten und deren Nutzung zur Rechtfertigung gewalttätiger Inhalte, trotz fehlender empirischer Belege. Die These wird als in sich unstimmig, überholt und durch diverse Experimente widerlegt dargestellt.
3. divergente Ansätze und entkräftende Studien: Dieses Kapitel präsentiert Gegenargumente zur Katharsis-These. Es wird der gesellschaftliche Wandel seit der Entstehung der These und die heutige Mediennutzung, insbesondere der hohe Fernsehkonsum, hervorgehoben. Die „Vielseherproblematik“ und die Ergebnisse einer Langzeitstudie der Columbia Universität, die einen Zusammenhang zwischen exzessivem Fernsehkonsum und erhöhter Gewaltbereitschaft aufzeigt, werden diskutiert. Das Kapitel stellt Lerntheorien, insbesondere das Modelllernen und die operante Konditionierung, als bedeutende alternative Erklärungen für Gewaltimitation vor und erläutert Banduras Experiment zum Modellernen als Beispiel für diese Theorien.
Schlüsselwörter
Mediale Gewalt, Gewaltbereitschaft, Jugendliche, Katharsis-These, Lerntheorien, Modelllernen, Operante Konditionierung, Fernsehkonsum, Aggressivität, Gewaltdarstellung.
Häufig gestellte Fragen zum Text: Einfluss von medial dargestellter Gewalt auf Jugendliche
Was ist das Thema des Textes?
Der Text untersucht den Einfluss von medial dargestellter Gewalt auf die Gewaltbereitschaft von Jugendlichen. Im Mittelpunkt steht die kritische Auseinandersetzung mit der Katharsis-These und die Suche nach alternativen Erklärungen für steigende Gewaltbereitschaft.
Welche Aspekte werden im Text behandelt?
Der Text behandelt die Katharsis-These, ihre empirische Widerlegung und alternative Erklärungsansätze wie Lerntheorien (Modelllernen, operante Konditionierung). Er berücksichtigt gesellschaftliche Veränderungen und den Einfluss von exzessivem Fernsehkonsum. Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, eine detaillierte Betrachtung der Katharsis-These, die Präsentation divergierender Ansätze und Studien, die diese These widerlegen, und abschließend ein Fazit.
Was ist die Katharsis-These und wie wird sie im Text bewertet?
Die Katharsis-These besagt, dass das passive Erleben von Gewalt in Medien angestaute Aggressionen abbaut und somit reale Gewalttätigkeit reduziert. Der Text präsentiert die These, kritisiert jedoch ihre empirische Grundlage und zeigt auf, dass sie durch diverse Studien widerlegt wurde. Die Popularität der These bei Medienproduzenten zur Rechtfertigung gewalttätiger Inhalte wird ebenfalls kritisiert.
Welche alternativen Erklärungen für steigende Gewaltbereitschaft werden angeboten?
Der Text nennt als alternative Erklärungen den gesellschaftlichen Wandel, den hohen Fernsehkonsum ("Vielseherproblematik") und vor allem Lerntheorien wie Modelllernen und operante Konditionierung. Banduras Experiment zum Modellernen wird als Beispiel angeführt.
Welche Studien werden erwähnt?
Der Text erwähnt eine Langzeitstudie der Columbia Universität, die einen Zusammenhang zwischen exzessivem Fernsehkonsum und erhöhter Gewaltbereitschaft aufzeigt. Zusätzlich werden verschiedene, nicht näher benannte Studien und Experimente erwähnt, die die Katharsis-These widerlegen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Text?
Schlüsselwörter sind: Mediale Gewalt, Gewaltbereitschaft, Jugendliche, Katharsis-These, Lerntheorien, Modelllernen, Operante Konditionierung, Fernsehkonsum, Aggressivität, Gewaltdarstellung.
Wie ist der Text aufgebaut?
Der Text ist in Kapitel gegliedert: Einleitung, Die Katharsis-These, Divergente Ansätze und entkräftende Studien und ein Fazit (nicht im Detail beschrieben). Er enthält ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
Welche Schlussfolgerung zieht der Text?
Der Text zieht die Schlussfolgerung, dass die Katharsis-These nicht haltbar ist und alternative Erklärungen für steigende Gewaltbereitschaft, insbesondere Lerntheorien und exzessiver Medienkonsum, berücksichtigt werden müssen. Eine detaillierte Schlussfolgerung ist nicht explizit im Text angegeben.
- Arbeit zitieren
- Nicole Ullerich (Autor:in), 2005, Medienwirkungstheorien im Diskurs - Fördert Gewalt in audio-visuellen Medien aggressives Verhalten?, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/49587