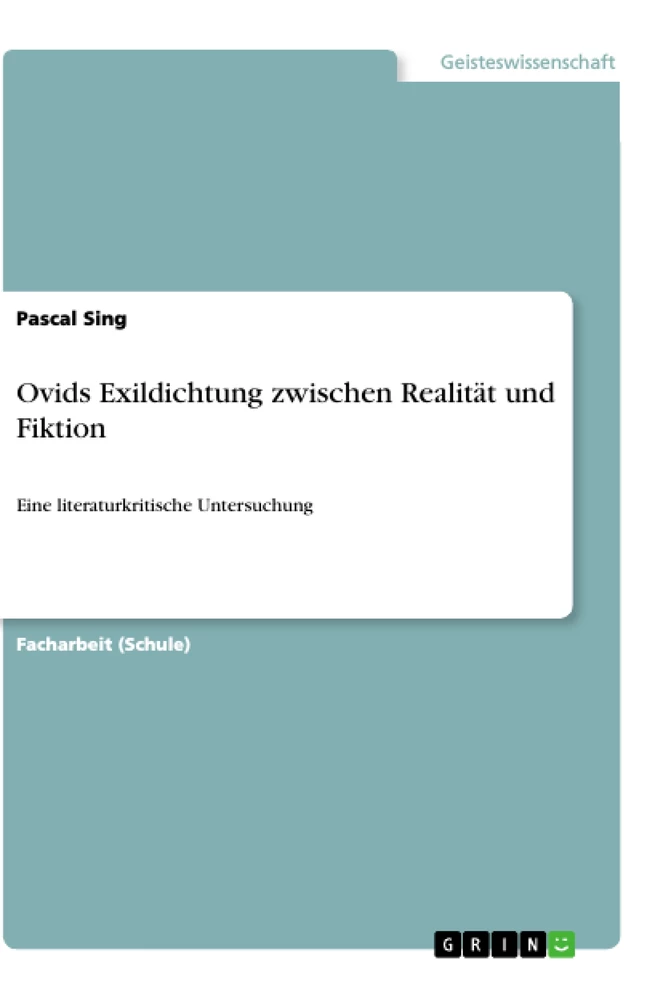Ziel dieser Arbeit war eine Analyse der ovidischen Darstellung seines Exilorts Tomi im Hinblick auf deren Realitätsgehalt unter Berücksichtigung literarischer und externer Gesichtspunkte wie archäologischer, ethnologischer, historischer und klimatischer Befunde. Ein besonderes Augenmerk galt dabei der literarisch interessanten Frage, inwiefern Ovid in seinen beiden Exilwerken das Motiv eines locus horribilis für seinen Verbannungsort entworfen haben könnte.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung: Ovids pontische Dichtung als historische Quelle?
- 2 Analyse von Ovids Schilderungen der Schwarzmeerregion
- 2.1 Namensgebung und Gründungsmythos von Tomi bei Ovid
- 2.2 Vorstellung Ovids von seinem Verbannungsort und dessen geographische Verortung
- 2.3 Ovids Schilderung der Lebensumstände in Tomi
- 2.3.1 Erfahrung einer Landschaftsgrenze
- 2.3.2 Erfahrung einer Klimagrenze
- 2.3.3 Erfahrung einer ethnischen Grenze
- 2.3.4 Erfahrung einer Militärgrenze
- 2.3.5 Erfahrung einer Sprachgrenze
- 2.4 Reale Lebensumstände in Tomi zu Zeiten Ovids
- 2.5 Ovids Angaben auf dem Prüfstand der Bevölkerung in Tomi
- 3 Fazit: Ovids Dichtkunst zwischen Realität und Fiktion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Ovids Exildichtung, insbesondere die Tristia und die Epistulae ex Ponto, auf ihren Realitätsgehalt. Sie analysiert, inwieweit Ovids Schilderungen seines Verbannungsortes Tomi am Schwarzen Meer faktischen Gegebenheiten entsprechen oder ob er diesen Ort literarisch stilisiert. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Frage, ob Ovid den Topos des "locus amoenus" in ein Gegenbild, einen "locus horribilis", umkehrt.
- Ovids Verbannung nach Tomi und die Beweggründe dafür
- Analyse von Ovids Beschreibungen der Schwarzmeerregion und der Lebensumstände in Tomi
- Vergleich von Ovids Darstellung mit historischen und archäologischen Befunden
- Die Frage nach dem Realitätsgehalt von Ovids Exildichtung
- Die mögliche Verwendung des Topos des "locus horribilis" in Ovids Werk
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Ovids pontische Dichtung als historische Quelle?: Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Verhältnis von Realität und Fiktion in Ovids Exildichtung. Sie beschreibt Ovids Verbannung nach Tomi im Jahre 8 n. Chr. durch Kaiser Augustus und beleuchtet die umstrittenen Gründe für diese Entscheidung – Andeutungen auf ein verwerfliches Gedicht (Ars Amatoria) und eine unbekannte Indiskretion, möglicherweise im Zusammenhang mit der kaiserlichen Familie. Die Einleitung betont, dass Ovid mit seinen Exilwerken (Tristia und Epistulae ex Ponto) sowohl einen Gnadenerlass erhoffte als auch seine fortbestehende dichterische Fähigkeit demonstrierte. Schließlich wird die Forschungsfrage formuliert: Inwieweit entspricht Ovids Darstellung Tomis den tatsächlichen Gegebenheiten, oder handelt es sich um eine literarische Stilisierung, möglicherweise eine Umkehrung des "locus amoenus"-Topos?
2 Analyse von Ovids Schilderungen der Schwarzmeerregion: Dieses Kapitel analysiert detailliert Ovids Schilderungen der Schwarzmeerregion, insbesondere Tomi. Es untersucht die Namensgebung Tomis im Kontext des Gründungsmythos, der den Mord an Absyrtos durch Medea beinhaltet. Ovid verbindet den Namen Tomi etymologisch mit dem griechischen Verb "témnein" (schneiden, zerteilen), um den Ort als "locus horribilis" darzustellen. Das Kapitel untersucht daraufhin Ovids Beschreibungen der Lebensumstände in Tomi, indem es die verschiedenen Grenzerfahrungen (Landschaft, Klima, Ethnie, Militär, Sprache) analysiert. Im weiteren Verlauf wird Ovids Darstellung mit realen Gegebenheiten der damaligen Zeit verglichen. Die Analyse zielt darauf ab, die strategische Verwendung literarischer Mittel durch Ovid zu beleuchten und das Verhältnis zwischen seiner Darstellung und den historischen Fakten zu bestimmen. Es wird also zwischen der subjektiven Wahrnehmung Ovids und den objektiven Bedingungen seines Exils unterschieden.
Schlüsselwörter
Ovid, Exildichtung, Tomi, Pontus Euxinus, Tristia, Epistulae ex Ponto, Realität, Fiktion, locus amoenus, locus horribilis, Ars Amatoria, Augustus, Migrationsgeschichte, Literaturkritik, Interpretationsmuster.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Ovids Pontische Dichtung als Historische Quelle?
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht Ovids Exildichtung, insbesondere die Tristia und die Epistulae ex Ponto, auf ihren Realitätsgehalt. Es wird analysiert, inwieweit Ovids Schilderungen seines Verbannungsortes Tomi am Schwarzen Meer faktischen Gegebenheiten entsprechen oder ob er diesen Ort literarisch stilisiert. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Frage, ob Ovid den Topos des "locus amoenus" in ein Gegenbild, einen "locus horribilis", umkehrt.
Welche Aspekte von Ovids Exildichtung werden untersucht?
Die Arbeit analysiert detailliert Ovids Beschreibungen der Schwarzmeerregion und der Lebensumstände in Tomi. Dazu gehören die Namensgebung und der Gründungsmythos von Tomi, Ovids Vorstellung von seinem Verbannungsort und dessen geographische Verortung, sowie seine Schilderung der Lebensumstände in Tomi unter verschiedenen Aspekten (Landschaft, Klima, Ethnie, Militär, Sprache). Ein Vergleich mit historischen und archäologischen Befunden wird durchgeführt, um den Realitätsgehalt von Ovids Darstellung zu überprüfen.
Welche Forschungsfrage steht im Mittelpunkt?
Die zentrale Forschungsfrage ist: Inwieweit entspricht Ovids Darstellung Tomis den tatsächlichen Gegebenheiten, oder handelt es sich um eine literarische Stilisierung, möglicherweise eine Umkehrung des "locus amoenus"-Topos? Die Arbeit untersucht das Verhältnis von Realität und Fiktion in Ovids Exildichtung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit besteht aus drei Kapiteln: Kapitel 1 (Einleitung) führt in das Thema ein und stellt die Forschungsfrage. Kapitel 2 (Analyse von Ovids Schilderungen) analysiert detailliert Ovids Beschreibungen der Schwarzmeerregion und Tomis, inklusive eines Vergleichs mit historischen Fakten. Kapitel 3 (Fazit) fasst die Ergebnisse zusammen und diskutiert das Verhältnis von Realität und Fiktion in Ovids Werk.
Welche Rolle spielt der "locus amoenus" / "locus horribilis" Topos?
Die Arbeit untersucht, ob Ovid den Topos des "locus amoenus" (der angenehme Ort) in ein Gegenbild, den "locus horribilis" (der schreckliche Ort), umkehrt, um seine Situation in Tomi darzustellen. Dies ist ein wichtiger Aspekt der literarischen Analyse von Ovids Exildichtung.
Welche historischen und archäologischen Quellen werden berücksichtigt?
Die Arbeit vergleicht Ovids Darstellung Tomis mit den realen Gegebenheiten der damaligen Zeit. Der genaue Umfang der verwendeten historischen und archäologischen Quellen wird im Haupttext detailliert beschrieben.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Ovid, Exildichtung, Tomi, Pontus Euxinus, Tristia, Epistulae ex Ponto, Realität, Fiktion, locus amoenus, locus horribilis, Ars Amatoria, Augustus, Migrationsgeschichte, Literaturkritik, Interpretationsmuster.
Warum wurde Ovid nach Tomi verbannt?
Ovids Verbannung nach Tomi im Jahre 8 n. Chr. durch Kaiser Augustus erfolgte aufgrund von Andeutungen auf ein verwerfliches Gedicht (Ars Amatoria) und einer unbekannten Indiskretion, möglicherweise im Zusammenhang mit der kaiserlichen Familie. Die genauen Gründe bleiben umstritten.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, das Verhältnis von Realität und Fiktion in Ovids Exildichtung zu klären und die literarischen Strategien Ovids bei der Darstellung seines Verbannungsortes zu analysieren. Sie untersucht die Frage, inwieweit seine Werke als historische Quellen genutzt werden können.
- Quote paper
- Pascal Sing (Author), 2019, Ovids Exildichtung zwischen Realität und Fiktion, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/494194