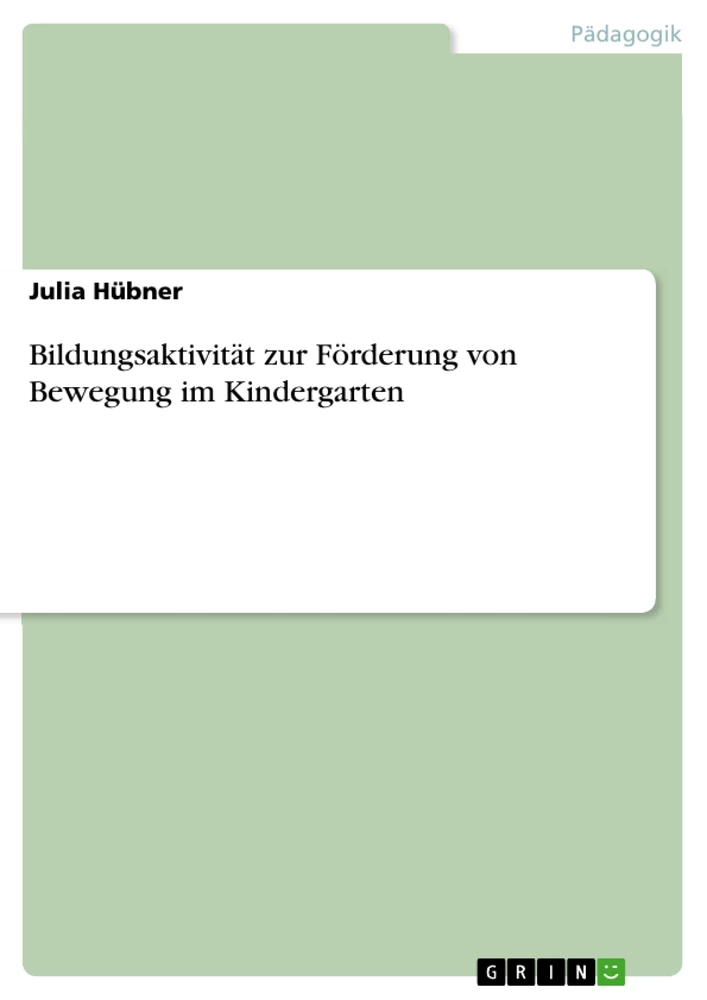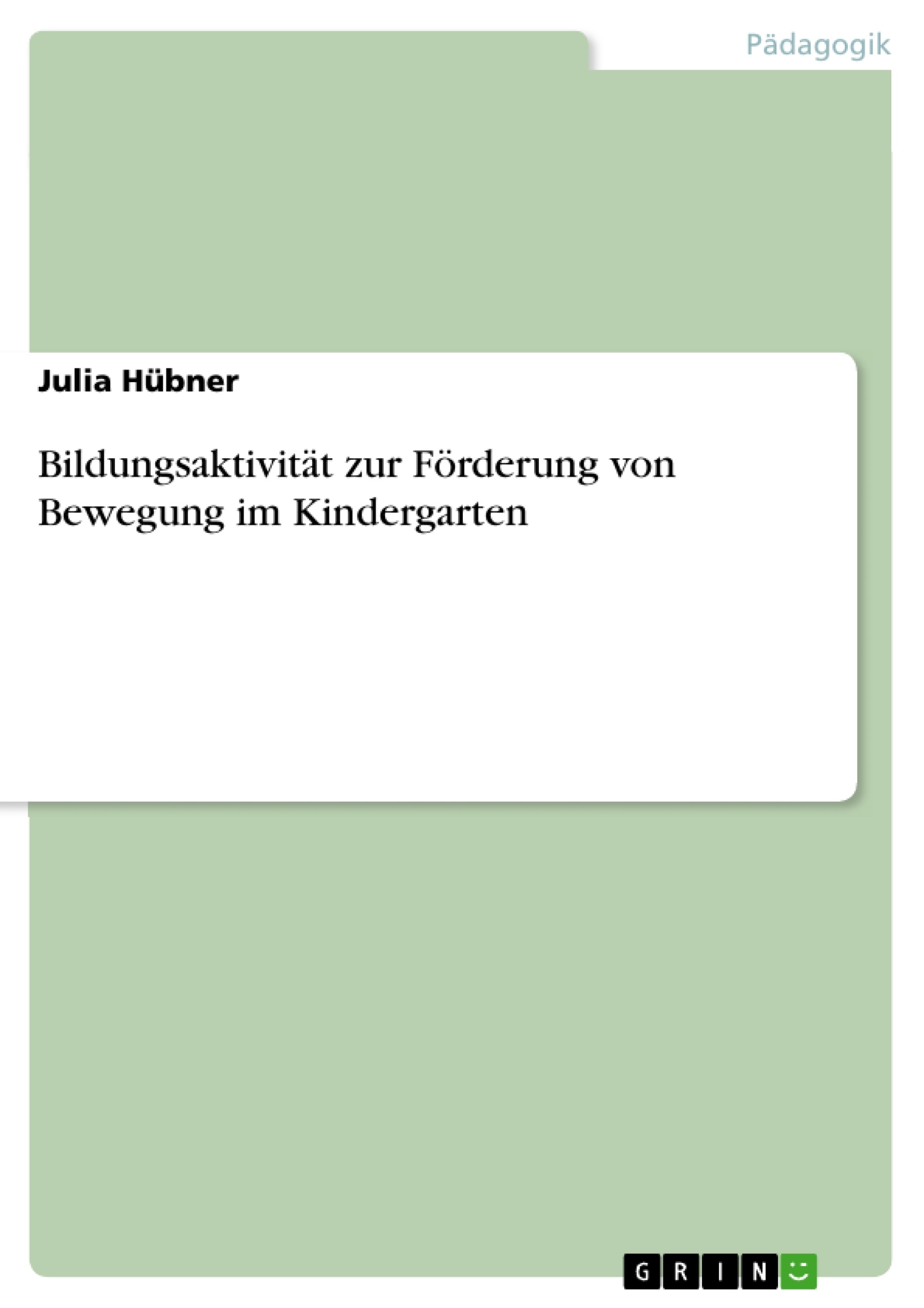Thema dieser Ausarbeitung ist die schriftliche Vorbereitung einer Bildungsaktivität für Kindergartenkinder.
In der Bewegungsbaustelle geschieht die Bewegung in einer chronologischen und von mir durch die Hindernisse vorgegebenen Reihenfolge. Die Bewegung geschieht dadurch bewusst und gezielt, da die Kinder Schritt für Schritt die einzelnen Hürden nehmen, sie kommen nicht umhin, hierbei über die Art und Weise ihrer Bewegungshandlung nachzudenken.
Die Konzentration wird dadurch gefördert und die Kinder setzen sich aktiv mit ihrem Körper auseinander.
Die Bildungsaktivität bedeutet für die Kinder Spaß und Freude am Entdecken der motorischen Fähigkeiten. Durch die Aktivität erleben sie die Bewegungsabläufe positiv, sind keinem Leistungszwang und keinem Druck ausgesetzt. Ihnen ist somit die Möglichkeit gegeben, ihren Enthusiasmus in der Bewegung beizubehalten und weiter zu entwickeln.
Inhaltsverzeichnis
- Das Bildungsthema des Kindes
- Thema der gewählten Bildungsaktivität
- Ziele der Bildungsaktivität
- Richtziel: Ich-Kompetenz
- Grobziel: Verbesserung der motorischen Urteils- und Handlungsfähigkeit
- Feinziele:
- Fähigkeitsziel: Selbsteinschätzung der körperlichen Fähigkeiten
- Erkenntnisziel: Erkennen motorischer Stärken und Schwächen
- Die Gruppe
- Die Sachanalyse
- Zum Sachthema: Bewegung als Fundament der Entwicklung
- Zum Angebot: Vorplanung und Durchführung
- Die Aktivität: Ablaufbeschreibung
- Die Geschichte
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschreibt die schriftliche Vorbereitung einer Bildungsaktivität für eine Kleinkindgruppe im Alter von 2-3 Jahren. Ziel ist die Verbesserung der motorischen Fähigkeiten der Kinder im Kontext einer spielerischen Bewegunglandschaft mit Feuerwehr-Thema. Die Aktivität soll die Ich-Kompetenz der Kinder fördern und ihnen helfen, ihre eigenen körperlichen Stärken und Schwächen einzuschätzen.
- Motorische Entwicklung und Förderung
- Integration von Kindern mit unterschiedlichen Bedürfnissen und Entwicklungsstufen
- Spielerisches Lernen durch thematischen Kontext (Feuerwehr)
- Entwicklung von Selbstbewusstsein und Selbstwirksamkeit
- Pädagogische Planung und Reflexion
Zusammenfassung der Kapitel
Das Bildungsthema des Kindes: Dieses Kapitel beschreibt das individuelle Bildungsthema eines Kindes (Mick) der Kleinkindgruppe, welches durch Beobachtung im Freispiel als "Körper und Motorik" identifiziert wird. Die Vorliebe des Kindes für Bewegung, insbesondere Klettern, Springen, Laufen und das Fahren mit dem Dreirad, wird hervorgehoben. Die Beobachtung zeigt auch die kreative Auseinandersetzung des Kindes mit dem Thema Feuerwehr, was als Inspiration für die Gestaltung der geplanten Bildungsaktivität dient.
Thema der gewählten Bildungsaktivität: Hier wird das Thema der geplanten Bildungsaktivität – Bewegung – detailliert eingeführt. Die Beobachtungen des Kindes Mick, insbesondere seine Begeisterung für das Klettern, Springen, Laufen und Dreiradfahren, sowie seine Assoziation von Bewegung mit dem Thema Feuerwehr, bilden die Grundlage für die Entwicklung einer Bewegungslandschaft mit Feuerwehr-Elementen. Die Aktivität soll die motorischen Fähigkeiten des Kindes fördern und gleichzeitig seine Kreativität und Fantasie anregen.
Ziele der Bildungsaktivität: Das Kapitel definiert die Ziele der Bildungsaktivität, die auf die Förderung der Ich-Kompetenz und die Verbesserung der motorischen Urteils- und Handlungsfähigkeit des Kindes abzielen. Konkrete Feinziele umfassen die Selbsteinschätzung der körperlichen Fähigkeiten und das Erkennen der eigenen motorischen Stärken und Schwächen. Diese Ziele sollen durch die Gestaltung der Bewegungslandschaft und die Integration einer Geschichte zum Thema Feuerwehr erreicht werden.
Die Gruppe: Dieses Kapitel stellt die Kinder der Kleinkindgruppe vor, bestehend aus vier Jungen im Alter von 2-3 Jahren. Die individuellen Charakteristika und Entwicklungsstufen der Kinder (Mick, Keith, Charlie, Falco) werden beschrieben, wobei insbesondere Mögliche Herausforderungen und Bedürfnisse einzelner Kinder (z.B. Sprachprobleme bei Falco, Konzentrationsschwierigkeiten bei Keith, Schüchternheit bei Charlie) im Hinblick auf die geplante Aktivität thematisiert werden. Die Beschreibung verdeutlicht die Notwendigkeit einer individuellen Förderung der Kinder innerhalb der Gruppenaktivität.
Die Sachanalyse: Dieser Abschnitt beleuchtet den theoretischen Hintergrund der Bildungsaktivität. Er betont die Bedeutung von Bewegung für die ganzheitliche Entwicklung des Kindes (physisch, psychisch, kognitiv, sozial) und beschreibt die Entwicklung der Basissinne in Zusammenhang mit Bewegung. Der zweite Teil des Kapitels dokumentiert den Planungsprozess der Bewegungslandschaft, inklusive der Anpassungen aufgrund von räumlichen Gegebenheiten und Testläufen mit einzelnen Kindern. Die Reflexion über den Prozess der Planung und die Anpassung der Aktivität an die Gegebenheiten der Einrichtung zeigen ein professionelles Vorgehen.
Die Aktivität: Der Ablauf der Bildungsaktivität wird detailliert beschrieben, von der Begrüßung der Kinder bis zum Abschluss. Die Aktivität kombiniert eine Bewegungslandschaft mit einer Geschichte zum Thema Feuerwehr, wobei die Kinder aktiv in die Rolle der Feuerwehrmänner schlüpfen und verschiedene motorische Aufgaben bewältigen. Die detaillierte Beschreibung des Ablaufs verdeutlicht den didaktisch-methodischen Ansatz der Aktivität.
Schlüsselwörter
Bewegungslandschaft, motorische Entwicklung, Kleinkindgruppe, Feuerwehr, Ich-Kompetenz, Selbsteinschätzung, spielerisches Lernen, Integration, inklusive Pädagogik, Bewegungsgeschichte.
Häufig gestellte Fragen (FAQs): Bildungsaktivität für Kleinkinder (2-3 Jahre) - Thema Feuerwehr
Was ist der allgemeine Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit dokumentiert die detaillierte Planung und Durchführung einer spielerischen Bewegunglandschaft mit Feuerwehr-Thema für eine Kleinkindgruppe im Alter von 2-3 Jahren. Sie beinhaltet die Zielsetzung, die Beschreibung der Kindergruppe, die Sachanalyse, den Ablauf der Aktivität und eine Reflexion des gesamten Prozesses. Der Fokus liegt auf der Förderung der motorischen Fähigkeiten und der Ich-Kompetenz der Kinder.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die motorische Entwicklung und Förderung von Kleinkindern, die Integration von Kindern mit unterschiedlichen Bedürfnissen, spielerisches Lernen im thematischen Kontext (Feuerwehr), die Entwicklung von Selbstbewusstsein und Selbstwirksamkeit sowie pädagogische Planung und Reflexion.
Welche Ziele werden mit der Bildungsaktivität verfolgt?
Hauptziel ist die Verbesserung der motorischen Urteils- und Handlungsfähigkeit der Kinder. Als übergeordnetes Ziel wird die Förderung der Ich-Kompetenz angestrebt. Konkrete Feinziele beinhalten die Selbsteinschätzung der körperlichen Fähigkeiten und das Erkennen der eigenen motorischen Stärken und Schwächen.
Wie ist die Kindergruppe zusammengesetzt?
Die Gruppe besteht aus vier Jungen im Alter von 2-3 Jahren (Mick, Keith, Charlie, Falco) mit individuellen Charakteristika und Entwicklungsstufen. Die Arbeit berücksichtigt die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kinder, wie z.B. Sprachprobleme, Konzentrationsschwierigkeiten oder Schüchternheit.
Welche Sachanalyse liegt der Bildungsaktivität zugrunde?
Die Sachanalyse betont die Bedeutung von Bewegung für die ganzheitliche Entwicklung des Kindes und beschreibt den Planungsprozess der Bewegungslandschaft, inklusive der Anpassungen aufgrund von räumlichen Gegebenheiten und Testläufen. Der theoretische Hintergrund beleuchtet die Entwicklung der Basissinne im Zusammenhang mit Bewegung.
Wie ist der Ablauf der Bildungsaktivität?
Der Ablauf wird detailliert beschrieben, von der Begrüßung bis zum Abschluss. Die Aktivität kombiniert eine Bewegungslandschaft mit einer Geschichte zum Thema Feuerwehr, wobei die Kinder aktiv in die Rolle der Feuerwehrmänner schlüpfen und verschiedene motorische Aufgaben bewältigen.
Welches Kind wird als Beispiel verwendet?
Das Kind Mick wird als Beispiel herangezogen, um das individuelle Bildungsthema "Körper und Motorik" zu veranschaulichen. Seine Vorliebe für Bewegung und die Assoziation mit dem Thema Feuerwehr dienten als Inspiration für die Gestaltung der Aktivität.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Bewegungslandschaft, motorische Entwicklung, Kleinkindgruppe, Feuerwehr, Ich-Kompetenz, Selbsteinschätzung, spielerisches Lernen, Integration, inklusive Pädagogik, Bewegungsgeschichte.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit richtet sich an Fachkräfte im Bereich der frühkindlichen Bildung, Erzieher*innen, Studierende der Pädagogik und alle Interessierten, die sich mit der Planung und Durchführung von Bewegungseinheiten für Kleinkinder beschäftigen.
- Arbeit zitieren
- Julia Hübner (Autor:in), 2016, Bildungsaktivität zur Förderung von Bewegung im Kindergarten, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/491519