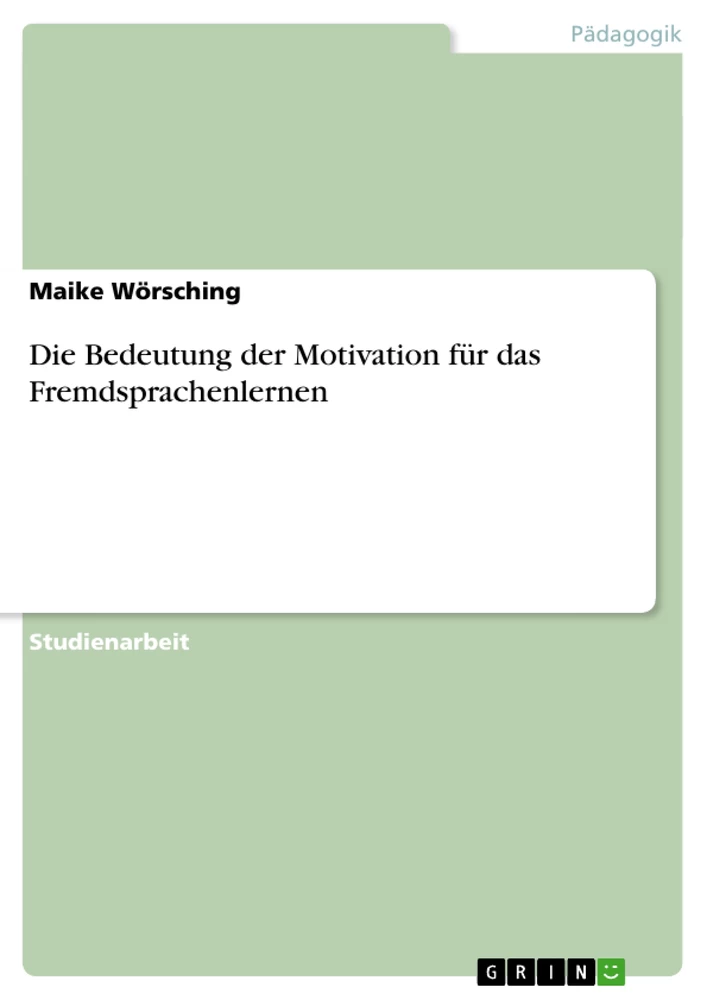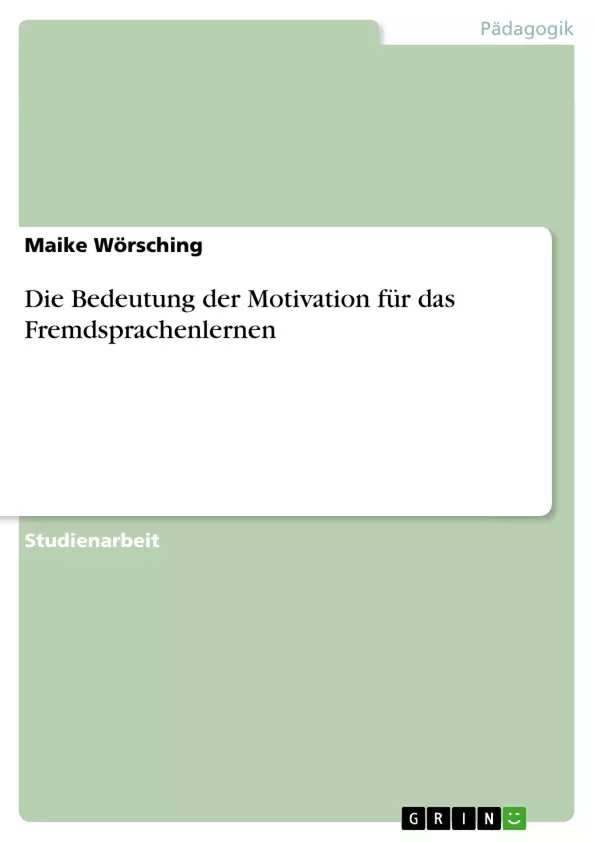Der Begriff Motivation wird im alltäglichen Sprachgebrauch sehr häufig verwendet. Nahezu jeder kann sich etwas unter diesem Begriff vorstellen. Diese Vorstellungen sind allerdings oft sehr vage und es ist nicht leicht, den Begriff richtig zu definieren. Gerade in Bezug auf die Schule und in diesem Fall den Fremdsprachenunterricht spielt Motivation jedoch eine große Rolle, was es nötig macht, genau darüber Bescheid zu wissen. Aus diesem Grund möchte ich die vorliegende Arbeit mit einer kurzen Definition des Begriffes beginnen. Weiterhin werde ich darstellen, warum die Motivation der Schüler für den Unterricht so bedeutsam ist.
In diesem Zusammenhang möchte ich den Begriff Motivation in einzelne Faktoren gliedern, was allerdings keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, da das sicher den Rahmen der Arbeit gesprengt hätte. Es werden vor allem die Faktoren dargestellt, die sich auf den Lehrer und die Unterrichtsumgebung beziehen. Folglich hat der Lehrer, soweit er die Bedeutung des jeweiligen Faktors in Bezug auf die Demotivierung eines Kindes erkannt hat, die Möglichkeit, an diesem etwas zu ändern und somit günstig auf den Lernerfolg des Schülers einzuwirken. Somit kann diese Arbeit als Anstoß dienen, die Bandbreite der Motivation eines Schülers zu überblicken und damit nach den Ursachen einer eventuellen Lernschwäche zu forschen.
Inhaltsverzeichnis
- 1.) Einleitung
- 2.) Motivation
- 3.) Die Bedeutung der Motivation für den Unterricht
- 3.1) Die Unterrichts- bzw. Lernsituation, Lehr- und Lernmaterialien
- 3.2) Die Lerngruppe
- 3.3) Der Lehrer
- 3.4) Motive und Zielsetzungen des Lerners
- 3.5) Einstellungen des Lerners
- 4.) Resümee
- 5.) Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Bedeutung der Motivation für das Fremdsprachenlernen, insbesondere im schulischen Kontext. Sie analysiert verschiedene Faktoren, die die Motivation von Schülern beeinflussen, und untersucht deren Auswirkungen auf den Lernerfolg. Ziel ist es, ein tieferes Verständnis für die Bedeutung der Motivation im Fremdsprachenunterricht zu gewinnen und Handlungsmöglichkeiten für Lehrkräfte aufzuzeigen.
- Definition des Begriffs Motivation und seine Relevanz im Fremdsprachenunterricht
- Unterschiedliche Arten von Motivation: intrinsische und extrinsische Motivation
- Einflussfaktoren auf die Motivation von Schülern im Fremdsprachenunterricht, wie z.B. die Unterrichtsgestaltung, die Lerngruppe und der Lehrer
- Analyse der Beziehung zwischen Motivation und Lernerfolg
- Mögliche Handlungsmöglichkeiten für Lehrkräfte, um die Motivation von Schülern im Fremdsprachenunterricht zu fördern
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Motivation im Fremdsprachenunterricht ein und erläutert die Relevanz des Begriffs. Im zweiten Kapitel wird die Motivation als ein komplexer Begriff definiert, der verschiedene Eigenschaften und Einstellungen eines Lerners umfasst, die den Lernerfolg beeinflussen. Es wird die Unterscheidung zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation aufgezeigt.
Das dritte Kapitel behandelt die Bedeutung der Motivation für den Unterricht. Es werden verschiedene Faktoren untersucht, die die Motivation von Schülern beeinflussen, darunter die Unterrichtsgestaltung, die Lerngruppe, der Lehrer, die Motive und Zielsetzungen des Lerners sowie die Einstellungen des Lerners.
Schlüsselwörter
Motivation, Fremdsprachenlernen, intrinsische Motivation, extrinsische Motivation, Unterrichtsgestaltung, Lerngruppe, Lehrer, Lernerfolg, Handlungsmöglichkeiten
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Motivation im Fremdsprachenunterricht so wichtig?
Motivation ist der entscheidende Faktor für den Lernerfolg. Sie bestimmt, mit welcher Ausdauer und Intensität Schüler eine neue Sprache erlernen.
Was ist der Unterschied zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation?
Intrinsische Motivation kommt aus dem inneren Interesse an der Sache selbst, während extrinsische Motivation durch äußere Anreize wie Noten oder Belohnungen entsteht.
Welchen Einfluss hat der Lehrer auf die Schülermotivation?
Der Lehrer beeinflusst die Motivation durch seine Persönlichkeit, die Gestaltung der Unterrichtsatmosphäre und die Auswahl der Lehrmaterialien maßgeblich.
Wie wirken sich Lehr- und Lernmaterialien aus?
Ansprechende, relevante und abwechslungsreiche Materialien können das Interesse steigern, während veraltete oder zu schwere Inhalte demotivierend wirken.
Können Lernschwächen durch mangelnde Motivation entstehen?
Ja, eine dauerhafte Demotivierung kann zu Lernrückständen führen. Daher ist es wichtig, die Ursachen für Motivationsverluste frühzeitig zu identifizieren.
- Arbeit zitieren
- Maike Wörsching (Autor:in), 2005, Die Bedeutung der Motivation für das Fremdsprachenlernen, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/49118