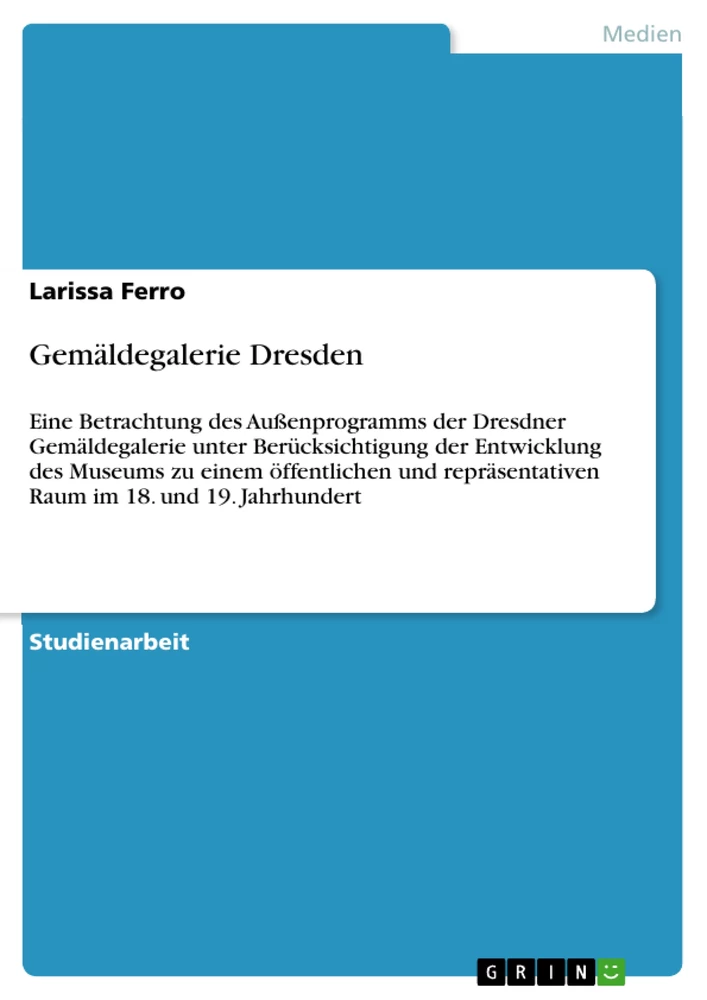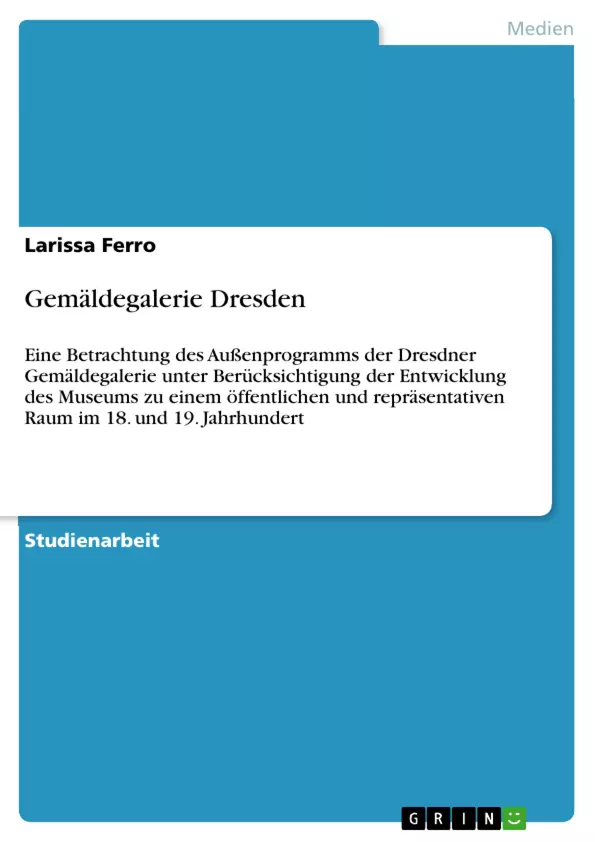Die Gemäldegalerie Dresden, oder genauer die Gemäldegalerie Alte Meister, gehört heute zur Staatlichen Kunstsammlung Dresden. Gemeinsam mit der Porzellansammlung und dem Mathematisch-Physikalischen Salon ist sie im Zwinger mit dem sogenannten Semperbau untergebracht. Wie der Name bereits vermuten lässt, wurde er nach Plänen von Gottfried Semper zwischen 1847 bis 1855 gebaut. Diese Unterbringung im Galeriegebäude, dem Semperbau, ist bereits die dritte Beheimatung der Sammlung, deren Sammlungsschwerpunkte Hauptwerke der italienischen Renaissancemalerei wie Raffael, Giorgione, Tizian und Correggio, sowie kunsthistorisch bedeutende Werke altdeutscher und altniederländsicher Maler und auch Werke des 17. Jahrhunderts holländischer und flämischer Künstler, wie beispielsweise Rembrandt und seiner Schule beherbergen.
Der Bestand ist das Ergebnis einer Sammelleidenschaft, die auf zwei Kurfürsten in Sachsen zurückgeht: Friedrich August I. (reg. 1694-1733), genannt August der Starke und dessen Sohn August II. (reg. 1733-1763). Mit deren Ankauf- und Sammlungspolitik haben sich beispielsweise Hirth 1900 des im selben Jahr erschienenen Galeriekatalog, sowie Hans Posse 1937 und 1951 beschäftigt. Ebenso hat Katharina Pilz mit ihrem Beitrag in Bénédicte Savoys "Tempel der Kunst", erschienen 2006, der Sammlungsgeschichte, inklusive der wichtigsten Ankäufen bis 1815, Ankaufpolitik und dem Umfang und Charakter der Sammlung um 1800 einige informative und übersichtliche Abschnitte gewidmet. Sie bezieht sich hierbei auf die kurfürstliche Sammlung, die sich bis etwa 1745 im Residenzschloss und anschließend in dem eigens für die sich stark vergrößernde Sammlung umgebauten Stallgebäude befand.
Volker Plagemann hingegen widmet sich in den sechziger Jahren der Entstehung dessen, was auch noch in heutigem Verständnis das Museum per se ausmacht: Ein Gebäude zur Beherbergung und Ausstellung von Kunstsammlungen/-werken, zugänglich für ein Publikum mit Interesse, sei es professioneller Natur oder aus laienhaftem Erlebniswunsch.
(...)
Die Vorläufer und Wurzeln der uns heute als Museum bekannten Aufbewahrungsräume, sind der königlichen Sammelleidenschaft des 16. Jahrhunderts zu verdanken. Damalige Herrscher stellten alles, was ihnen staunenswert, selt- oder wundersam und künstlerisch wertvoll erschien, in sogenannten Kunst- und Wunderkammern aus, welche sie nur für Auserwählte öffneten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zur Entstehung der Museen (allgemein) im 18. Jahrhundert
- Dresdner Gemäldegalerie. Von der privaten Sammlung zum öffentlichen Museum
- Die programmatische Außengestaltung und -dekoration der Gemäldegalerie Dresden von Gottfried Semper
- Nordfassade an der Theaterplatzseite
- Südfassade Zwingerseite
- Die Schmalseiten im Osten und Westen des Baus
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entstehung der Dresdner Gemäldegalerie im 18. und 19. Jahrhundert und beleuchtet deren kulturgeschichtliche Bedeutung als öffentlicher und repräsentativer Raum. Sie skizziert den Wandel von einer privaten Sammlung zu einem öffentlich zugänglichen Museum und analysiert die Rolle der Architektur, insbesondere des Semperbaus, in diesem Prozess.
- Entwicklung des Museumsbegriffs im 18. Jahrhundert
- Wandel der Dresdner Gemäldegalerie von privater zu öffentlicher Sammlung
- Die Bedeutung der Architektur des Semperbaus für die Präsentation der Kunst
- Der Einfluss der kurfürstlichen Sammlungspolitik auf den Bestand der Galerie
- Die Rolle des Museums als repräsentativer Raum
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Bedeutung von Museen für die Kunstwissenschaft und die allgemeine Öffentlichkeit. Sie hebt die relative Jugend des Museums als öffentlich zugängliche Institution hervor und kündigt die Fokussierung auf die Dresdner Gemäldegalerie als Fallbeispiel an. Der Text betont den Übergang von privaten, fürstlichen Sammlungen zu öffentlichen Museen und die daraus resultierende Bedeutung für die Kulturgeschichte.
Zur Entstehung der Museen (allgemein) im 18. Jahrhundert: Dieses Kapitel erörtert die allgemeine Entwicklung des Museums im 18. Jahrhundert. Es beschreibt den Wandel von privaten, fürstlichen Sammlungen, die oft als Kunst- und Wunderkammern dienten, hin zu öffentlich zugänglichen Museen. Der Text betont die Rolle von Königen, Fürsten, Künstlern und Architekten bei der Schaffung dieser neuen Institutionen und deren Bedeutung als repräsentative Räume, die den kulturellen Reichtum einer Nation präsentieren. Beispiele wie das British Museum und das Fridericianum in Kassel werden erwähnt, um die internationale Entwicklung zu veranschaulichen. Der Fokus liegt auf der zunehmenden öffentlichen Zugänglichkeit und der Neuorganisation der Sammlungen nach künstlerischen und nicht mehr nur dekorativen Gesichtspunkten.
Dresdner Gemäldegalerie. Von der privaten Sammlung zum öffentlichen Museum: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die spezifische Geschichte der Dresdner Gemäldegalerie. Es beschreibt die Entwicklung der Sammlung unter August dem Starken und seinem Sohn, die durch deren Sammelleidenschaft geprägt war. Der Text beleuchtet die verschiedenen Standorte der Sammlung, vom Residenzschloss zum eigens errichteten Semperbau, und zeigt die damit verbundenen Veränderungen in der Präsentation und dem Zugang zur Kunst. Die Bedeutung der Sammlung für die italienische Renaissancemalerei und die altdeutsche und altniederländische Malerei wird hervorgehoben. Das Kapitel unterstreicht den Übergang von einer höfischen Sammlung zu einer Institution von nationaler und internationaler Bedeutung, zugänglich für ein breites Publikum.
Die programmatische Außengestaltung und -dekoration der Gemäldegalerie Dresden von Gottfried Semper: Dieses Kapitel analysiert die Architektur des Semperbaus und dessen Bedeutung für die Präsentation der Gemäldegalerie. Es untersucht die Gestaltung der Nord- und Südfassade sowie der Schmalseiten und beleuchtet die Rolle der Architektur als Ausdruck des kulturellen und gesellschaftlichen Selbstverständnisses. Die detaillierte Beschreibung der Fassaden und ihrer Gestaltungselemente wird genutzt, um die repräsentative Funktion des Gebäudes und dessen Einfluss auf die Wahrnehmung der Sammlung hervorzuheben. Der Text zeigt auf, wie Semper die Architektur nutzte, um die Bedeutung der Kunst und der Sammlung für die Gesellschaft zu betonen.
Schlüsselwörter
Dresdner Gemäldegalerie, Museumsgeschichte, 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, Gottfried Semper, Semperbau, öffentliche Sammlung, Repräsentation, Kunstgeschichte, Kurfürstliche Sammlung, August der Starke, Architektur, Kunstmuseum.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Dresdner Gemäldegalerie
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Entstehung der Dresdner Gemäldegalerie im 18. und 19. Jahrhundert und beleuchtet deren kulturgeschichtliche Bedeutung als öffentlicher und repräsentativer Raum. Sie analysiert den Wandel von einer privaten Sammlung zu einem öffentlich zugänglichen Museum und die Rolle der Architektur, insbesondere des Semperbaus, in diesem Prozess.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung des Museumsbegriffs im 18. Jahrhundert, den Wandel der Dresdner Gemäldegalerie von privater zu öffentlicher Sammlung, die Bedeutung der Architektur des Semperbaus für die Präsentation der Kunst, den Einfluss der kurfürstlichen Sammlungspolitik auf den Bestand der Galerie und die Rolle des Museums als repräsentativer Raum.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, ein Kapitel zur allgemeinen Entstehung von Museen im 18. Jahrhundert, ein Kapitel zur Geschichte der Dresdner Gemäldegalerie vom privaten Besitz zum öffentlichen Museum, ein Kapitel zur Architektur des Semperbaus und dessen Bedeutung für die Präsentation der Galerie und abschließend ein Fazit.
Wie wird die Entwicklung der Dresdner Gemäldegalerie dargestellt?
Die Arbeit verfolgt die Entwicklung der Dresdner Gemäldegalerie von einer privaten, fürstlichen Sammlung unter August dem Starken und seinen Nachfolgern bis hin zu einem öffentlich zugänglichen Museum. Sie zeigt die verschiedenen Standorte der Sammlung und die damit verbundenen Veränderungen in der Präsentation und dem Zugang zur Kunst auf.
Welche Rolle spielt die Architektur des Semperbaus?
Die Arbeit analysiert die Architektur des Semperbaus detailliert und betont dessen Bedeutung für die Präsentation der Gemäldegalerie. Die Gestaltung der Fassaden und deren Gestaltungselemente werden untersucht, um die repräsentative Funktion des Gebäudes und dessen Einfluss auf die Wahrnehmung der Sammlung hervorzuheben.
Welche Bedeutung hat die Arbeit für die Kunstgeschichte?
Die Arbeit leistet einen Beitrag zum Verständnis der Museumsgeschichte und der Entwicklung des Museumsbegriffs im 18. und 19. Jahrhundert. Sie zeigt am Beispiel der Dresdner Gemäldegalerie den Wandel von privaten, fürstlichen Sammlungen zu öffentlichen Institutionen und die damit verbundene Veränderung des Zugangs zu Kunst und Kultur.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Dresdner Gemäldegalerie, Museumsgeschichte, 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, Gottfried Semper, Semperbau, öffentliche Sammlung, Repräsentation, Kunstgeschichte, Kurfürstliche Sammlung, August der Starke, Architektur, Kunstmuseum.
Welche Beispiele für Museen im 18. Jahrhundert werden genannt?
Die Arbeit nennt als Beispiele für die internationale Entwicklung von Museen im 18. Jahrhundert das British Museum und das Fridericianum in Kassel.
Wie wird der Übergang von privaten zu öffentlichen Sammlungen beschrieben?
Die Arbeit beschreibt den Wandel von privaten, oft als Kunst- und Wunderkammern dienenden fürstlichen Sammlungen hin zu öffentlich zugänglichen Museen, die den kulturellen Reichtum einer Nation repräsentieren sollten. Der Fokus liegt auf der zunehmenden öffentlichen Zugänglichkeit und der Neuorganisation der Sammlungen nach künstlerischen Gesichtspunkten.
Was ist das Fazit der Arbeit?
(Der HTML-Code enthält keine explizite Zusammenfassung als Fazit. Das Fazit müsste aus den Kapitelzusammenfassungen erschlossen werden. Es würde sich vermutlich mit der Bedeutung der Dresdner Gemäldegalerie als Beispiel für den Wandel von privaten zu öffentlichen Sammlungen und der Rolle der Architektur in diesem Prozess befassen.)
- Quote paper
- M.A. Larissa Ferro (Author), 2016, Gemäldegalerie Dresden, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/490960