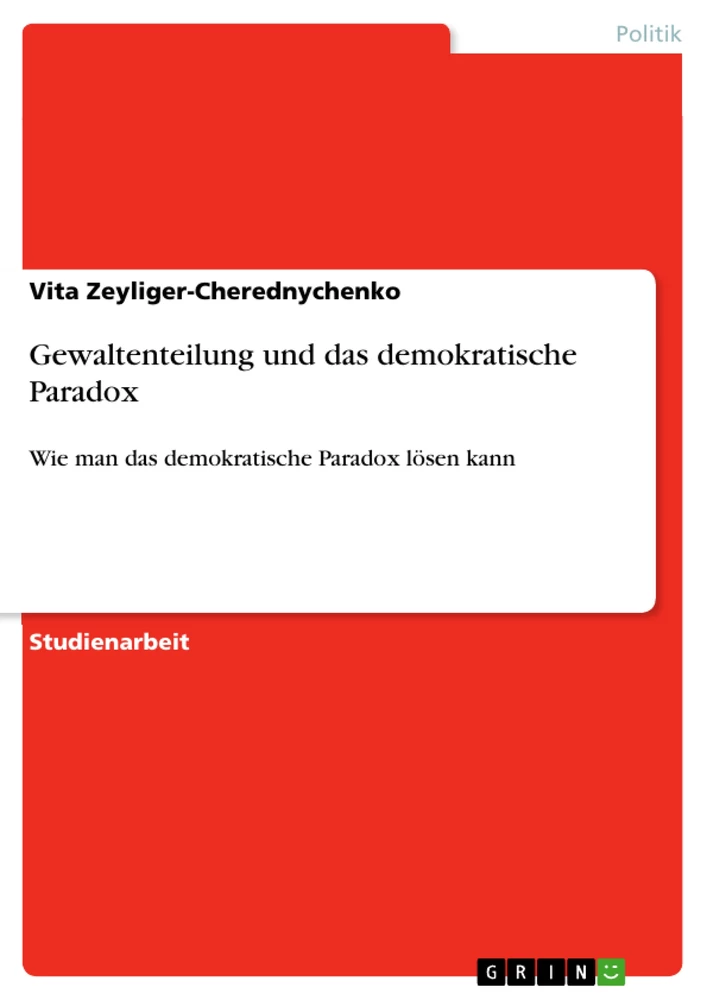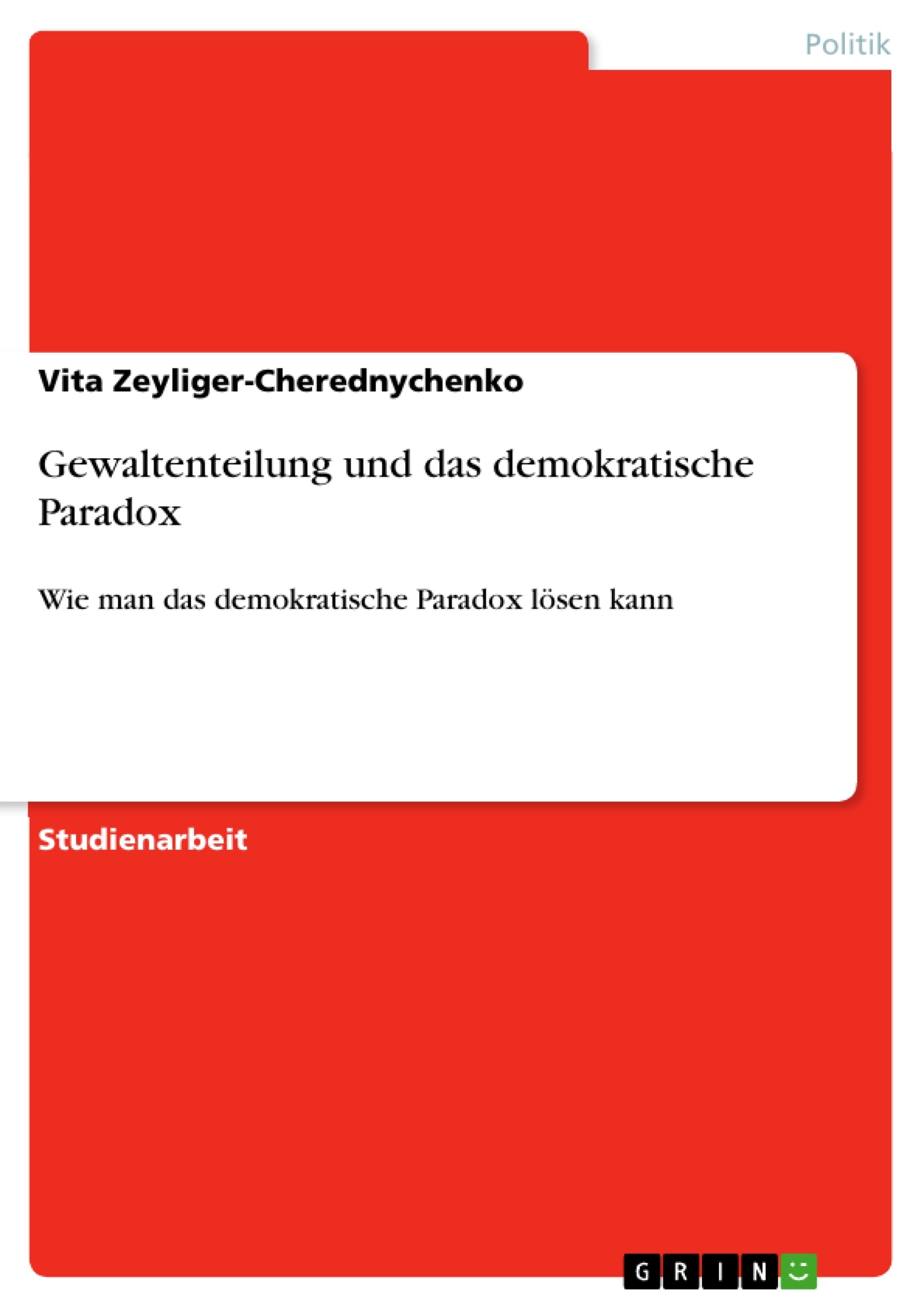Diese Arbeit verfolgt das Ziel, sich mit dem demokratischen Paradox, impliziert im Begriff der "konstitutionellen Demokratie", zu befassen. Explizit wird versucht, der Frage nach möglichen Lösungsoptionen nachzugehen. Gegenstand dieser Abhandlung ist es, die Rolle der Gewaltenteilung bei der Lösung des Souveränitätsparadoxes der Politik zu entschlüsseln. Die Ausgangsgrundlage für die Analyse bietet die These Niklas Luhmanns, dass die Politik und das Recht sich in Selbstreferenzparadoxien verstricken, welche zur Paralyse führen können. Aus diesem Grund ist es von Bedeutung, auf Modi der "Entschärfung" des Paradoxes näher einzugehen und abschließend den Stellenwert der Gewaltenteilung dabei zu beurteilen. Weiterführend wird ein Ausblick auf die Entparadoxierung anderer Funktionssysteme gegeben.
Immer öfters wird in öffentlichen Diskursen von einem "Demokratiedefizit" gesprochen. Ein akutes Problem vieler heutiger Demokratien liegt demnach darin, dass der Wille des Volkes nicht zum Ausdruck kommt. Stattdessen wird alles von der Verfassung aufgesetzt. Bedeutet dies, die Demokratie hat ausgedient? Oder liegt eine andere Demokratieform vor, bei der sich vielleicht die Souveränitätsbeschränkung sogar demokratiefördernd auswirkt? Was wie ein Paradox klingt, ist auch eines.
Der Begriff der konstitutionellen Demokratie birgt einen Widerspruch in sich und entspricht den Kriterien eines Paradoxes.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Begriff des Paradoxes
- Das demokratische Paradox
- Gewaltenteilung
- Gewaltenteilung bei der Lösung des demokratischen Paradoxes
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem demokratischen Paradox, das im Begriff der „konstitutionellen Demokratie“ impliziert ist. Sie analysiert die Rolle der Gewaltenteilung bei der Lösung des Souveränitätsparadoxes der Politik, ausgehend von der These Niklas Luhmanns, dass Politik und Recht sich in Selbstreferenzparadoxien verstricken können, die zur Paralyse führen. Ziel ist es, Modi der „Entschärfung“ des Paradoxes zu untersuchen und den Stellenwert der Gewaltenteilung dabei zu beurteilen. Abschließend wird ein Ausblick auf die Entparadoxierung anderer Funktionssysteme gegeben.
- Das demokratische Paradox: Spannung zwischen Konstitutionalismus und Demokratie
- Die Rolle der Gewaltenteilung bei der Lösung des Souveränitätsparadoxes
- Niklas Luhmanns Theorie der Selbstreferenzparadoxien und deren Auswirkungen auf Politik und Recht
- Modi der „Entschärfung“ des Paradoxes
- Entparadoxierung anderer Funktionssysteme
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt das demokratische Paradox vor, das durch den scheinbaren Widerspruch zwischen dem Willen des Volkes und der Verfassung entsteht. Sie beleuchtet die Frage, ob die Demokratie ausgedient hat oder ob eine andere Form der Demokratie mit Souveränitätsbeschränkung die Demokratie fördern kann.
Der Begriff des Paradoxes
Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition des Paradoxes, insbesondere im Kontext der Systemtheorie von Niklas Luhmann. Es wird erläutert, wie Paradoxien als „Movens der Geschichte“ betrachtet werden können und dass sie ein immenses Entwicklungs- und Fortschrittspotenzial bergen. Die Unterscheidung zwischen Kollisionen und Paradoxien wird deutlich gemacht, wobei Kollisionen als einfache Widersprüche zwischen Geltungsansprüchen und Paradoxien als komplexere, selbstrückbezügliche Widersprüche dargestellt werden.
Das demokratische Paradox
Dieses Kapitel behandelt die Spannung zwischen Konstitutionalismus und Demokratie, die dem Begriff der „konstitutionellen Demokratie“ innewohnt. Es wird aufgezeigt, wie Liberalismus und Demokratie als „freundschaftliche Feinde“ betrachtet werden können, die einen gemeinsamen Raum teilen, aber unterschiedliche Organisationsformen anstreben. Das „Demokratiedefizit“ wird als Folge von Grenzen der Demokratie verstanden, die zum Schutz der Menschenrechte notwendig sind.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem demokratischen Paradox, der Gewaltenteilung, dem Konstitutionalismus und der Systemtheorie von Niklas Luhmann. Weitere wichtige Begriffe sind Selbstreferenzparadoxien, Entparadoxierung, Kollisionen, „Demokratiedefizit“ und die „konstitutionelle Demokratie“. Der Schwerpunkt liegt auf der Analyse der Rolle der Gewaltenteilung bei der Lösung des Souveränitätsparadoxes der Politik.
- Arbeit zitieren
- Vita Zeyliger-Cherednychenko (Autor:in), 2018, Gewaltenteilung und das demokratische Paradox, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/464258