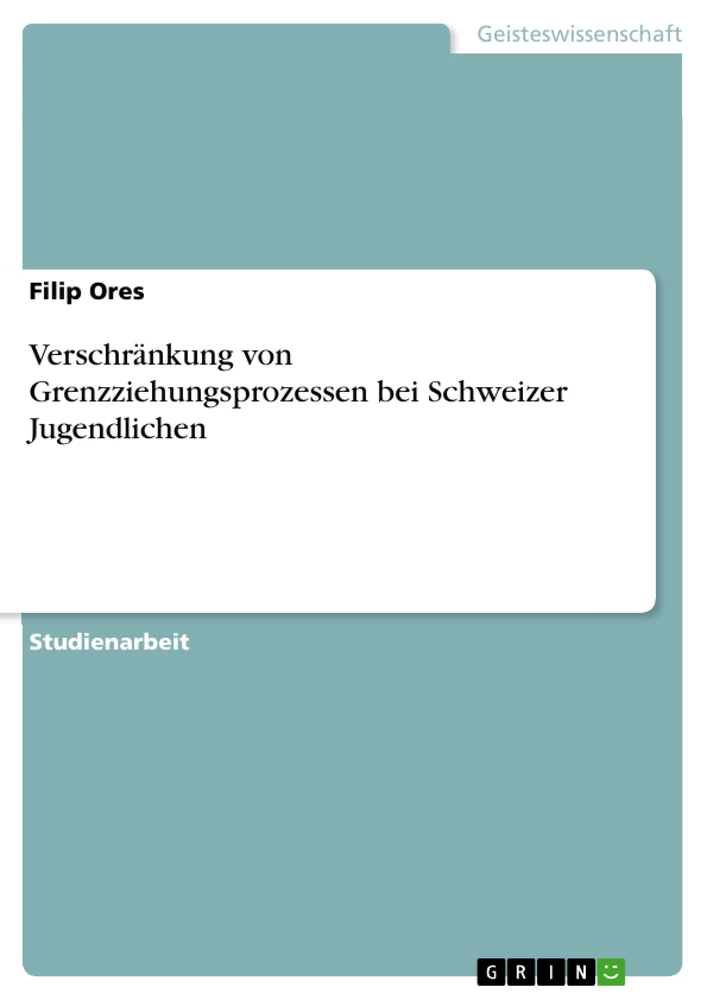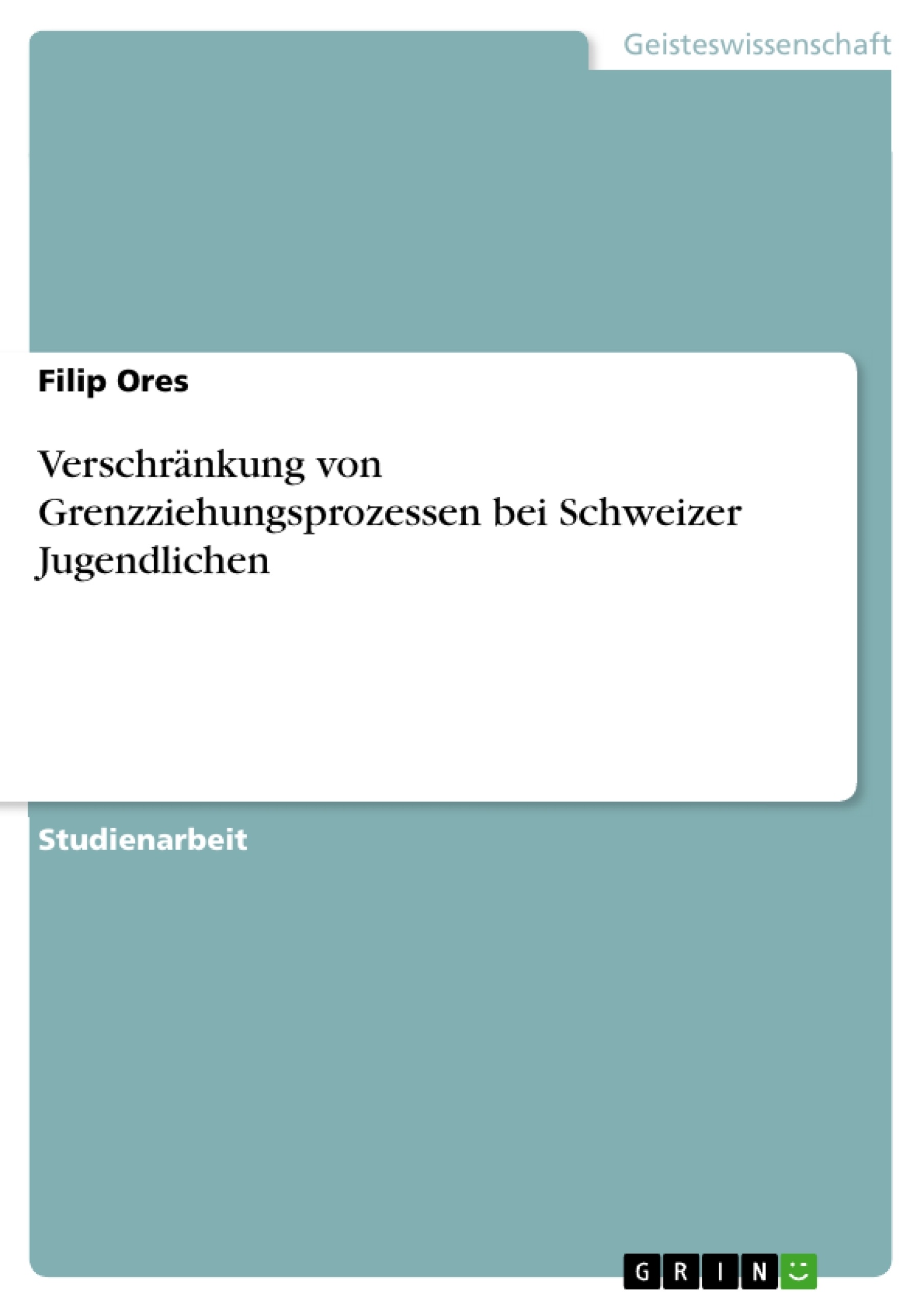Wie funktionieren soziale Interaktionen? Nach welchen Kriterien such ich mir meine Beziehungen aus und wie entstehen dadurch gesellschaftliche Prozesse? Das sind Fragen, die einen jeden Sozialwissenschaftler früher oder später interessieren und die auch ich mir vor dem Studium gestellt habe. Dabei haben mir viele soziologische Theorien zu einem besseren Verständnis verholfen. So zum Beispiel der Klassiker Georg Simmel, der gesellschaftliches Handeln aus Wechselwirkungen zwischen Motiven eines Individuums und der persönlichen Bereicherung durch Gruppendynamiken erklärt. Des Weiteren kann der Sozialpsychologe George Herbert Mead herangezogen werden, für den menschliche Interaktionen nur Dank verbaler Sprache möglich wird. Andere Theorien waren wiederum weniger hilfreich. Der Wissenschaftler Pierre Bourdieu erklärt in seinem Hauptwerk „Die feinen Unterschiede“, aus dem Jahr 1982, dass jede kulturelle Schicht ein spezifisches Verhalten aufweist. Es ist gebunden an ökonomische, kulturelle, soziale Ressourcen und wird über Generationen weitergegeben. Objektive Kategorisierungen sind demnach nicht nur in der wissenschaftlichen Theorie vorhanden, sondern existieren so auch in der alltäglichen Praxis.
Eine solche statische Vorstellung der Sozialstruktur kam mir für das 21. Jahrhundert nicht mehr aktuell vor. Aufgewachsen in Hamburg, wo es Vielfalt im Überfluss gibt, prägte sich bei mir das Bild einer komplexen Gesellschaft ein, wie auch der Anstieg meins Interesses für Hierarchisierungsprozesse im Alltag und innerhalb anderer Regionen. Für meine Forschungsfrage untersuche ich deshalb symbolische Grenzziehungen unter Jugendlichen in der Schweiz, weil ich herausfinden möchte, wie soziale, ethnische und religiöse Grenzen sich verschränken und weil ich dadurch verschiedene Strategien der Inklusion und Exklusion aufzeigen möchte. Dafür werde ich zunächst symbolische Grenzziehungen erklären und herausarbeiten wie sich der Begriff innerhalb der Sozialwissenschaften entwickelt hat. Anschließend zeige ich die wichtigsten internationalen Studien zu Grenzziehungsprozessen auf. Zum Schluss werden verschiedene Strategien der Schweizer Jugendlichen präsentiert und mit den bisherigen Studienergebnissen verglichen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Entstehungsgeschichte des Konzepts der Grenzziehungsprozesse
- Wissenschaftliche Arbeit mit symbolischen Grenzen
- Symbolische Grenzen in Frankreich und Amerika
- Strategien für Grenzauflösungen
- Symbolische Grenzen in Deutschland
- Grenzziehungsprozesse unter Schweizer Jugendlichen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Konzept der symbolischen Grenzen und untersucht, wie sich diese in der Praxis manifestieren, insbesondere im Kontext von Jugendlichen in der Schweiz. Die Arbeit zielt darauf ab, die Entstehung des Konzepts der Grenzziehungsprozesse aufzuzeigen, wichtige internationale Studien zu diesem Thema zu präsentieren und die Strategien der Schweizer Jugendlichen im Umgang mit sozialen, ethnischen und religiösen Grenzen zu analysieren.
- Entwicklung des Konzepts der Grenzziehungsprozesse
- Internationaler Vergleich von Studien zu symbolischen Grenzen
- Strategien der Inklusion und Exklusion unter Schweizer Jugendlichen
- Zusammenhang zwischen sozialen, ethnischen und religiösen Grenzen
- Die Rolle von symbolischen Grenzen in der Konstruktion sozialer Ungleichheit
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung stellt die Forschungsfrage und die Forschungsmethodik der Arbeit vor. Sie verdeutlicht das Interesse an der Analyse von Hierarchisierungsprozessen und die Wahl der Schweizer Jugendlichen als Untersuchungsobjekt.
- Entstehungsgeschichte des Konzepts der Grenzziehungsprozesse: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung des Konzepts, beginnend mit der traditionellen ethnischen Perspektive nach Herder und der Kritik durch die „situational school“. Es führt den Ansatz von Fredrik Barth ein, der die Dynamik und den sozialen Charakter von Ethnizitäten betont.
- Wissenschaftliche Arbeit mit symbolischen Grenzen: Das Kapitel befasst sich mit den Arbeiten von Michèle Lamont und Andreas Wimmer, die den Ansatz der symbolischen Grenzen als Erweiterung der Sozialstrukturanalyse durch Bourdieu etabliert haben. Es erklärt die Rolle von symbolischen Grenzen in der Konstruktion sozialer Grenzen und der Beeinflussung von Lebensläufen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Schlüsselbegriffen symbolische Grenzen, Grenzziehungsprozesse, soziale Kategorien, Inklusion, Exklusion, ethnische Zugehörigkeit, kulturelle Identität und soziale Ungleichheit. Sie untersucht die Rolle von symbolischen Grenzen in der Entstehung und Reproduktion von sozialen Grenzen und analysiert verschiedene Strategien, die Individuen im Umgang mit diesen Grenzen entwickeln.
- Arbeit zitieren
- Filip Ores (Autor:in), 2018, Verschränkung von Grenzziehungsprozessen bei Schweizer Jugendlichen, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/464074