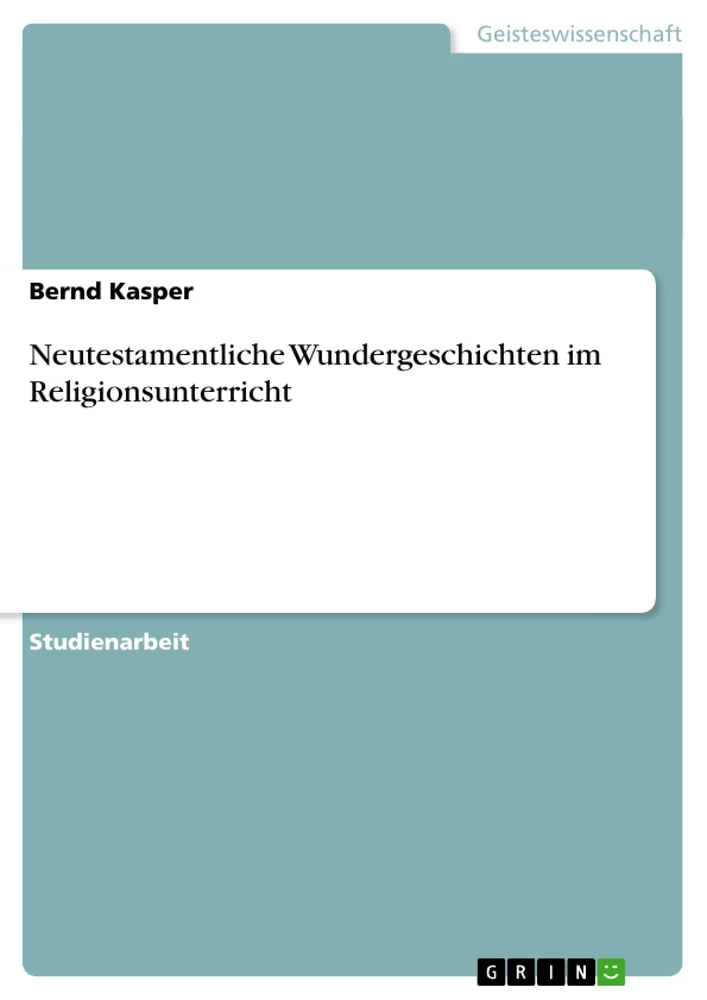Der vorliegende Text beschreibt an zwei Beispielen (Mk. 2, 1-12; Joh.2, 1-12) die Unterscheidung zwischen dem historischen Jesus und dem erhöhten Christus.
Zum historischen Jesus gehören die Exzorzismen, dem erhöhten Christus werden die Naturwunder, die Totenauferweckung und die bekannten Brot- und die Weinvermehrung zugeordnet.
Zur Entstehung der Wundergeschichten ist zu vermerken, dass sie nach und nach in der Urgemeinde erzählt und zu einem späteren Zeitpunkt von den Evangelisten verschriftlicht wurden. Dabei flossen zusätzlich Impulse aus der religiösen Umwelt der Evangelisten mit ein.
Die Arbeit wendet sich zusätzlich an Interessierte, die die Wunderthematik im Berufsschulunterricht aufgreifen wollen und Basisinformationen benötigen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitende Überlegung
- Definitionen des Wunderbegriffs
- Wunderparallelen in der Antike
- Die Wundergläubigkeit in der Entwicklung
- Stufeneinteilung nach Fowler
- Die urchristlichen Wundergattungen
- MotiviK der neutestamentlichen Wundergeschichten
- Neutestamentliche Beispiele für Wundergeschichten
- Die Heilung des Gelähmten (Mk. 2,1-12)
- Einteilung der Motive
- Exegetische Kernaussagen zu Mk. 2,1-12
- Die Hochzeit zu Kana (Joh. 2,1-12)
- Einteilung der Motive
- Exegetische Kernaussagen
- Didaktische Legitimation
- Unterrichtsentwurf zum Thema: Jesu Handlungen - Ein Wunder?...
- Die Heilung des Gelähmten (Mk. 2, 1-12)
- Unterrichtsentwurf zu: Hochzeit von Kana (Joh. 2, 1-12)
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der sinnvollen Einsetzung von Wundergeschichten im Religionsunterricht (RU) und möchte Wege zum Verständnis der geschilderten Wundergeschichten aufzeigen. Die Darstellung zweier Perikopen aus dem Neuen Testament soll dies verdeutlichen.
- Definition des Begriffs „Wunder“
- Wunderparallelen in der Antike
- Die Entwicklung der Wundergläubigkeit
- Die verschiedenen Arten von Wundergeschichten im Urchristentum
- Die didaktische Legitimation des Einsatzes von Wundergeschichten im RU
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer einleitenden Überlegung zum Thema Wundergeschichten im Religionsunterricht, insbesondere in einer fiktiven Berufsschulklasse für angehende Arzthelfer. Die unterschiedlichen Perspektiven und Meinungen, die in dieser Schülergruppe zum Thema Wunder auftreten können, werden beleuchtet.
Im zweiten Kapitel werden verschiedene Definitionen des Wunderbegriffs aus unterschiedlichen Perspektiven, darunter die religionsgeschichtliche, die sprachliche und die theologische Perspektive, vorgestellt.
Das dritte Kapitel beleuchtet die Parallelen zwischen Wundergeschichten im Alten und Neuen Testament und vergleichbaren Erzählungen in der Antike. Die Bedeutung dieser Parallelen für den Unterricht wird hervorgehoben.
Das vierte Kapitel betrachtet die Entwicklung der Wundergläubigkeit, insbesondere im Zusammenhang mit der Stufeneinteilung nach Fowler. Die verschiedenen Phasen der Wundergläubigkeit werden dargestellt.
Kapitel fünf widmet sich den verschiedenen Arten von Wundergeschichten im Urchristentum.
Kapitel sechs analysiert die Motive hinter den neutestamentlichen Wundergeschichten. Anhand von Beispielen werden die verschiedenen Motivgruppen und ihre Bedeutung erläutert.
Kapitel sieben präsentiert zwei neutestamentliche Wundergeschichten: Die Heilung des Gelähmten (Mk. 2,1-12) und die Hochzeit zu Kana (Joh. 2,1-12). Die Motive und exegetischen Kernaussagen dieser Perikopen werden detailliert untersucht.
Das achte Kapitel befasst sich mit der didaktischen Legitimation des Einsatzes von Wundergeschichten im Religionsunterricht.
Kapitel neun präsentiert zwei Unterrichtsentwürfe, einen zur Heilung des Gelähmten (Mk. 2, 1-12) und einen zur Hochzeit zu Kana (Joh. 2, 1-12).
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe dieser Arbeit sind: Wundergeschichten, Religionsunterricht, Neutestamentliche Wunder, Exegese, Didaktik, Unterrichtsentwurf, Perikope, Motiv, Wunderglaube, Antike, Urchristentum, Theologie.
- Quote paper
- Bernd Kasper (Author), 2005, Neutestamentliche Wundergeschichten im Religionsunterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/46269