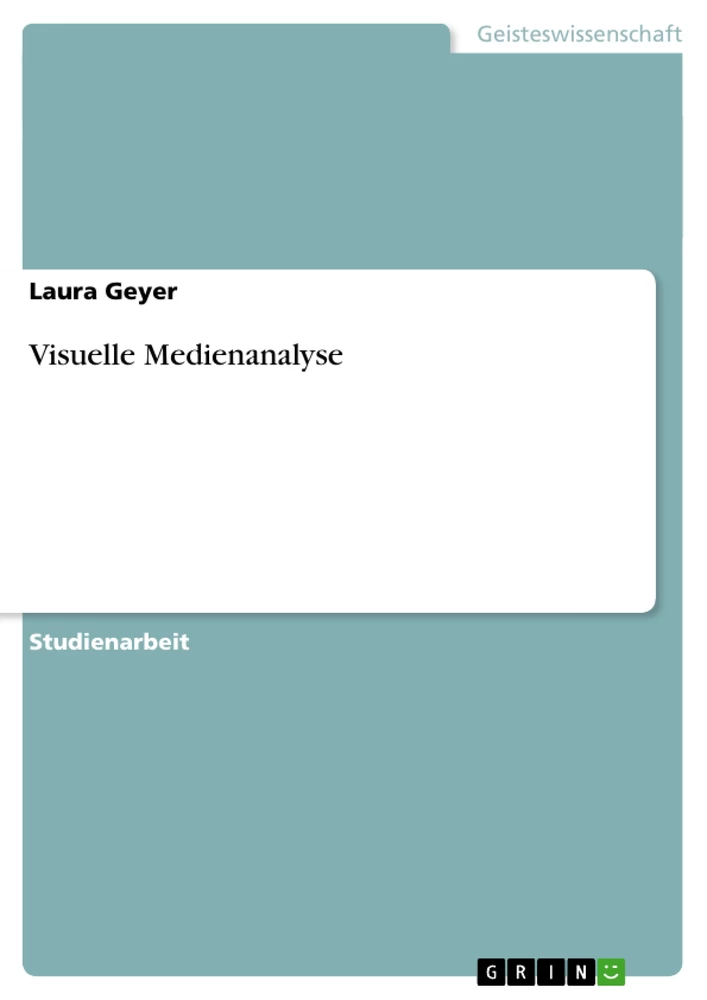Massenmedien nehmen im Alltag der Menschen, die sich in der Metamorphose zu einer digitalen Informationsgesellschaft befinden, eine immer größere Rolle ein. Die Überflutung mit Informationen erfolgt dabei nicht ausschließlich in textualisierter Form. In allen Medien werden vermehrt Bilder eingesetzt, sei es zur bloßen Illustration oder auch zum Zweck der gezielten Auslösung von Emotionen. Die Wirkung visuell vermittelter Informationen wurde bisher nur in eingeschränktem Maße wissenschaftlich untersucht, obwohl feststeht, dass Bilder sich im persönlichen und kulturellen Gedächtnis auf andere Weise festsetzen als Textinformationen.
Ziel der vorliegenden Hausarbeit, die im Rahmen des Seminars „Kulturtheorien I“ im Sommersemester 2005 am Ludwig-Uhland-Institut für Empirische Kulturwissenschaft entstand, ist die Veranschaulichung der Methodik einer visuellen Medienanalyse am Beispiel eines konkreten Bildes (siehe Anhang a), wobei die Vorgehensweise induktiv und die praktische Ebene der Schwerpunkt sein wird. Theoretische wie methodische Basis der Betrachtung bildet das Lehrbuch „Grundlagen der visuellen Kommunikation“ von Marion G. Müller. Das exemplarische Foto Gerhard Schröders entstammt einem Artikel des Magazins „Cicero“2. Die Analyse folgt weitgehend dem dreiteiligen Schema des Kunsthistorikers und Begründers der Ikonologie Erwin Panofsky aus vorikonografischer Beschreibung, ikonografischer Bedeutungsanalyse und ikonologischer Interpretation, beziehungsweise der Version Marion G. Müllers (siehe Anhang b). Diese bleibt im Gegensatz zu Panofskys Ikonologie nicht auf Kunstwerke beschränkt, sondern ist auf alle Bildergenres anwendbar. Realistisch betrachtet überschneiden sich die drei Ebenen bei der Bildbetrachtung, diese Arbeit wird sie allerdings zur Veranschaulichung getrennt behandeln. Im Anschluss an die praktisch-theoretische Interpretation zeigt die Schlussbetrachtung mögliche Fortentwicklungen der Analyse auf.
Das analysierte Bild sowie weitere Darstellungen zur Illustration der Motivgeschichte finden sich im Anhang, sie sind allerdings aus technischen Gründen nicht völlig farbgetreu.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Bildbeschreibung als forensische Methode
- Bedeutungszuweisung in der Bildanalyse
- Erweiterte Interpretation unter Einbeziehung des Kontextes
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit setzt sich zum Ziel, die Methodik einer visuellen Medienanalyse anhand eines konkreten Bildes (siehe Anhang a) zu veranschaulichen. Die Arbeit verfolgt einen induktiven Ansatz und konzentriert sich auf die praktische Ebene der Analyse. Das analysierte Bild dient als Beispiel für die Anwendung der theoretischen und methodischen Grundlagen, die im Buch „Grundlagen der visuellen Kommunikation“ von Marion G. Müller¹ dargelegt werden.
- Die Bedeutung von Bildern in der digitalen Informationsgesellschaft
- Die Methodik der visuellen Medienanalyse
- Die Anwendung des dreiteiligen Schemas von Erwin Panofsky zur Bildinterpretation
- Die Interpretation eines konkreten Bildes anhand der verschiedenen Sinnesebenen
- Die Bedeutung des Kontextes für die Bildinterpretation
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine Einleitung in die Bedeutung von visuellen Medien in der heutigen Zeit. Die Hausarbeit untersucht die Methodik der visuellen Medienanalyse anhand eines konkreten Bildes. Die Analyse folgt dem dreiteiligen Schema von Erwin Panofsky, das in drei Sinnesebenen (Phänomensinn, Ikonologischer Sinn und Ikonologischer Sinn) unterteilt ist.
Im zweiten Kapitel wird die Bildbeschreibung als forensische Methode vorgestellt. Dabei wird die Bedeutung einer objektiven Beschreibung des Bildes betont, um den Phänomensinn zu erfassen. Die Beschreibung sollte alle relevanten Details des Bildes, wie Format, Motiv, Komposition, Technik, Qualität, Blick- und Aufmerksamkeitslenkung, Größenverhältnisse sowie Farbigkeit, festhalten. Interpretation ist in diesem Schritt noch nicht gefragt.
Das dritte Kapitel befasst sich mit der Zuweisung von Bedeutung in der Bildanalyse. Hierbei werden die verschiedenen Sinnesebenen des Bildes, wie der Ikonologischer Sinn und der Ikonologischer Sinn, anhand des Beispielbildes untersucht. Das analysierte Bild zeigt den Bundeskanzler Gerhard Schröder mit seinem Hund Holly im Wald. Die Interpretation des Bildes konzentriert sich auf die Bedeutung des Hundes als Symbol für Macht und die Präsentation des Kanzlers als „normaler Mensch“ außerhalb des politischen Umfeldes.
Schlüsselwörter
Visuelle Medienanalyse, Bildinterpretation, Erwin Panofsky, Ikonologie, Phänomensinn, Ikonologischer Sinn, Ikonologischer Sinn, Kontext, Gerhard Schröder, Hund, Macht, Kommunikation, Symbol, Medien, digitale Informationsgesellschaft.
- Quote paper
- Laura Geyer (Author), 2005, Visuelle Medienanalyse, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/46242