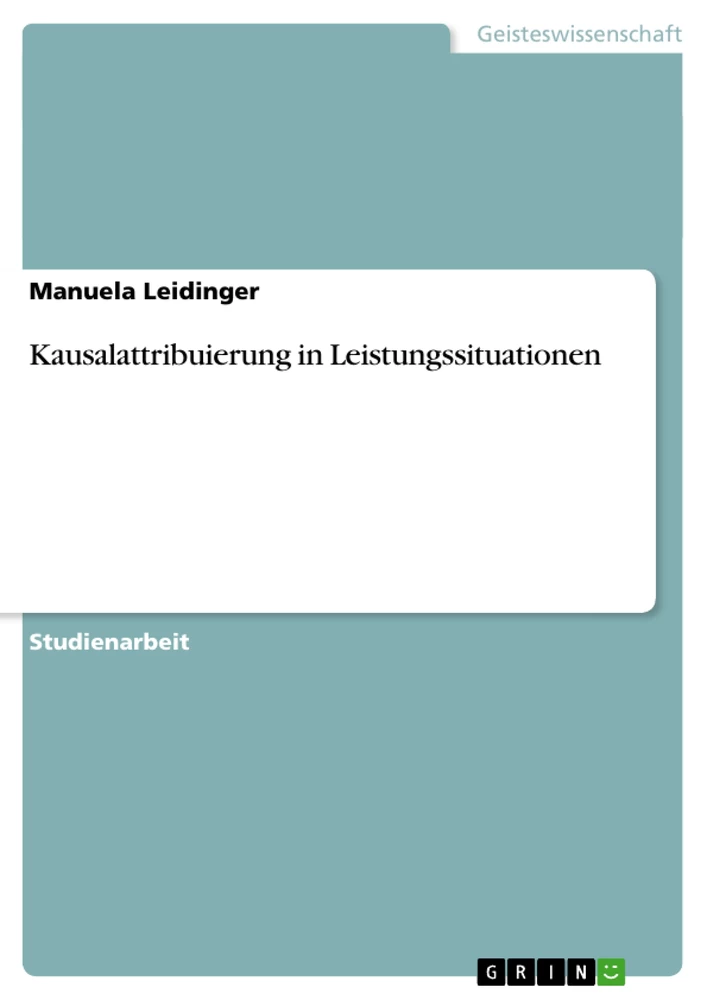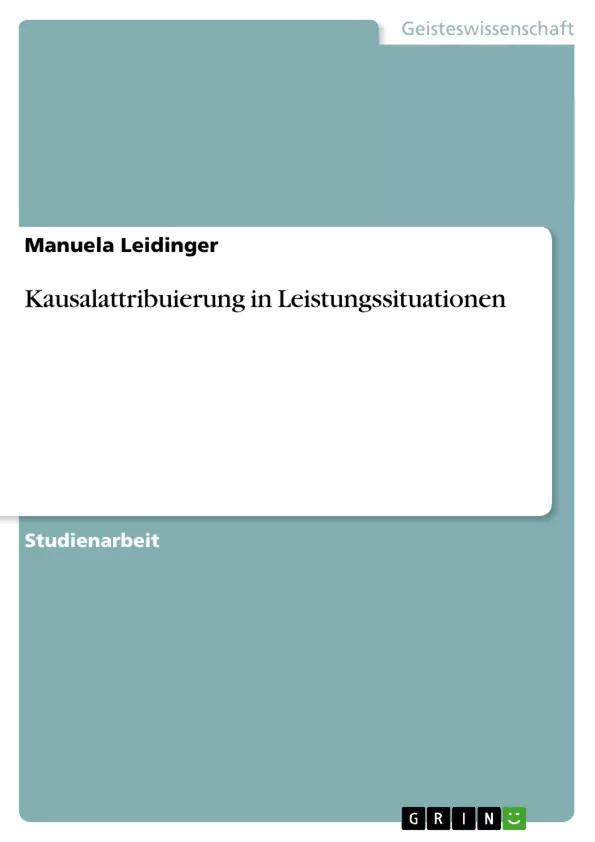Als Grundannahme der Attributionstheorie kann formuliert werden, dass Menschen bestimmten Ereignissen bestimmte Ursachen zuschreiben und sich diese somit erklären. In der Psychologie trifft man häufig auf die Bezeichnung „naiver Wissenschaftler“, da der Mensch dazu tendiert, beobachtbares Verhalten auf nicht beobachtbare Ursachen zurückzuführen. Der Begriff der Kausalattribution „beschreibt den Schlussfolgerungsprozess, durch den Beobachter einen Effekt auf einen oder mehrere Ursachen zurückführen.“(Fincham, F. und Hewstone, M., 2002). Im Mittelpunkt des Interesse steht hierbei die Art und Weise dieser Ursachenzuschreibung. Fritz Heider führte diesbezüglich die Unterscheidung zwischen internen und externen Ursachen ein, wobei mit intern Ursachen beschrieben werden, die innerhalb der Person liegen und mit extern Ursachen, die außerhalb der Person liegen. Als interne bzw. internale Ursachen gelten beispielweise Anstrengung und Begabung, als externe bzw. externale Ursachen beispielsweise Zufall und Schwierigkeit. Weiner (1985) ermittelte in Untersuchungen zu Attributionskonzepten diese vier Ursachen als Gründe, die am häufigsten zur Erklärung von Erfolgen und Misserfolgen in Leistungssituationen angeführt wurden. Sie wurden auch dem FKL zugrundegelegt.
Eine weitere, für Leistungssituationen wichtige Differenzierung bezieht sich auf die Stabilität der oben genannten Ursachen und somit auf ihre Veränderbarkeit. Demnach gelten Begabung und der Grad der Schwierigkeit einer Aufgabe als nicht beeinflussbare Faktoren, die als stabil angesehen werden, wohingegen die Faktoren Anstrengung und Zufall variabel und somit beeinflussbar sind. Diese Differenzierung ist für den schulischen Bereich sehr wichtig, da die instabilen Ursachenerklärungen (Anstrengung und Zufall) für den Schüler kontrollierbar sind; d.h. beispielweise in einer Misserfolgssituation, die der Schüler auf mangelnde Anstrengung zurückführt, kann der Lehrer versuchen, den Schüler mehr zu motivieren, vorausgesetzt er kennt das Attributionsverhalten des jeweiligen Schülers. Eine andere Maßnahme ist hingegen erforderlich, wenn der Schüler Misserfolge als Ergebnis mangelnder Begabung wahrnimmt. Eine solche Ursachenwahrnehmung führt zu einem Verlust an Selbstwertgefühl und hat zu Folge, dass in zukünftigen Leistungssituationen auch nicht genügend gelernt, also nicht genügend Anstrengung investiert wird, da der Schüler die mangelnde Fähigkeit als gegeben hinnimmt.
Inhaltsverzeichnis
- Zur Entwicklung des Fragebogens
- I. Der theoretische Hintergrund
- II. Überblick über die Entstehung der Fragebogens zur Kausalattribuierung in Leistungssituationen
- III. Aufbau und Aufgaben des Fragebogens zur Kausalattribuierung in Leistungssituationen
- IV. Zusammenfassung und persönliche Anmerkung
- Zur Durchführung des FKL
- I. Zur Versuchsperson
- II. Ergebnisse
- III. Interpretation der Ergebnisse
- IV. Welche Schlussfolgerungen ergeben sich anhand dieses Ergebnisses für die Versuchsperson?
- Diskussion/Kritik
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Fragebogen zur Kausalattribuierung in Leistungssituationen (FKL) von Max Keßler. Der FKL wurde entwickelt, um das Attributionsverhalten von Schülern im schulischen Kontext sichtbar zu machen. Der Fokus liegt auf der Analyse des Fragebogens selbst, seiner theoretischen Grundlagen und der Interpretation konkreter Ergebnisse.
- Kausalattribuierung in Leistungssituationen
- Theoretische Grundlagen der Attributionstheorie
- Entwicklung des FKL
- Anwendung und Interpretation des FKL
- Bedeutung des FKL für das Verständnis von Leistungsmotivation und Selbstbild
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel widmet sich den theoretischen Grundlagen der Attributionstheorie. Es wird erläutert, wie Menschen Ereignisse und Situationen kausal erklären und wie sich diese Attributionsvorgänge im schulischen Kontext auf die Motivation und das Selbstbild von Schülern auswirken können. Das zweite Kapitel beschreibt die Entstehung des FKL, die einzelnen Entwicklungsschritte und die zugrundeliegende Methodik. Im dritten Kapitel werden die Ergebnisse der Anwendung des FKL auf konkrete Fallbeispiele vorgestellt und interpretiert. Schließlich geht das vierte Kapitel auf die Interpretation der Ergebnisse ein und diskutiert, welche Schlussfolgerungen sich für die Versuchspersonen und die pädagogische Praxis ergeben.
Schlüsselwörter
Kausalattribuierung, Leistungssituation, Fragebogen, Attributionstheorie, Ursachenzuschreibung, internal, external, stabil, variabel, Anstrengung, Begabung, Zufall, Schwierigkeit, Schüler, Motivation, Selbstbild, schulischer Kontext, pädagogische Diagnostik.
- Arbeit zitieren
- Manuela Leidinger (Autor:in), 2003, Kausalattribuierung in Leistungssituationen, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/46111