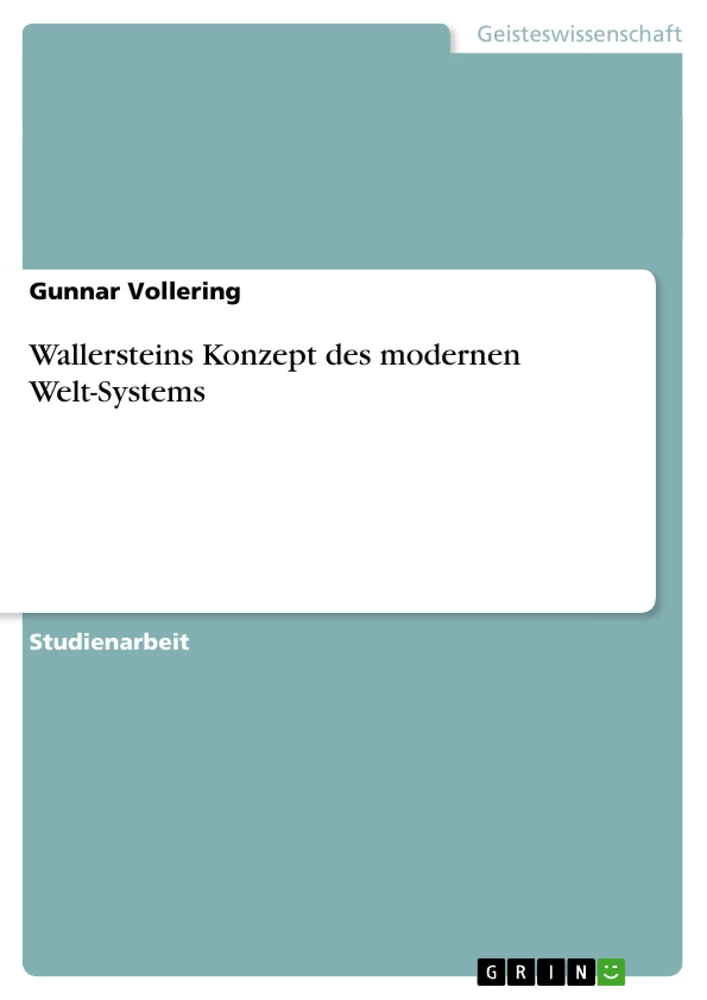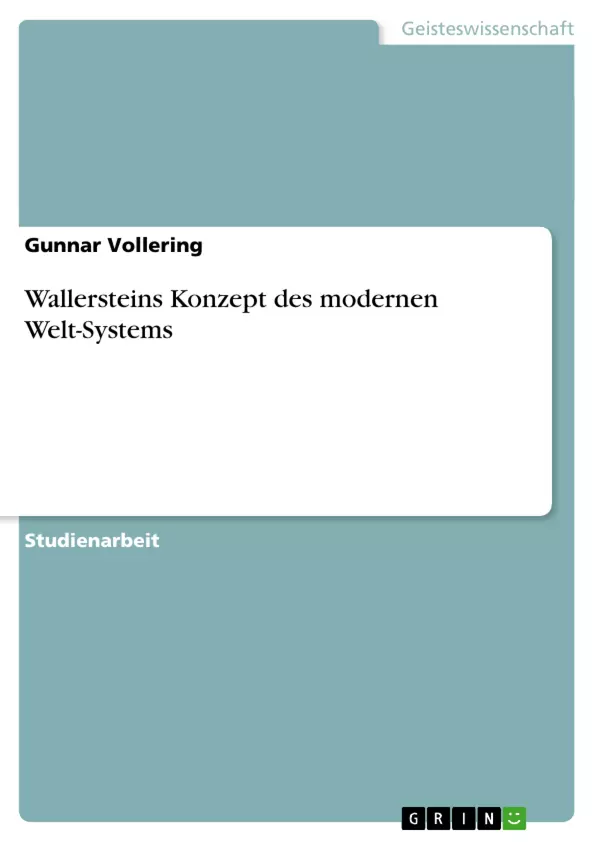Mit dem 1974 erschienenden ersten Band des "Modern World-System" bot der einflussreiche amerikanische Sozialwissenschaftler Immanuel Wallerstein mit seiner historischen und politökonomischen Makrotheorie eine sehr kontroverse diskutierte Alternative zu gängigen Globalisierungstheorien. Zu verorten ist Wallersteins Welt-Systeme-Theorie unter den Einflüssen der Dependenztheorie , der marxistischen Kapitalismusanalyse und der französischen "Annales"-Schule um Fernaud Braudel und als Gegenbewegung zur Diffusionstheorie und ihrer speziellen Fassung, der Modernisierungstheorie.
Wallerstein gehört zu den Weltsystemtheoretikern, die zwei Ansätze gemein haben: Es existiert ein Weltsystem außerhalb nationalstaatlicher Grenzen, das aus sich selbst heraus erklärt werden kann und dieses System hat Auswirkungen auf die Entwicklung bzw. Unterentwicklung der untereinander abhängigen Nationalstaaten. Nach Wallerstein gibt es Welt-Systeme und Mini-Systeme. Welt-Systeme haben eine Arbeitsteilung und können aus mehreren Kulturen bestehen. Sie müssen nicht die ganze Welt umfassen. Mini-Systeme haben nur eine kulturelle Bindung und sind relativ kleine, sehr autonome Subsistenzwirtschaften mit vollständiger Arbeitsteilung. In dieser Abhandlung wird Wallersteins Konzept des "modernen Welt-Systems" skizziert und das Konzept dem marxistischen gegenübergestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Einführung in das Konzept des "modernen Welt-Systems"
- Drei Zonen
- Historie
- Vergleich: Marx meets Wallerstein
- Überschneidungen
- Diskrepanzen
- Kritik am "modernen Welt-System"
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit stellt Immanuel Wallersteins Konzept des "modernen Welt-Systems" vor und analysiert dieses im Vergleich mit der marxistischen Kapitalismusanalyse. Dabei werden die wesentlichen Elemente des Konzepts erläutert, seine historische Entwicklung betrachtet und kritische Aspekte beleuchtet.
- Das "moderne Welt-System" als ein von Wallerstein entwickeltes Konzept der globalen Kapitalismusentwicklung
- Die Analyse der drei Zonen (Kern, Peripherie und Semiperipherie) im "modernen Welt-System"
- Die historischen Stadien der Entwicklung des kapitalistischen Welt-Systems
- Der Vergleich zwischen Wallersteins Konzept und der marxistischen Kapitalismusanalyse
- Kritische Auseinandersetzung mit Wallersteins "modernen Welt-System" Konzept
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in das Konzept des "modernen Welt-Systems" von Immanuel Wallerstein ein und erläutert dessen Bedeutung als Alternative zu gängigen Globalisierungstheorien. Wallerstein sieht das "moderne Welt-System" als ein von nationalstaatlichen Grenzen unabhängiges System, das die Entwicklung der Weltwirtschaft beeinflusst.
Einführung in das Konzept des "modernen Welt-Systems"
Dieses Kapitel beschreibt die Grundzüge des "modernen Welt-Systems" nach Wallerstein. Es werden die drei Zonen (Kern, Peripherie, Semiperipherie) und die historischen Stadien der Entwicklung dieses Systems vorgestellt. Dabei wird die These Wallersteins aufgezeigt, dass sich ein kapitalistisches Welt-System als Reaktion auf die Krise des Feudalismus im 16. Jahrhundert herausgebildet hat.
Vergleich: Marx meets Wallerstein
Dieses Kapitel setzt sich mit den Überschneidungen und Diskrepanzen zwischen Wallersteins "modernen Welt-System" Konzept und der marxistischen Kapitalismusanalyse auseinander. Es beleuchtet Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Analyse des Kapitalismus und der globalen Machtstrukturen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Themen des "modernen Welt-Systems" nach Immanuel Wallerstein. Dabei werden Begriffe wie Kern, Peripherie, Semiperipherie, Kapitalismus, Globalisierung und Dependenztheorie betrachtet und miteinander in Beziehung gesetzt. Die Arbeit analysiert die historische Entwicklung des "modernen Welt-Systems" und beleuchtet kritische Punkte in Bezug auf die wissenschaftliche Fundierung und eurozentrische Sichtweise des Konzepts.
- Arbeit zitieren
- Gunnar Vollering (Autor:in), 2005, Wallersteins Konzept des modernen Welt-Systems, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/45845