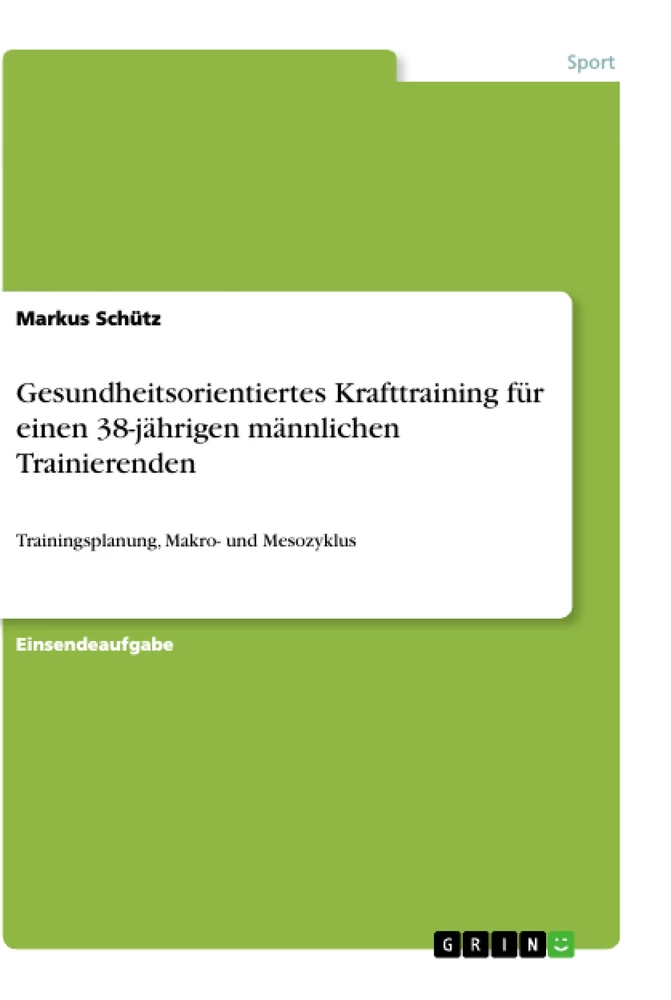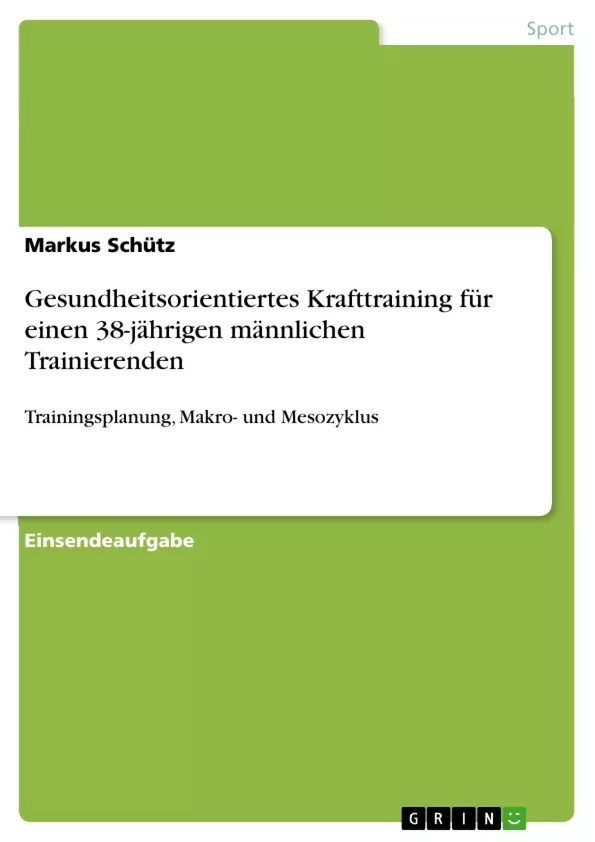Die Arbeit umfasst eine vollständige Trainingsplanung in geforderter tabellarischer Form. Sie besteht aus Diagnose, Zielsetzung, Makrozyklusplanung, Mesozyklusplanung und einer Literaturrecherche. Zudem werden die Tabellen durch einen Fließtext sinnvoll ergänzt. Der 38-jährige Trainierende ist als geübt einzuschätzen und es werden insgesamt 11 Übungen in den Plan integriert, um ein funktionales Ganzkörpertraining zu ermöglichen. Es erfolgt eine exakte Begründung des Makro- und Mesozyklus, die auch beteiligte Muskeln und Gelenke der Übungen einbezieht. Die Hauptziele des Trainierenden sind eine Reduktion des Körperfettanteils und der Muskelaufbau. Die abschließende Literaturrecherche bezieht sich auf die Effekte des Krafttrainings bei Rückenbeschwerden. Abzüglich der Verzeichnisse besteht die Arbeit aus elf Seiten und sie stellt damit eine besonders effiziente Lösung der geforderten Aufgabe dar.
Inhaltsverzeichnis
- Diagnose
- Allgemeine und biometrische Daten
- Krafttestung
- Zielsetzung und Prognose
- Trainingsplanung Makrozyklus
- Trainingsplanung Mesozyklus
- Literaturrecherche
- Literaturverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Zielsetzung dieses Dokuments ist es, einen individuellen Trainingsplan für einen 38-jährigen männlichen Trainierenden zu erstellen, der auf seine Bedürfnisse und Ziele abgestimmt ist. Der Fokus liegt auf gesundheitsorientiertem Krafttraining mit einer umfassenden Diagnose und einer detaillierten Planung des Trainings.
- Diagnose der Fitness- und Gesundheitslage des Trainierenden
- Festlegung von individuellen Trainingszielen
- Erstellung eines Trainingsplans für den Makro- und Mesozyklus
- Integration von Krafttestung zur Leistungsbewertung
- Sicherheits- und Gesundheitserwägungen bei der Trainingsplanung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit der Diagnose, die die Grundlage für die gesamte Trainingsplanung bildet. Es werden allgemeine und biometrische Daten des Trainierenden erhoben, sowie eine Krafttestung durchgeführt, um die Leistungsfähigkeit zu ermitteln. Das zweite Kapitel widmet sich der Zielsetzung und Prognose, die auf Basis der Diagnose individuelle Trainingsziele formulieren. Die weiteren Kapitel befassen sich mit der detaillierten Planung des Trainings, sowohl im Makro- als auch im Mesozyklus, wobei die Trainingsintensitäten und Übungen auf den individuellen Leistungsstand des Trainierenden angepasst werden.
Schlüsselwörter
Gesundheitsorientiertes Krafttraining, Trainingsplanung, Makrozyklus, Mesozyklus, Diagnose, Krafttestung, Biometrische Daten, Leistungsstufe, Trainingsintensitäten, individuelle Ziele, Sicherheit, Gesundheit, Leistungsentwicklung.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptziele eines gesundheitsorientierten Krafttrainings?
Die primären Ziele sind meist der Muskelaufbau, die Reduktion des Körperfettanteils und die Verbesserung der allgemeinen funktionalen Fitness.
Warum ist eine Diagnose vor Trainingsbeginn wichtig?
Die Diagnose erfasst biometrische Daten und die aktuelle Kraftleistungsfähigkeit, um den Trainingsplan sicher und effektiv an den individuellen Leistungsstand anzupassen.
Was versteht man unter Makro- und Mesozyklusplanung?
Der Makrozyklus stellt die langfristige Planung (Monate) dar, während der Mesozyklus die mittelfristige Strukturierung (Wochen) der Trainingsbelastung festlegt.
Kann Krafttraining bei Rückenbeschwerden helfen?
Ja, gezieltes Krafttraining stärkt die stützende Muskulatur und kann laut aktueller Literaturrecherche effektiv zur Linderung von Rückenbeschwerden beitragen.
Wie viele Übungen sollte ein Ganzkörpertraining umfassen?
In diesem Modellplan werden 11 Übungen integriert, um alle großen Muskelgruppen funktional und ganzheitlich anzusprechen.
- Quote paper
- Markus Schütz (Author), 2018, Gesundheitsorientiertes Krafttraining für einen 38-jährigen männlichen Trainierenden, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/457609