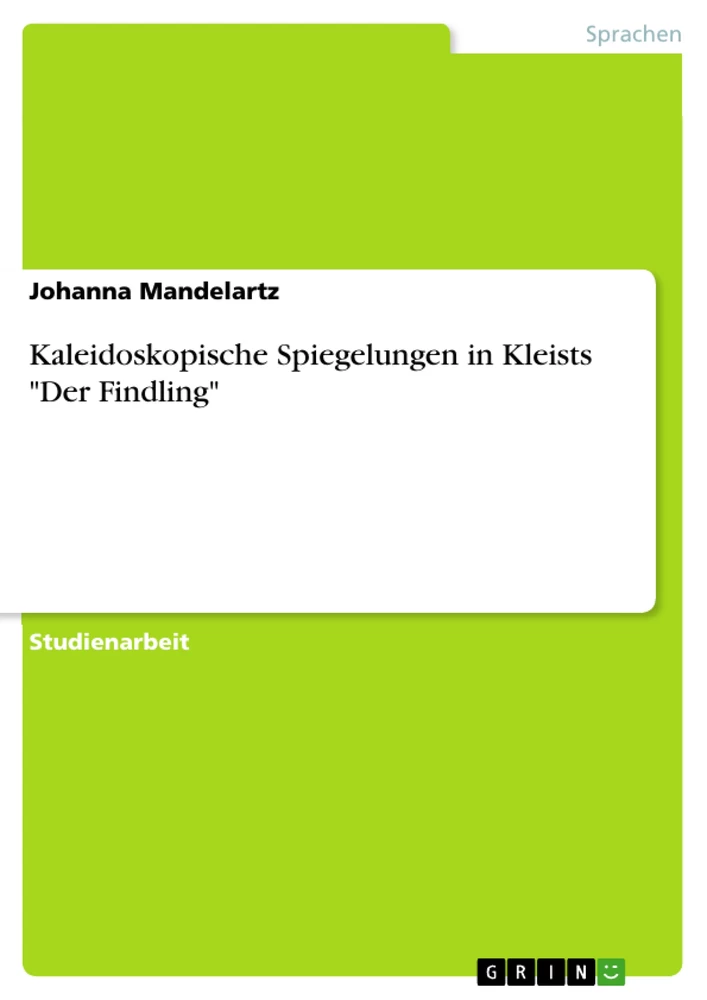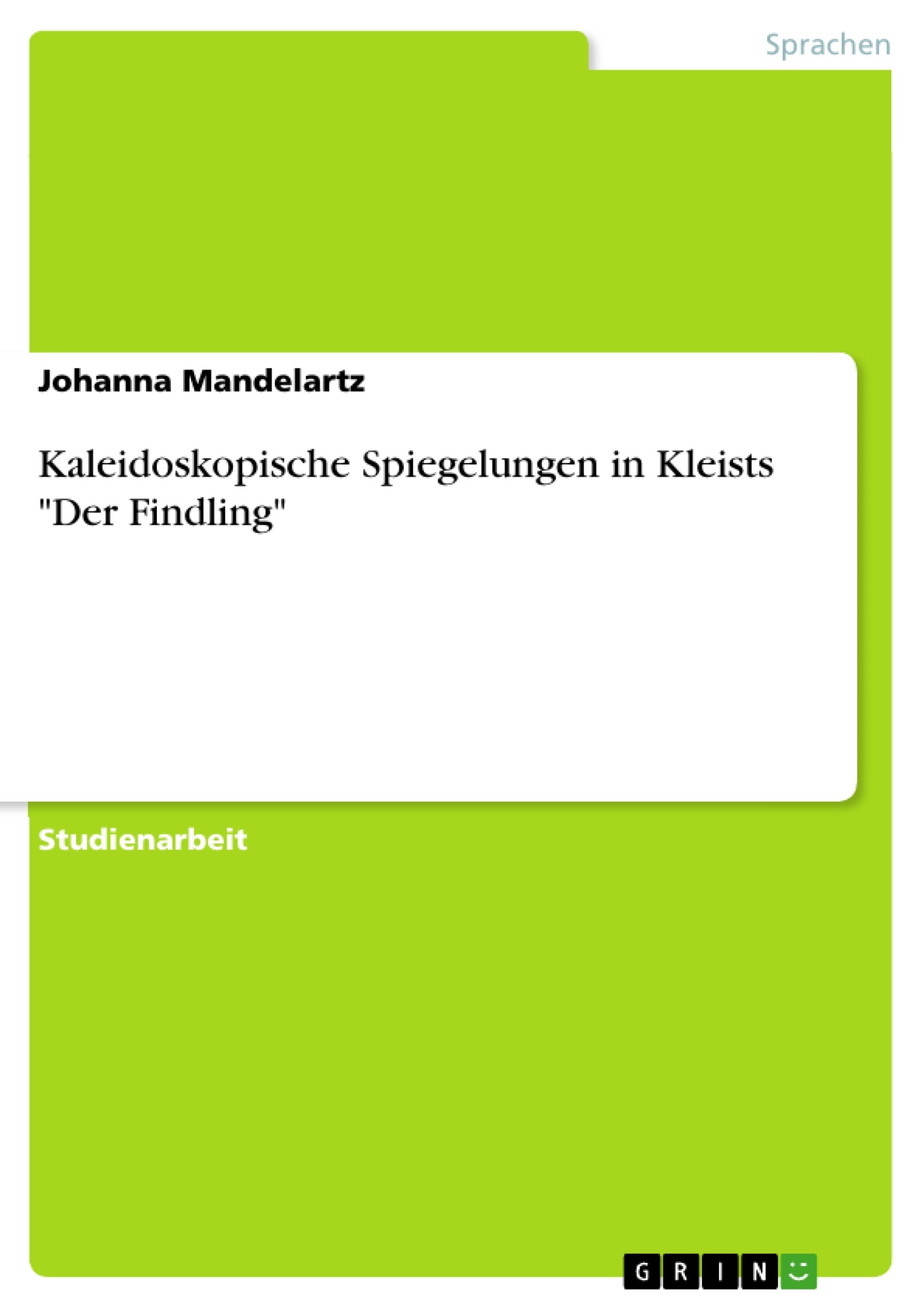Vielleicht ist es schon vom Ansatz her falsch, im Findling nach einer klaren Unterteilung in Gut und Böse bei einzelnen Figuren zu suchen. Wenn man sich die Makrostruktur der Erzählung ansieht, ist diese nämlich voller „Spiegelbilder“ der immer wieder gleichen Elemente, die sich wie in einem Kaleidoskop, das man schüttelt, zu immer neuen Bildern kombinieren.
Wenn dies stimmt, dann landet dort, wo einmal das „Gute“ ist, zwangsläufig auch einmal das „Böse“ und umgekehrt. In diesem Fall ist es aber zwecklos, nach der moralischen Wahrheit zu suchen, denn es ergeben sich mit jedem Schütteln des Kaleidoskops, mit jedem Lesen des Textes notwendigerweise immer wieder neue Facetten.
Inhaltsverzeichnis
- Der (un-)dankbare Findling: Stimmen der Forschung
- Spiegelungen im Findling
- Spiegelungen der Eltern-Kind-Beziehungen: Nicolo/Paolo
- Spiegelungen der Eltern-Kind-Beziehungen: Klara
- Spiegelungen der Eltern-Kind-Beziehungen: Papst/Antonio
- Colinos Spiegelbild: Nicolo
- Fazit: Überforderung der Leser durch Brechung der Rollen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert Heinrich von Kleists Novelle „Der Findling“ unter dem Aspekt der kaleidoskopartigen Spiegelungen. Die Autorin untersucht, wie die verschiedenen Elemente der Erzählung, insbesondere die Figurenbeziehungen, durch wiederholte Spiegelungen und Umkehrungen ein komplexes und mehrdeutiges Gesamtbild erzeugen.
- Die Rolle des Findelkindes Nicolo in der Erzählung
- Die Darstellung von Eltern-Kind-Beziehungen und ihre Spiegelungen
- Die Konstruktion von Schuld und Verantwortung durch Spiegelungen
- Die Brechung von Rollen und Normen in der Erzählung
- Die Bedeutung des Kaleidoskops als Metapher für die Struktur der Erzählung
Zusammenfassung der Kapitel
Im ersten Kapitel beleuchtet die Autorin die verschiedenen Forschungsperspektiven auf Kleists „Der Findling“, wobei sie insbesondere auf die Debatte um die Schuldfrage und die moralische Bewertung der Figuren eingeht. Sie stellt die unterschiedlichen Interpretationen vor, die Nicolo als „Bösen“ oder als Opfer betrachten.
Das zweite Kapitel widmet sich der zentralen These der Arbeit: Kleists Novelle konstruiert ein Kaleidoskop aus Spiegelungen, die die Figuren und Handlungselemente in immer neuen Konstellationen präsentieren. Die Autorin erklärt das Prinzip des Kaleidoskops und dessen Anwendung auf die Analyse der Erzählung.
Im dritten Kapitel analysiert die Autorin die Spiegelungen der Eltern-Kind-Beziehungen in der Erzählung. Sie untersucht die Beziehungen zwischen Nicolo und seinen Adoptivvater Antonio, Nicolo und seinem leiblichen Vater Paolo, Klara und ihrem Sohn Nicolo sowie dem Papst und Antonio.
Das vierte Kapitel befasst sich mit der Spiegelung von Nicolos Rolle als Findelkind. Die Autorin zeigt, wie Kleist verschiedene Aspekte von Nicolos Identität spiegelt und so eine mehrschichtige Charakterzeichnung kreiert.
Schlüsselwörter
Kleist, Der Findling, Kaleidoskop, Spiegelung, Figurenbeziehungen, Eltern-Kind-Beziehungen, Schuldfrage, Moral, Interpretation, Mehrdeutigkeit.
- Quote paper
- Johanna Mandelartz (Author), 2013, Kaleidoskopische Spiegelungen in Kleists "Der Findling", Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/455730