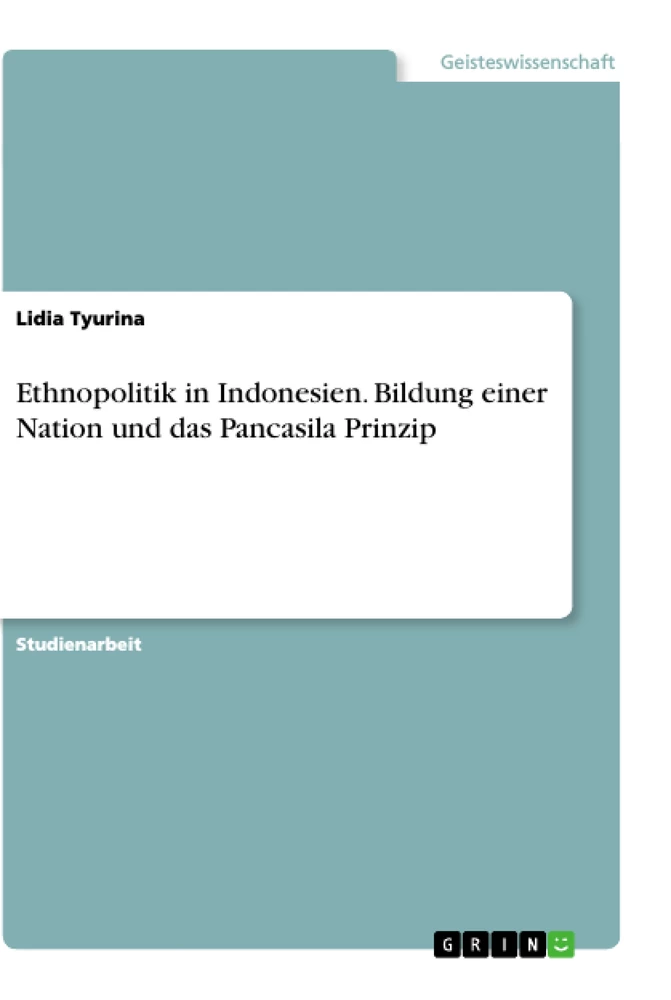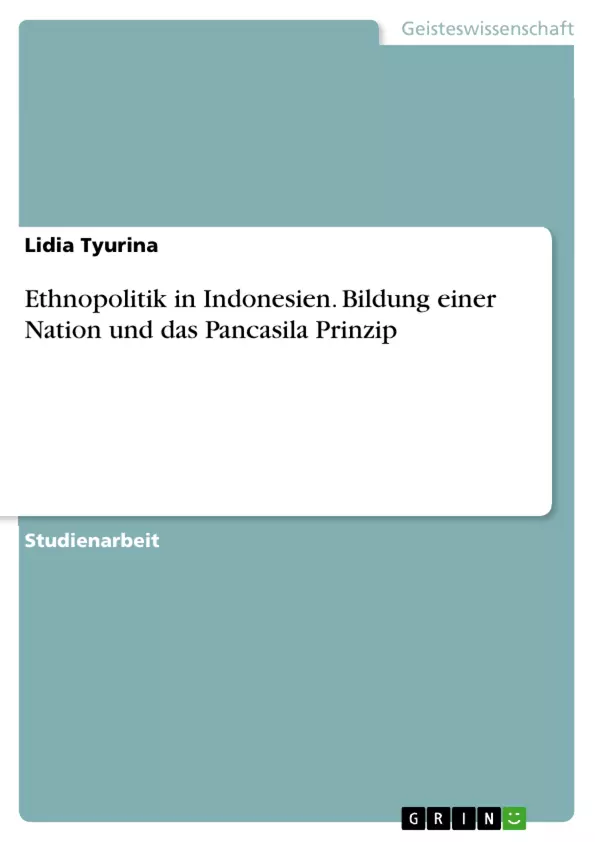In dieser Arbeit beschäftige ich mich mit der Ethnopolitik Indonesiens unter dem Schwerpunkt der Bildung der indonesischen Nation nach der jahrhundertelangen Herrschaft der niederländischen Kolonialmacht, sowie mit dem Pancasila Prinzip als nationale Ideologie des neuen Staates.
Doch was genau ist Ethnopolitik? Es kann als Politik von einem Staat gegenüber seiner Bevölkerung, Eingeborenen als auch Minderheiten oder Migranten im eigenen Land gesehen werden. Weshalb sich ausgerechnet Indonesien sehr gut für die Erforschung dieses Gebiets eignet, will ich in dieser Arbeit darstellen und auch einige Zahlen in Statistiken leichter verständlich machen.
Zunächst möchte ich einen Einblick in die ethnische und religiöse Vielfalt Indonesiens geben. Dann behandle ich die Politik Indonesiens zur Zeit der Bildung des indonesischen Nationalstaates und erläutere die auftretenden Schwierigkeiten dieser gewaltigen Aufgabe. Zum Schluss beschäftige ich mich mit der Pancasila als einheits-tragendem Element der indonesischen Politik, welches bis zum heutigen Tag in Kraft ist. Im Fazit lege ich noch einige eigene Überlegungen zu diesem Thema dar.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Indonesien - ein multiethnischer und multireligiöser Staat
- 3 Bildung der indonesischen Nation
- 3.1 Integration der ethnischen Gruppen
- 3.2 Politische Hintergründe der Bildung einer nationalen Einheit
- 3.3 Das Pancasila Prinzip als Staatsideologie
- 4 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Ethnopolitik Indonesiens, insbesondere die Herausbildung der indonesischen Nation nach der niederländischen Kolonialherrschaft und die Rolle des Pancasila-Prinzips als nationale Ideologie. Die Arbeit analysiert die Herausforderungen und Erfolge bei der Integration multiethnischer und multireligiöser Gruppen zu einer nationalen Einheit.
- Ethnische und religiöse Vielfalt Indonesiens
- Politische Prozesse der nationalen Einheitsbildung
- Das Pancasila-Prinzip als integratives Element
- Herausforderungen der nationalen Integration
- Die Rolle von Kultur und Politik in der nationalen Identitätsbildung
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Ethnopolitik in Indonesien ein und stellt die Forschungsfrage nach den Hintergründen und Hindernissen bei der Bildung einer Nation in einem multiethnischen und multireligiösen Kontext. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit, der einen Einblick in die ethnische und religiöse Vielfalt Indonesiens gibt, die Politik der nationalen Einheitsbildung beleuchtet und das Pancasila-Prinzip als einheitstiftendes Element analysiert. Der Fokus liegt auf der Untersuchung Indonesiens als Fallbeispiel für die Herausforderungen und Strategien der nationalen Integration in einem vielschichtigen gesellschaftlichen Umfeld.
2 Indonesien - ein multiethnischer und multireligiöser Staat: Dieses Kapitel beschreibt die immense ethnische und religiöse Vielfalt Indonesiens. Die geographische Ausdehnung des Landes auf über 17.000 Inseln und die daraus resultierenden demografischen und ökonomischen Disparitäten zwischen den Regionen werden als wichtige Faktoren für die Herausforderungen der nationalen Integration hervorgehoben. Es werden die zahlreichen ethnischen Gruppen, Sprachen und Religionen des Landes benannt und ihre ungleiche Verteilung aufgezeigt. Der Islam als dominierende Religion wird im Kontext der multireligiösen Gesellschaft Indonesiens erläutert, wobei betont wird, dass Indonesien trotz der muslimischen Mehrheit keine islamische Nation ist. Die Notwendigkeit einer staatlichen Integrationspolitik zur Bildung einer nationalen Einheit aus dieser heterogenen Gesellschaft wird deutlich gemacht.
3 Bildung der indonesischen Nation: Dieses Kapitel analysiert die Prozesse der nationalen Integration in Indonesien. Es untersucht die Herausforderungen der kulturellen Homogenisierung und den Konflikt zwischen traditionellen ethnischen Loyalitäten und der modernen nationalen Identität. Die staatliche Integrationspolitik und ihre paradoxe Wirkung auf das ethnische Bewusstsein werden diskutiert. Der Abschnitt beleuchtet die politische Entwicklung während der revolutionären Phase von 1945 bis 1949 und die Bedeutung des Kampfes gegen die niederländische Kolonialherrschaft für das Entstehen eines nationalen Zusammengehörigkeitsgefühls. Die Rolle der Verfassung von 1945 und das Motto "Bhineka tunggal ika" ("Einheit in der Vielfalt") werden als wichtige ideologische Grundlagen für die nationale Integration erklärt. Der Kompromiss zwischen Nationalisten und Muslimen bei der Gründung des Staates und die Bedeutung des Pancasila-Prinzips für den gesellschaftlichen Zusammenhalt werden thematisiert.
Schlüsselwörter
Ethnopolitik, Indonesien, nationale Integration, Pancasila, multiethnischer Staat, multireligiöse Gesellschaft, nationale Identität, Kolonialismus, Javanisierung, Bhineka tunggal ika.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Ethnopolitik Indonesiens
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Ethnopolitik Indonesiens, insbesondere die Herausbildung der indonesischen Nation nach der niederländischen Kolonialherrschaft und die Rolle des Pancasila-Prinzips als nationale Ideologie. Der Fokus liegt auf der Analyse der Herausforderungen und Erfolge bei der Integration multiethnischer und multireligiöser Gruppen zu einer nationalen Einheit.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die ethnische und religiöse Vielfalt Indonesiens, die politischen Prozesse der nationalen Einheitsbildung, das Pancasila-Prinzip als integratives Element, die Herausforderungen der nationalen Integration und die Rolle von Kultur und Politik in der nationalen Identitätsbildung. Die geographische Ausdehnung Indonesiens und die daraus resultierenden demografischen und ökonomischen Disparitäten werden ebenfalls berücksichtigt.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit besteht aus vier Kapiteln: einer Einleitung, einem Kapitel über Indonesien als multiethnischen und multireligiösen Staat, einem Kapitel über die Bildung der indonesischen Nation und einem Fazit. Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und den Aufbau der Arbeit vor. Kapitel 2 beschreibt die ethnische und religiöse Vielfalt. Kapitel 3 analysiert die Prozesse der nationalen Integration, die staatliche Integrationspolitik und die Rolle des Pancasila-Prinzips. Das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen.
Was ist das Pancasila-Prinzip und welche Rolle spielt es?
Das Pancasila-Prinzip ist die nationale Ideologie Indonesiens und spielt eine zentrale Rolle im Prozess der nationalen Integration. Die Arbeit analysiert, wie dieses Prinzip als ein einheitstiftendes Element fungiert und welche Bedeutung es für den gesellschaftlichen Zusammenhalt hat. Es wird im Kontext des Kompromisses zwischen Nationalisten und Muslimen bei der Staatsgründung betrachtet.
Welche Herausforderungen werden bei der nationalen Integration in Indonesien diskutiert?
Die Arbeit diskutiert die Herausforderungen der kulturellen Homogenisierung, den Konflikt zwischen traditionellen ethnischen Loyalitäten und der modernen nationalen Identität, die paradoxe Wirkung der staatlichen Integrationspolitik auf das ethnische Bewusstsein und die Bewältigung der immensen ethnischen und religiösen Vielfalt Indonesiens.
Welche Rolle spielt der Kolonialismus?
Der Kampf gegen die niederländische Kolonialherrschaft wird als wichtiger Faktor für das Entstehen eines nationalen Zusammengehörigkeitsgefühls betrachtet und seine Bedeutung für die Bildung der nationalen Identität analysiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Ethnopolitik, Indonesien, nationale Integration, Pancasila, multiethnischer Staat, multireligiöse Gesellschaft, nationale Identität, Kolonialismus, Javanisierung, Bhineka tunggal ika.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit richtet sich an ein akademisches Publikum und dient der Analyse von Themen im Bereich der Ethnopolitik und der nationalen Integrationspolitik.
- Arbeit zitieren
- Lidia Tyurina (Autor:in), 2012, Ethnopolitik in Indonesien. Bildung einer Nation und das Pancasila Prinzip, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/454924