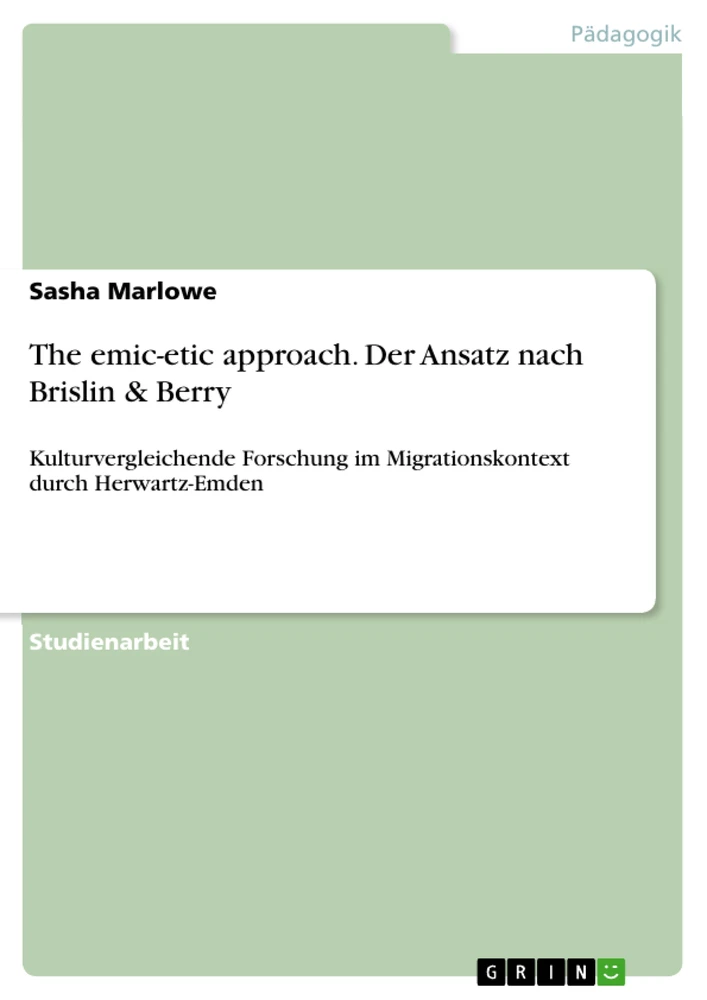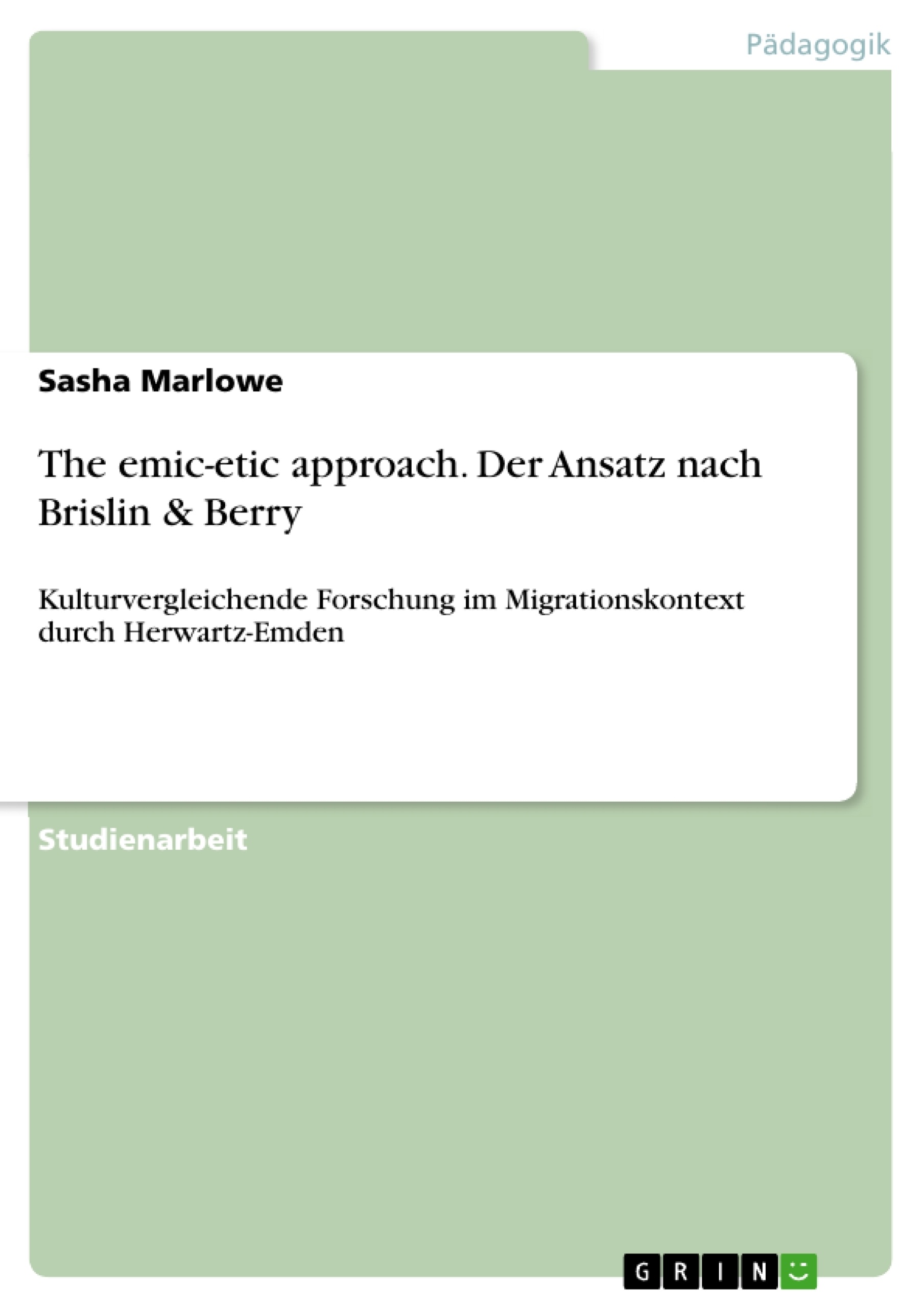Die Unterscheidung in kulturspezifisch und -übergreifend findet sich in den Denkweisen vieler interkulturell angelegter Forschungen. Die zuständige Wissenschaft, die kulturvergleichende Psychologie, macht sich zur Aufgabe, menschliches Verhalten und die Entwicklung des Menschen unter dem Gesichtspunkt verschiedener kultureller Grundvoraussetzungen zu untersuchen. Die Differenzierung von Konzepten in die Kategorien „spezifisch“ und „universal“ suggeriert der Forschung einen besseren Blick auf die Vergleichbarkeit. Mittels universaler Konzepte, die weltweit feststellbar sind, lassen sich verschiedene Kulturen miteinander in Relation setzen.
Die Begrifflichkeiten setzt erstmalig Pike (1967) fest, indem er ausgehend von linguistischen Analysen die Begriffe emic und etic etabliert. Aufbauend auf diesem Ansatz beschäftigen sich weitere Kulturforscher und Psychologen mit dieser Theorie und entwickeln sie weiter. Im Fokus dieser Arbeit stehen vor allem Berry, Brislin und Herwartz-Emden.
Brislin thematisiert in seinem Buch „Understanding Culture’s Influence on Behaviour“ (1993) die Begrifflichkeiten emic und etic und soll im Zuge dieser Arbeit als Grundlage des Ansatzes der Unterteilung zu Rate gezogen werden. Seine Arbeit dient hier der Veranschaulichung und Demonstration der zu beachtenden Unterscheidung, aber auch der damit einhergehenden und den allgemein zugrundeliegenden Problemen.
Bei Berry soll die Konzentration neben der allgemeinen Arbeit zu der kulturvergleichenden Forschung vor allem auf dessen Erweiterung des emic-etic Ansatzes, der zu Beginn definiert wird, durch die neue Differenzierung in die Bereiche emic, imposed etic & derived etic liegen, da auch Herwartz-Emden wieder auf diese Anpassung zurückgreift und aufbauend darauf, ihre eigene Arbeit konzipiert.
Die Entwicklung eines Strukturgitters zur Erweiterung und Veranschaulichung des veränderten Ansatzes der emic-etic Theorie durch Herwartz-Emden bei der Umsetzung ihrer Untersuchung des Konzeptes der Mutterschaft soll als letzte Veränderung des Ansatzes thematisiert und in diesem Zusammenhang genauer untersucht werden.
Beeinflusst wurde die Erweiterung nicht zuletzt von den vorliegenden Forschungskontexten, den Untersuchungsbereich der Migration, dem alle untersuchten Probanden zuzuordnen sind. Im Stile der kulturvergleichenden Forschung soll hier ein Vergleich innerhalb der zugrundeliegenden Theorie stattfinden, beziehungsweise zumindest im Ansatz versucht werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Ziele und Besonderheiten der kulturvergleichenden Psychologie
- 2.1 Increasing the range of variables - Vergrößerung der Reichweite
- 2.2 Uncofounding variables – Trennung zusammengehöriger Konzepte
- 2.3 Increased sensitivity of context - Vergrößerung der Sensibilität für Kontexte
- 3 Der emic-etic approach
- 3.1 Wortherkunft
- 3.2 emics und etics
- 3.3 Hilfeprojekt in Afrika: Ein Beispiel (Beispiel nach Brislin 1993:74ff)
- 4 Erweiterungen: John W. Berry & Leonie Herwartz-Emden
- 4.1 Schwerpunkt der Untersuchung von Herwartz-Emden
- 4.2 Das „emic-etic“-Strukturgitter
- 4.3 Derived etic approach
- 4.4 Zur Trennung von emics und etics nach Berry (1989)
- 4.5 Anwendung und Besonderheiten des Strukturgitters
- 5 Herwartz-Emden vs. Berry/Brislin
- 6 Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den emic-etic Ansatz in der kulturvergleichenden Psychologie, insbesondere dessen Entwicklung und Anwendung im Migrationskontext. Der Fokus liegt auf der Erweiterung des ursprünglichen Ansatzes durch Berry und der weiteren Adaption durch Herwartz-Emden. Es wird ein Vergleich zwischen den verschiedenen Ansätzen gezogen und die Bedeutung des Strukturgitters für die kulturvergleichende Forschung im Migrationskontext beleuchtet.
- Der emic-etic Ansatz nach Brislin & Berry
- Die Erweiterung des emic-etic Ansatzes durch Berry (emic, imposed etic, derived etic)
- Die Adaption und Anwendung des Ansatzes durch Herwartz-Emden im Migrationskontext
- Das „emic-etic“-Strukturgitter von Herwartz-Emden
- Vergleich der Ansätze von Herwartz-Emden und Berry/Brislin
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der kulturvergleichenden Psychologie ein und stellt die grundlegende Fragestellung nach universalen und kulturspezifischen Aspekten menschlichen Verhaltens dar. Sie hebt die Bedeutung der Unterscheidung zwischen emic und etic hervor, basierend auf den Arbeiten von Pike (1967), und kündigt die zentralen Autoren – Berry, Brislin und Herwartz-Emden – an, deren Ansätze im weiteren Verlauf der Arbeit analysiert werden. Die Arbeit positioniert sich als Vergleich verschiedener Ansätze innerhalb der kulturvergleichenden Forschung, insbesondere im Kontext der Migration.
2 Ziele und Besonderheiten der kulturvergleichenden Psychologie: Dieses Kapitel beleuchtet die wachsende Relevanz der kulturvergleichenden Psychologie angesichts der Globalisierung. Es thematisiert die zentralen Forschungsfragen dieser Disziplin, die sich mit universalen Gemeinsamkeiten und kulturspezifischen Unterschieden im menschlichen Verhalten auseinandersetzt. Das Kapitel betont die Notwendigkeit, sowohl universelle als auch individuelle Konzepte zu berücksichtigen, um ein umfassendes Verständnis verschiedener Kulturen zu erlangen.
3 Der emic-etic approach: Dieses Kapitel definiert den emic-etic Ansatz, beginnend mit der Wortherkunft der Begriffe. Es erläutert die Unterscheidung zwischen emischen (kulturspezifischen) und etischen (kulturübergreifenden) Perspektiven und illustriert diese anhand eines Beispiels aus Brislins Werk (1993). Die verschiedenen Analyseebenen (phonemic und phonetic) werden ebenfalls thematisiert und in den Kontext des kulturvergleichenden Ansatzes eingeordnet.
4 Erweiterungen: John W. Berry & Leonie Herwartz-Emden: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Erweiterungen des emic-etic Ansatzes durch Berry und Herwartz-Emden. Berry’s Erweiterung um „imposed etic“ und „derived etic“ wird detailliert beschrieben. Der Schwerpunkt liegt auf der Analyse des Strukturgitters von Herwartz-Emden, das den erweiterten Ansatz veranschaulicht und in ihren Untersuchungen zur Mutterschaft im Migrationskontext angewendet wird. Der „derived etic“ Ansatz und seine Anwendung werden im Detail erklärt, wobei die Abgrenzung von den Ansätzen von Brislin und Berry deutlich herausgearbeitet wird.
Schlüsselwörter
Emic-etic Ansatz, kulturvergleichende Psychologie, Migrationskontext, Herwartz-Emden, Berry, Brislin, kulturspezifische und kulturübergreifende Konzepte, Strukturgitter, imposed etic, derived etic, Mutterschaft.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Text: Emic-Etic Ansatz in der kulturvergleichenden Psychologie
Was ist der Gegenstand des Textes?
Der Text befasst sich mit dem emic-etic Ansatz in der kulturvergleichenden Psychologie, insbesondere dessen Entwicklung und Anwendung im Migrationskontext. Schwerpunkt ist der Vergleich der Ansätze von Brislin & Berry mit der Erweiterung und Adaption durch Herwartz-Emden, sowie die Bedeutung des von Herwartz-Emden entwickelten Strukturgitters.
Welche Autoren werden im Text behandelt?
Die zentralen Autoren sind John W. Berry, Richard Brislin und Leonie Herwartz-Emden. Der Text analysiert und vergleicht deren unterschiedliche Ansätze zum emic-etic Verfahren.
Was ist der emic-etic Ansatz?
Der emic-etic Ansatz ist ein methodischer Ansatz in der kulturvergleichenden Psychologie, der zwischen emischen (kulturspezifischen) und etischen (kulturübergreifenden) Perspektiven unterscheidet. Der Text erläutert die Wortherkunft, die Unterscheidung und illustriert diese anhand von Beispielen.
Wie wird der emic-etic Ansatz erweitert?
Berry erweitert den ursprünglichen Ansatz um die Konzepte "imposed etic" und "derived etic". Herwartz-Emden adaptiert und wendet den Ansatz, insbesondere den "derived etic" Ansatz, im Migrationskontext an und entwickelt ein "emic-etic"-Strukturgitter zur systematischen Erfassung von Daten.
Was ist das "emic-etic"-Strukturgitter?
Das "emic-etic"-Strukturgitter von Herwartz-Emden ist ein Werkzeug zur Veranschaulichung und Anwendung des erweiterten emic-etic Ansatzes. Es dient der systematischen Erfassung und Analyse von Daten im kulturvergleichenden Kontext, besonders im Migrationskontext, beispielsweise in Bezug auf Mutterschaft.
Wie unterscheiden sich die Ansätze von Herwartz-Emden und Berry/Brislin?
Der Text vergleicht explizit die Ansätze von Herwartz-Emden mit denen von Berry und Brislin. Der Fokus liegt auf den Erweiterungen und Adaptionen des ursprünglichen emic-etic Ansatzes durch Herwartz-Emden, insbesondere im Hinblick auf den "derived etic" Ansatz und die Anwendung des Strukturgitters.
Welche Ziele verfolgt der Text?
Der Text untersucht die Entwicklung und Anwendung des emic-etic Ansatzes, vergleicht verschiedene Ansätze und beleuchtet die Bedeutung des Strukturgitters für die kulturvergleichende Forschung, besonders im Migrationskontext. Der Fokus liegt auf dem Verständnis kulturspezifischer und kulturübergreifender Aspekte menschlichen Verhaltens.
Welche Kapitel umfasst der Text?
Der Text gliedert sich in Kapitel zu Einleitung, Zielen und Besonderheiten der kulturvergleichenden Psychologie, dem emic-etic Ansatz, den Erweiterungen durch Berry und Herwartz-Emden, einem Vergleich der Ansätze und einem Fazit.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Emic-etic Ansatz, kulturvergleichende Psychologie, Migrationskontext, Herwartz-Emden, Berry, Brislin, kulturspezifische und kulturübergreifende Konzepte, Strukturgitter, imposed etic, derived etic, Mutterschaft.
- Arbeit zitieren
- Sasha Marlowe (Autor:in), 2017, The emic-etic approach. Der Ansatz nach Brislin & Berry, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/454759