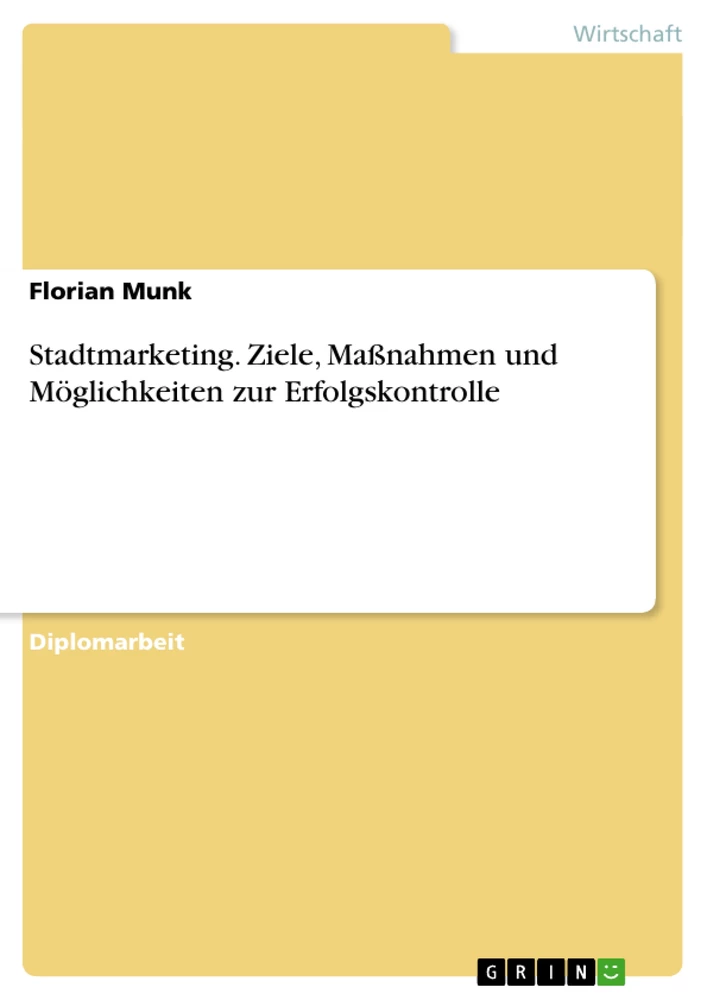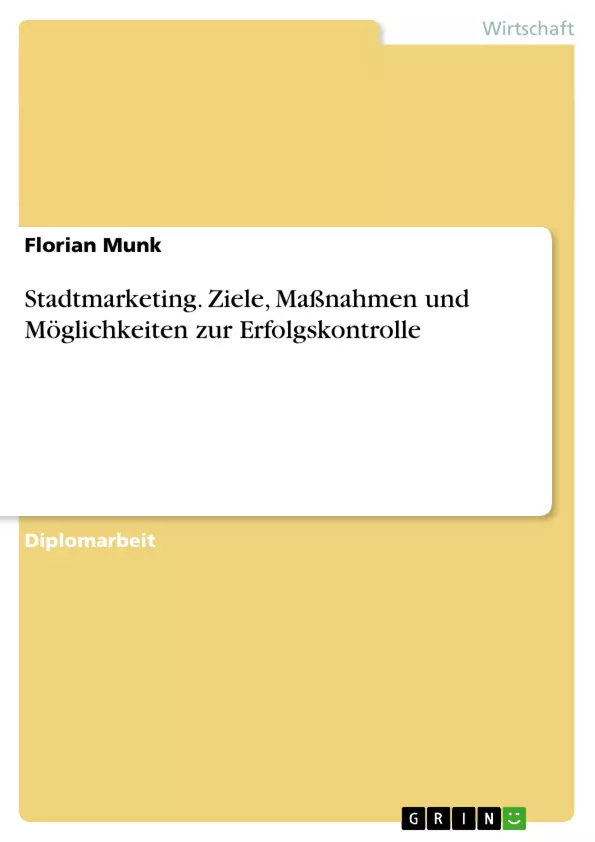In Fachpublikationen und vor allem in der kommunalen Praxis wird der abstrakt wirkende Begriff "Stadtmarketing" oftmals unterschiedlich ausgelegt. Dies führt zu Missverständnissen, die bereits im Vornherein den Erfolg späterer Stadtmarketingaktivitäten gefährden können. Von Vielen wird Stadtmarketing z.B. mit Stadtwerbung und "Verkaufen" einer Stadt gleichgesetzt. Befürworter verbinden damit Hoffnungen und finden den Begriff zeitgemäß. Gegner befürchten allerdings, dass Stadtmarketing jeden Lebensbereich einer Stadt nur unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten betrachtet und sie führen an, dass man eine Stadt nicht verkaufen könne.4
Diese Interpretationen stellen allesamt nicht zufrieden, weshalb in Kapitel 2 die Begriffe "Marketing" und "Stadtmarketing" auf wissenschaftliche Weise definiert werden. Anschließend wird Stadtmarketing von den ähnlich klingenden Bezeichnungen "Regionalmarketing" und "City-Marketing" abgegrenzt. Stadtmarketing unternimmt den Versuch ein Instrument der Betriebswirtschaftslehre auf den öffentlichen Sektor zu übertragen. Das Marketing für Non-Profit-Organisationen hat bereits gezeigt, dass Marketing erfolgreich auf den nicht-kommerziellen Bereich übertragen werden kann. Zwar ist zu berücksichtigen, dass die Aktivitäten einer Kommunalverwaltung durchaus auch in den kommerziellen Bereich hineinragen (Bsp.: Tourismusförderung), dennoch besteht Zuversicht, dass sich auch hier Erfolge einstellen. Am Ende des zweiten Kapitels wird gezeigt, welche Restriktionen bei der Übertragung des betriebswirtschaftlichen Marketinginstrumentariums auf den öffentlichen Sektor zu beachten sind.
Das dritte Kapitel vermittelt wichtige Hintergründe des Stadtmarketings. Es wird dessen historische Entwicklung dargestellt und auf die Gründe für das starke Interesse der Kommunen an diesem neuen Instrument eingegangen. Sie waren ursächlich für die rasante Verbreitung, die dem Stadtmarketing testiert werden darf. Das Kapitel schließt mit der Untersuchung, in welchem Zusammenhang Stadtmarketing mit den Reformbemühungen des New Public Managements zu sehen ist.
Das vierte Kapitel ist der hinter dem Stadtmarketing stehenden Philosophie gewidmet. Es beginnt mit einer kompakten Übersicht der wichtigsten Merkmale. Daraufhin wird der Kreis der Mitwirkenden durchleuchtet und die unterschiedlichen Zielgruppen und Zielsetzungen werden thematisiert. Es folgt eine Erörterung verschiedener Institutionalisierungsformen und Finanzierungsmöglichkeiten.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Begriffsdefinitionen und -abgrenzungen
- 2.1 Marketing
- 2.2 Stadtmarketing
- 2.3 Abgrenzung von Stadtmarketing zu Regional- und City-Marketing
- 2.4 Restriktionen bei der Übertragung des Marketinginstrumentariums aus der Betriebswirtschaftslehre auf den öffentlichen Sektor
- 3 Hintergründe des Stadtmarketings
- 3.1 Historische Entwicklung
- 3.2 Gründe für das starke Interesse der Kommunen am Stadtmarketing
- 3.2.1 Verschärfter Standortwettbewerb
- 3.2.2 Veränderte Beurteilungskriterien für die Qualität einer Stadt
- 3.2.3 Attraktivitätsverlust der Stadtzentren
- 3.2.4 Mitbeteiligung der Bürger an der Kommunalpolitik
- 3.2.5 Sonstige
- 3.3 Stadtmarketing im Kontext des New Public Managements
- 4 Stadtmarketing-Philosophie
- 4.1 Merkmale des Stadtmarketings
- 4.2 Mitwirkende am Stadtmarketingprozess und dessen differenzierte Maßnahmenplanung
- 4.2.1 Zielgruppen und Akteure
- 4.2.2 Externe Berater
- 4.3 Ziele des Stadtmarketings
- 4.4 Institutionalisierung
- 4.5 Finanzierung
- 4.6 Public Private Partnership
- 5 Der Stadtmarketingprozess
- 5.1 Initialisierung
- 5.2 Situationsanalyse
- 5.2.1 Analyse von Stärken und Schwächen
- 5.2.2 Analyse von Chancen und Risiken
- 5.2.3 Image-Analyse
- 5.3 Zielbestimmung
- 5.3.1 Vorgehensweise
- 5.3.2 Entwicklung von Stadtvisionen und Zusammenfassung zu einem Leitbild
- 5.3.3 Stadtidentität (City Identity)
- 5.3.4 Stadtmarketingzielsystem
- 5.4 Strategie- und Maßnahmenplanung
- 5.4.1 Strategieentwicklung
- 5.4.2 Maßnahmen- und Detailplanung
- 5.4.3 Arbeitskreise
- 5.5 Umsetzung
- 5.6 Erfolgskontrolle
- 5.6.1 Allgemeine Einführung
- 5.6.2 Effektivitätsmatrix von Pal/Sanders
- 5.6.3 Interkommunaler Leistungsvergleich
- 5.6.4 Verdichtung der Indikatoren zu Erfolgsindizes
- 5.6.5 Nutzen-Kosten-Analyse
- 5.6.6 Zusammenfassung
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit analysiert das Stadtmarketing und untersucht dessen Ziele, Maßnahmen und Möglichkeiten zur Erfolgskontrolle. Sie befasst sich mit den theoretischen Grundlagen des Stadtmarketings, den Hintergründen seines Aufkommens, der Entwicklung von Stadtmarketingstrategien und der Evaluation von Erfolgsfaktoren. Die Arbeit beleuchtet den komplexen Prozess des Stadtmarketings und stellt verschiedene Instrumente zur Gestaltung und Umsetzung von Maßnahmen vor.
- Begriffsdefinition und Abgrenzung des Stadtmarketings
- Historische Entwicklung und aktuelle Herausforderungen des Stadtmarketings
- Die Rolle von Akteuren, Zielgruppen und Finanzierung im Stadtmarketingprozess
- Strategieentwicklung und Erfolgskontrolle im Stadtmarketing
- Analyse und Interpretation von Erfolgsfaktoren im Stadtmarketing
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine Einleitung in das Thema Stadtmarketing und gibt einen Überblick über die behandelten Inhalte. Im zweiten Kapitel werden die Begriffe Marketing, Stadtmarketing und Regionalmarketing definiert und voneinander abgegrenzt. Die Restriktionen bei der Übertragung des Marketinginstrumentariums aus der Betriebswirtschaftslehre auf den öffentlichen Sektor werden ebenfalls diskutiert. Kapitel drei befasst sich mit den Hintergründen des Stadtmarketings, insbesondere mit seiner historischen Entwicklung und den Gründen für das steigende Interesse von Kommunen an diesem Ansatz. Die Kapitel vier und fünf widmen sich der Stadtmarketing-Philosophie und dem Stadtmarketingprozess. In Kapitel vier werden Merkmale, Ziele und Finanzierungsmöglichkeiten des Stadtmarketings beleuchtet, während Kapitel fünf die einzelnen Phasen des Prozesses, von der Initialisierung bis zur Erfolgskontrolle, detailliert betrachtet.
Schlüsselwörter
Stadtmarketing, Regionalmarketing, City-Marketing, Standortwettbewerb, Attraktivitätsverlust, New Public Management, Zielgruppen, Akteure, Strategieentwicklung, Erfolgskontrolle, Effektivitätsmatrix, Interkommunaler Leistungsvergleich, Nutzen-Kosten-Analyse
- Arbeit zitieren
- Florian Munk (Autor:in), 2003, Stadtmarketing. Ziele, Maßnahmen und Möglichkeiten zur Erfolgskontrolle, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/43985