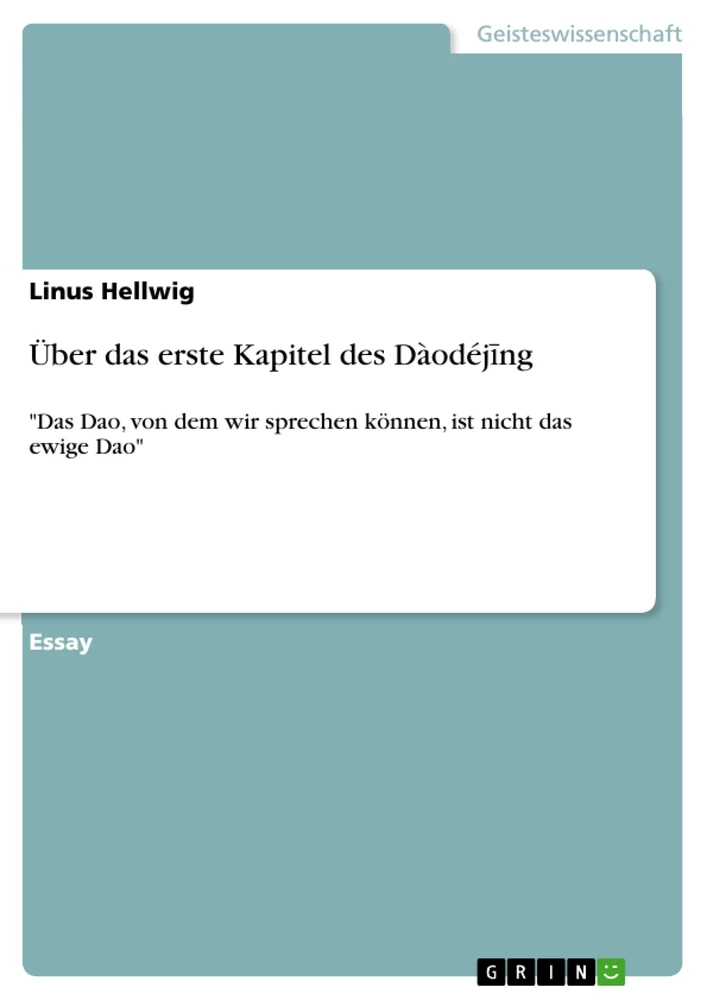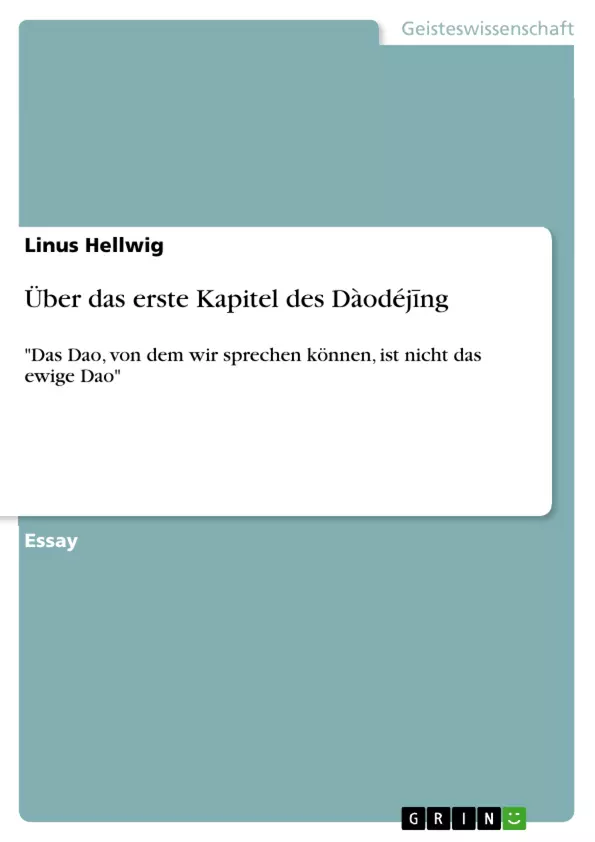„Das Dao, von dem wir sprechen können, ist nicht das ewige Dao“, diese Eröffnungszeilen des Dàodéjīng sind, ähnlich wie das Werk selbst, so tief im chinesischen Bildungskanon verankert, dass sie sogar von der illiteraten Bevölkerung wiedererkannt werden. Und tatsächlich spiegeln sich, wie sich später zeigen lässt, viele wichtige Ansätze Lǎozǐs bereits in diesen Zeilen wieder. Im Folgenden möchte ich von dem ersten der insgesamt 81 Kapitel ausgehen, um über das Dàodéjīng zu reflektieren, da hier meiner Meinung nach bereits das philosophische Fundament des Werkes angelegt wurde. Allerdings stoße ich dabei sogleich auf eine Hürde, über die Lǎozǐ in einer besonderen Weise sinniert: das Problem der Sprache.
Denn so wie sich das wahre Dào in seiner Ursprünglichkeit genuin jeder begrifflichen Fixierung entzieht, so entziehen sich mir die ursprünglichen Begriffe, mit denen Lǎozǐ um schätzungsweise 400 v. Chr. den Versuch unternommen hat, vom Dào zu sprechen.
Schon in seiner Sprachgenetik ist das Dàodéjīng so vieldeutig angelegt, dass unter Sinologen selektiv die Vermutung aufkeimte, zur Zeit Lǎozǐs herrschte ein mündlich überliefertes grammatikalisches Verständnis vor, das eine Interpunktion der Schriftzeichen erübrig hat, uns aber heute leider verloren gegangen sei. Erschwerend kommt hinzu, dass sich die chinesische Sprache so grundsätzlich von den europäischen unterscheidet, dass ein Übersetzer interpretativ vorgehen muss und somit unvermeidlich sein philosophisches Vorverständnis in den Text hineinprojiziert. An diesem Punkt jedoch eröffnet sich ein Ausweg durch die Hilfe eines hermeneutischen Winkelzugs: Betrachtet man die vorhandenen Übersetzungen als Deutungsvarianten des Dàodéjīng, so lässt sich wenigstens durch ein komparatives Vorgehen der Sinn dieses Werkes für eine bestimmte Bevölkerungsgruppe zu einer bestimmten Zeit ermitteln ‒ im Falle dieses Essays also für die Europäer im 20. und 21. Jahrhundert. Schließlich läuft man mit dieser Bescheidenheit auch nicht Gefahr, zu einem vermeintlich endgültigen Textverständnis zu gelangen, das zum einen sicher nicht im Interesse eines Verfassers gelegen hätte, der im Wandel das wirkmächtigste Prinzip des Kosmos begreift, und zum anderen den lebenserhaltenden Diskurs zum Erliegen bringen würde, der die Rezeptionsgeschichte dieses Werkes über 2400 Jahre lang anhalten ließ.
Inhaltsverzeichnis
- Kapitel 1
- Die Übersetzungen des ersten Abschnitts führen in ihrer sinngemäßen Übereinstimmung zu der Gattungsfrage des Dàodéjīng.
- Um ihr auf die Spur zu kommen gilt es zunächst den für das Werk so zentralen Begriff des Dào näher zu beleuchten.
- Das Namenlose oder – je nach Übersetzung – das Nichts, das Nichtsein, bildet den Ursprung von „Himmel“ und „Erde“, was im Chinesischen synonym für das Ganze, die Welt oder den Kosmos zu verstehen ist.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Essay befasst sich mit dem ersten Kapitel des Dàodéjīng, einem zentralen Werk des Taoismus. Ziel ist es, die philosophischen Grundlagen des Werkes zu erforschen und die Bedeutung des Begriffs "Dào" zu beleuchten. Dabei wird der Fokus auf die sprachliche Ambivalenz des Textes gelegt, sowie auf die Herausforderungen, die sich aus der Übersetzung aus dem Chinesischen ergeben.
- Das Problem der Sprache und die Ambivalenz des Dàodéjīng
- Der Begriff des "Dào" und seine verschiedenen Interpretationsmöglichkeiten
- Die Rolle des Wandels und der Dualismen im Dàodéjīng
- Die Unterscheidung zwischen dem "ewigen Dào" und seinen phänomenalen Manifestationen
- Die Bedeutung des "Nichthandelns" (wúwéi) im Kontext des Dàodéjīng
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1
Das erste Kapitel des Dàodéjīng beginnt mit der Feststellung, dass sich das "Dào" nicht sprachlich erfassen lässt. Lǎozĭ betont die Bedeutung des "Namenlosen" als Ursprung von Himmel und Erde und des "Namentragenden" als Mutter der zehntausend Dinge. Das Kapitel stellt die zentrale Dualität des Dàodéjīng vor, die zwischen "Wunschlosigkeit" und "Wunsch" sowie zwischen "Verborgenem" und "Scheinbarem" besteht.
Die Übersetzungen des ersten Abschnitts führen in ihrer sinngemäßen Übereinstimmung zu der Gattungsfrage des Dàodéjīng.
Die Übersetzung des ersten Kapitels durch verschiedene Autoren zeigt die Herausforderungen der sprachlichen Übertragung des Dàodéjīng. Das Werk lehnt es ab, über das "Dào" direkt zu sprechen, was die Frage nach seiner Einordnung als philosophisches Werk aufwirft. Lǎozĭs Verzicht auf die Sprache als Instrument der Analyse wirft die Frage nach der Natur des Dàodéjīng auf. Stellt es eine Form von Mystik dar oder eine alternative Denktradition?
Um ihr auf die Spur zu kommen gilt es zunächst den für das Werk so zentralen Begriff des Dào näher zu beleuchten.
Das Zeichen für "Dào" wird oft mit "Weg" übersetzt. Im Kontext des Dàodéjīng jedoch trägt es eine komplexere Bedeutung. Verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten wie "Naturgesetz", "Sinn" oder "Weltvernunft" beleuchten den vielschichtigen Charakter des Begriffs. Es wird argumentiert, dass die Sprache im Dàodéjīng eher als ein "algebraisches Zeichen für etwas unaussprechliches" zu verstehen ist, das die Dialektik von Immanenz und Transzendenz widerspiegelt.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter des Dàodéjīng sind "Dào", "Wúwéi", "Wandel", "Dualismus", "Natur", "Kosmos" und "Sprache". Diese Begriffe stehen im Zentrum des Werkes und spiegeln die zentralen Themen des Taoismus wieder. Im Dàodéjīng wird der Mensch als Teil des Kosmos betrachtet und seine Rolle im harmonischen Gleichgewicht der Natur wird betont. Die Sprache wird als Werkzeug zur Erfassung der Realität betrachtet, aber gleichzeitig ihre Grenzen aufgezeigt.
- Quote paper
- Linus Hellwig (Author), 2016, Über das erste Kapitel des Dàodéjīng, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/437601