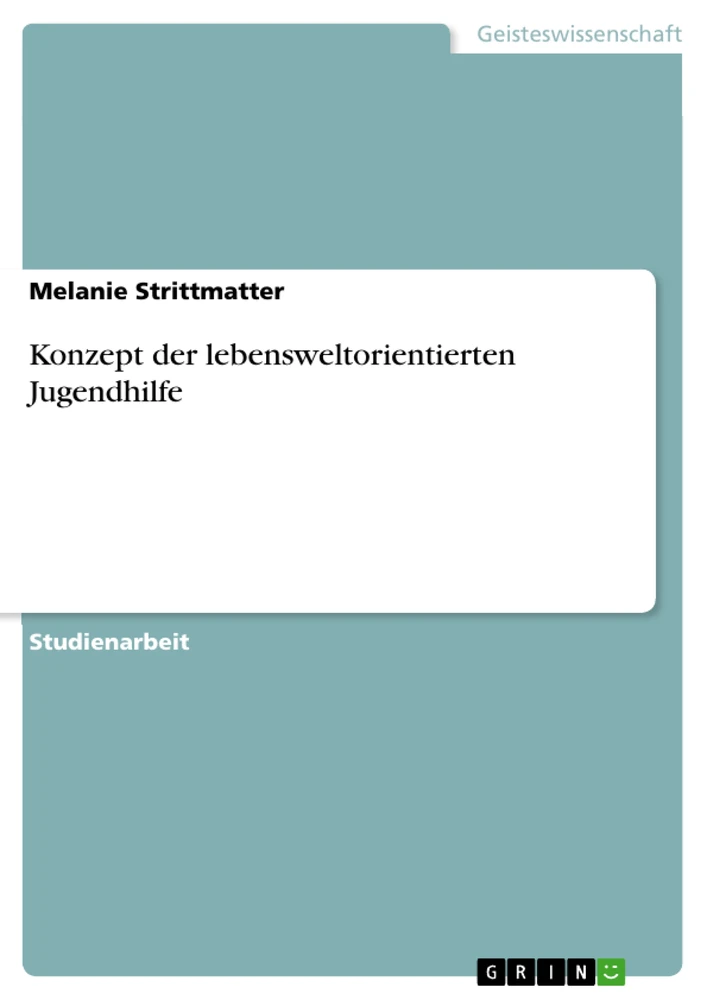Besonders interessant an dem Konzept der Lebensweltorientierung ist, dass sie keine Theorie im klassischen Sinne beinhaltet. Vielmehr begründet sich das Konzept auf vier theoretische Säulen aus unterschiedlichen Bereichen. An erster Stelle verfolgt die Lebensweltorientierung die hermeneutisch-pragmatische Traditionslinie der Erziehungswissenschaften,wie sie u.a. von Dilthey, Nohl und Weniger im Laufe des 20. Jahrhundert etabliert wurden. Diese beinhaltet die alltägliche Praxis des Verstehens und dem daraus resultierten Handeln. Die zweite Säule stellt das phänomenologisch-interaktionistische Paradigma da, wo der Alltag und die Lebenswelt analysiert wird.
Dabei wird die alltägliche Lebenswelt der Betroffenen rekonstruiert,um die alltäglichen Verhältnisse zu beleuchten, von denen sie zum einen geprägt werden, aber auch gleichzeitig Einfluss nehmen können. Als nächstes folgt der kritische Ansatz der Alltagstheorie, die das dritte Fundament der Lebensweltorientierung bildet. Hierbei geht es in erster Linie darum Ressourcen im Alltag aufzudecken und gleichzeitig Destruktives abzubauen, damit eine selbstständige Alltagsbewältigung ermöglicht werden kann. Als letzten Punkt bezieht die Lebensweltorientierung die Analyse gesellschaftlicher Strukturen, die die Lebenswelt des Menschen umfassen. Für die Lebensweltorientierung sind die Ressourcen innerhalb der Lebenswelt sowie die Untersuchungen zur gesellschaftlichen und sozialen Bestimmung von Lebensmustern relevant.
Diese Merkmale und Handlungsstrategien sollen in der vorliegenden Hausarbeit im Einzelnen kurz vorgestellt werden, da sie das Fundament des lebensweltorientierten Ansatzes bilden. Anschließend wird anhand eines Praxisbeispiel erörtert, wie das Konzept der Lebensweltorientierung Anwendung in der Praxis finden kann. Abschließend wird bezugnehmend auf die Professionalisierungsdebatte der Sozialen Arbeit anhand des Praxisbeispiel kurz erläutert, wie wichtig fundiertes Wissen in diesem Fall ist. Ziel ist es, dadurch zu verdeutlichen, inwiefern die Soziale Arbeit die Berechtigung erhalten sollte, sich eine Profession nennen zu dürfen, auch wenn sie nicht die klassischen Kriterien erfüllt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Entstehung der Lebensweltorientierung nach Hans Thiersch
- Konzept der Lebensweltorientierung nach Thiersch
- Das Selbstverständnis der Lebensweltorientierung und ihre Handlungsmaxime
- Hermeneutisch-pragmatische Tradition nach Nohl
- Die Theorie der Lebenswelt als Basis für die lebensweltorientierte Arbeit
- Das Konzept einer lebensweltorientierten Jugendhilfe
- Lebensweltorientierte Jugendhilfe in der Praxis
- Professionalisierung in der Offenen Jugendarbeit
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht die Lebensweltorientierung nach Hans Thiersch als praxisorientiertes Konzept in der Sozialen Arbeit. Sie beleuchtet die Entstehung und Entwicklung dieses Ansatzes im Kontext der Professionalisierungsdebatte in den 1970er Jahren und analysiert die theoretischen Grundlagen sowie die praktische Anwendung des Konzepts.
- Die Entstehung der Lebensweltorientierung als Gegenentwurf zur Spezialisierung und Institutionalisierung in der Sozialen Arbeit.
- Die theoretischen Grundlagen der Lebensweltorientierung, die auf verschiedenen Disziplinen und Denkschulen beruhen, wie z.B. Hermeneutik, Phänomenologie und Alltagstheorie.
- Die Bedeutung der Lebenswelt des Menschen als Ausgangspunkt für die lebensweltorientierte Arbeit und die Rolle von Ressourcen, Problemen und Handlungsmöglichkeiten.
- Die Anwendung des Konzepts in der Praxis der Sozialen Arbeit, insbesondere in der Jugendhilfe.
- Die Relevanz der Lebensweltorientierung für die Professionalisierung der Sozialen Arbeit.
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung skizziert die Professionalisierungsdebatte in der Sozialen Arbeit und verdeutlicht die Bedeutung eines fundierten theoretischen Hintergrunds für die Praxis. Sie stellt das Konzept der Lebensweltorientierung als ein praxisorientiertes Konzept vor.
- Entstehung der Lebensweltorientierung nach Hans Thiersch: Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehung der Lebensweltorientierung im Kontext gesellschaftlicher Veränderungen und der Kritik an der Spezialisierung der Sozialen Arbeit. Es zeigt, wie Hans Thiersch mit seinem Konzept einen Gegenentwurf zu dieser Entwicklung entwickelte und eine stärkere Orientierung an den Lebenswelten der Menschen anstrebte.
- Konzept der Lebensweltorientierung nach Thiersch: Das Kapitel erläutert die zentralen Elemente des Lebensweltorientierungskonzepts, darunter die Betonung der alltäglichen Lebenswelt, die Ressourcenorientierung, die Partizipation und die Förderung der Selbstständigkeit der Adressaten.
- Das Konzept einer lebensweltorientierten Jugendhilfe: Dieser Abschnitt beleuchtet die Anwendung des Lebensweltorientierungskonzepts in der Jugendhilfe und zeigt die Relevanz der Lebensweltorientierung für die Praxis der Offenen Jugendarbeit.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt zentrale Themen der Sozialen Arbeit, insbesondere die Lebensweltorientierung nach Hans Thiersch, Professionalisierung, Jugendhilfe, Ressourcenorientierung, Partizipation, Selbstständigkeit und Alltagsbewältigung. Die Arbeit beleuchtet das Konzept der Lebensweltorientierung als theoretischen Rahmen für die Praxis der Sozialen Arbeit.
- Arbeit zitieren
- Melanie Strittmatter (Autor:in), 2017, Konzept der lebensweltorientierten Jugendhilfe, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/434889