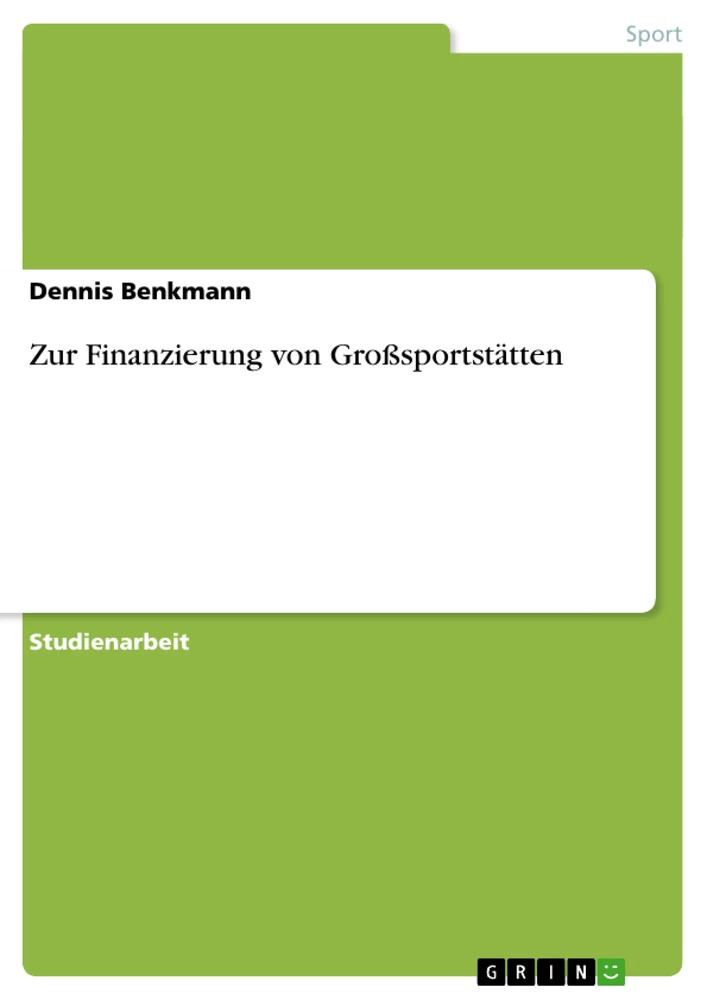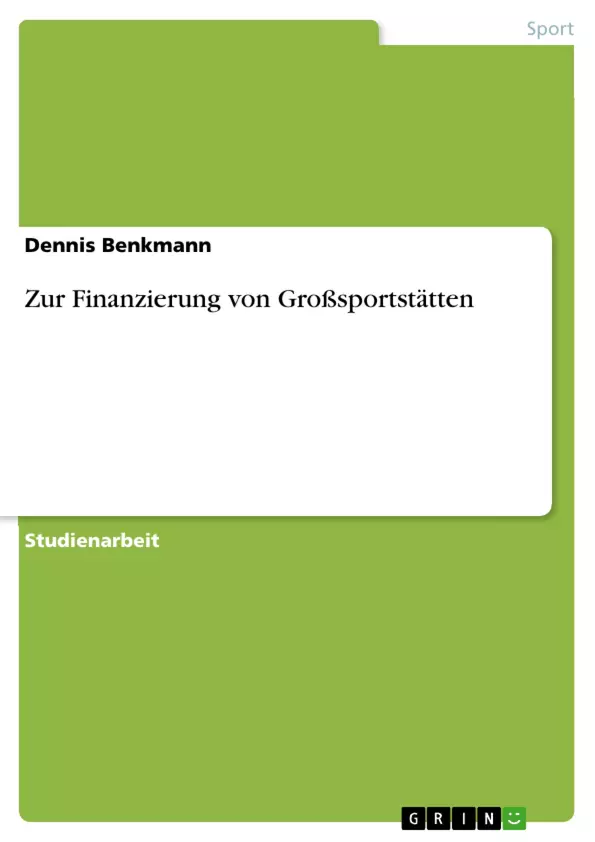Die Finanzierung von Infrastrukturprojekten gilt seit jeher als Bestandteil der öffentlichen Aufgabenwahrnehmung. Jedoch werden derzeit vor dem Hintergrund öffentlicher Sparzwänge Überlegungen angestellt, bisherige Bereiche staatlicher Versorgung dem privatwirtschaftlichen Sektor zu übertragen. So stellt sich auch für den Sportstättenbereich die Frage, inwieweit der privatwirtschaftliche Betrieb Vorteile gegenüber der bisher im wesentlichen immer öffentlichen Bereitstellung bietet.
Unter diesem Aspekt wurden mit Beginn der 90er Jahre Organisations- und Finanzierungsformen eingeführt, die ursprünglich den Finanzierungskonzepten kommunaler Wirtschaftsbetriebe entstammen. Was in den USA und Kanada schon längst Einzug gehalten hat und durch die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten der Arenen seinen Ausdruck findet, steht in Deutschland jedoch erst am Anfang der Entwicklung. Hinzu kommt, dass die Anforderungen1 an die Stadien bezüglich ihrer Kapazität und Ausstattung in den letzten Jahren stark gestiegen sind, so dass die Diskussion nach den Finanzierungsmöglichkeiten auch vor dem Hintergrund der Wettbewerbsfähigkeit des Sportstandortes Deutschland zu führen ist.
Diese Arbeit versucht deshalb beispielhaft zu zeigen, welche Formen der Finanzierung sich am besten für die Errichtung und den Betrieb von Großsportstätten eignen. Hierbei soll in den beiden folgenden Kapiteln zunächst die Notwendigkeit zur Modernisierung, die Kriterien öffentlicher Finanzierung sowie die ökonomische Bedeutung solcher Institutionen aufgezeigt werden, um dann unter Berücksichtigung dieser Erkenntnisse im Kapitel 4 Konzepte zur Ermittelung des Finanzierungspotentials vorzustellen. Um dem Leser einen Einblick in die Praxis der Sportstättenfinanzierung zu verschaffen, wird in Kapitel 5 das Projekt zur Nutzung des Berliner Olympiageländes exemplarisch erläutert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Wandel in der deutschen Sportstättenlandschaft
- Effizienzbetrachtung privater gegenüber öffentlicher Aufgabenwahrnehmung
- Der Effizienzaspekt bei Subventionsvergaben
- Modernisierung und öffentliche Durchführung
- Erfahrungen mit Public Private Partnerships
- Finanzierung von Großsportstätten
- Finanzplanung
- Einnahmebestandteile
- Ausgabenbestandteile
- Externe Effekte aus nachfrage- und angebotsorientierter Sicht
- Finanzierungsmodelle
- Konzessionsmodell
- Betreiberkonzepte
- Kooperationsmodell
- Projekt zur Nutzung des Berliner Olympiageländes
- Stadionlösung
- Finanzierungskonzept
- Organisationskonzept
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Finanzierung von Großsportstätten im Kontext des Wandels in der deutschen Sportstättenlandschaft und der sich ändernden Effizienzbetrachtungen öffentlicher Aufgabenwahrnehmung. Sie analysiert die Notwendigkeit von Modernisierung, die Kriterien öffentlicher Finanzierung sowie die ökonomische Bedeutung solcher Institutionen.
- Die Notwendigkeit der Modernisierung von Großsportstätten im Hinblick auf Kapazität, Ausstattung und Wettbewerbsfähigkeit des Sportstandortes Deutschland
- Die Effizienz von privaten gegenüber öffentlichen Aufgabenwahrnehmung in Bezug auf die Finanzierung und den Betrieb von Großsportstätten
- Die verschiedenen Finanzierungsmodelle für Großsportstätten, inklusive ihrer Vor- und Nachteile
- Die Rolle von Public Private Partnerships (PPP) bei der Finanzierung von Großsportstätten
- Die praktische Anwendung von Finanzierungskonzepten am Beispiel des Projekts zur Nutzung des Berliner Olympiageländes
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Bedeutung der Sportstättenfinanzierung im Kontext der öffentlichen Aufgabenwahrnehmung und des Wandels in der deutschen Sportstättenlandschaft. Sie führt die Notwendigkeit zur Modernisierung von Großsportstätten aus und stellt die Frage nach den optimalen Finanzierungsformen. Kapitel 2 analysiert die Effizienz von privaten gegenüber öffentlichen Aufgabenwahrnehmung im Sportstättenbereich, wobei der Fokus auf die Kriterien der öffentlichen Finanzierung und die ökonomische Bedeutung solcher Institutionen liegt. Kapitel 3 beleuchtet die Finanzierungsmodelle für Großsportstätten, untersucht die verschiedenen Einnahme- und Ausgabenbestandteile sowie die externen Effekte. Es werden verschiedene Modelle wie Konzessionsmodelle, Betreiberkonzepte und Kooperationsmodelle vorgestellt. Kapitel 4 zeigt am Beispiel des Projekts zur Nutzung des Berliner Olympiageländes die praktische Anwendung der Finanzierungskonzepte auf.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Sportstättenfinanzierung, Großsportstätten, öffentliche Aufgabenwahrnehmung, Effizienzbetrachtung, Modernisierung, Public Private Partnerships (PPP), Finanzierungsmodelle, Konzessionsmodelle, Betreiberkonzepte, Kooperationsmodelle, Berliner Olympiagelände.
- Arbeit zitieren
- Dennis Benkmann (Autor:in), 2002, Zur Finanzierung von Großsportstätten, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/4344