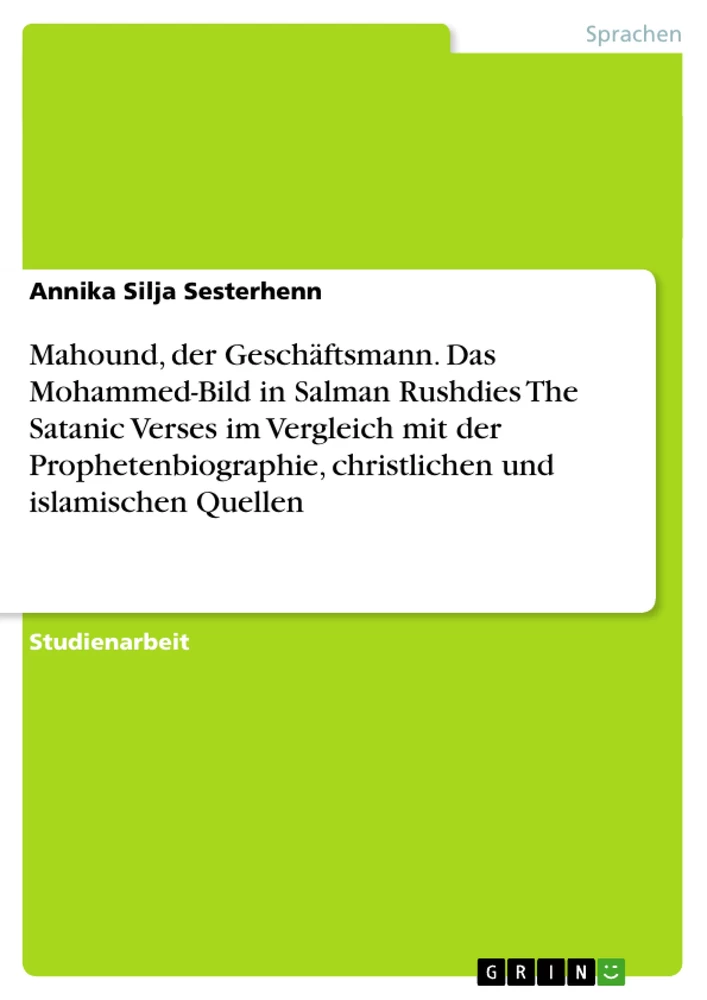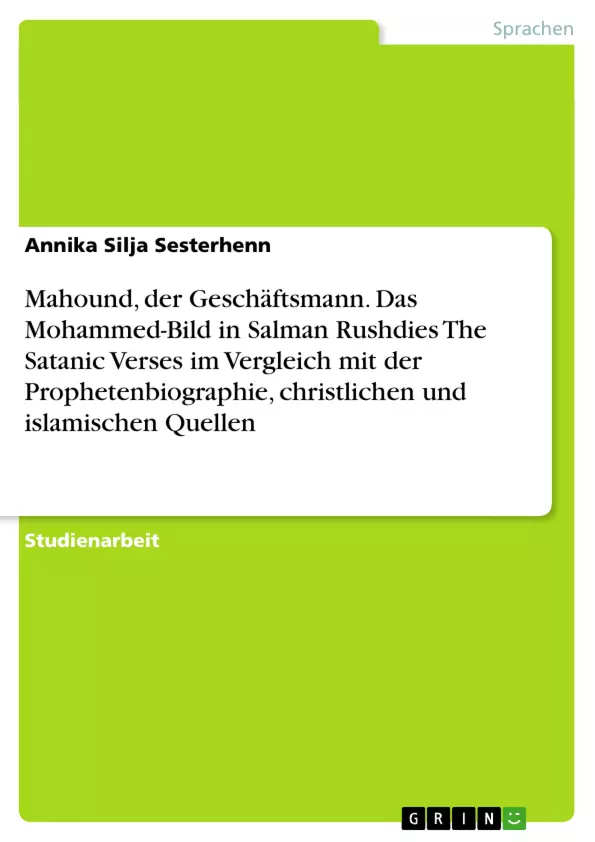Der argentinische Schriftsteller Alberto Manguel beschreibt in seinem lesenswerten Sachbuch Eine Geschichte des Lesens folgende Szene:
Als gegen Salman Rushdie wegen seines Romans Die satanischen Verse die Fatwa ausgesprochen wurde und jedermann wußte, daß ein Autor wegen eines Romans mit dem Tode bedroht war, stellte der amerikanische Fernsehjournalist John Innes monatelang ein Exemplar des Buches auf seinem Sprecherpult zur Schau. Er sprach zu allen möglichen Themen, erwähnte dabei weder das Buch noch Rushdie oder den Ayatollah, aber die Präsenz des Buches neben ihm kündete eindrucksvoll von der Solidarität eines Lesers mit dem Schicksal des Buches und seines Autors.
Dieses Zitat verdeutlicht vor allem eines: Salman Rushdies Werk The Satanic Verses scheint durch die politischen Turbulenzen, die dessen Veröffentlichung 1988 hervorrief, zu einem Symbol geworden zu sein. Allein das Herzeigen des Buches, ohne die geringste Erwähnung des Inhalts oder des Autors, übermittelt dem Betrachter eine Art Botschaft. Es liegt auf der Hand, dass es für einen Roman - und seinen Autor - wohl kaum etwas tragischeres gibt, als zu einem unumwerflichen politischen Zeichen zu erstarren: Ein Buch, welches nur hochgehalten werden muss, um seine Wirkung zu tun, muss im Grunde nicht mehr aufgeblättert werden. All die Welten, die der Autor darin kreiert hat, die Kraft, die ein Roman inne hat, für jeden Leser andere Symbole und Zeichen, ja ein Universum an Mitteilungen darzustellen, verblasst im Trubel der politischen Konflikte. So bezeichnet Paul Brian, Professor für englische Literatur in Boston, auf seiner sehr informativen Homepage über The Satanic Verses, Rushdies Roman treffend als „one of the most widely-unread bestsellers in the history of publishing“ . Dass der Roman so schwerwiegende Missverständnisse hervorrufen konnte, die seinen Autor sogar in ernste Lebensgefahr brachten, liegt nicht zuletzt an der sprachlichen Dichte und unendlich wirkenden Informationsfülle, die Rushdies Schreibstil ausmachen und so die Zugänglichkeit für eine breite Leserschaft erschwert. Er vermag es, so viel Erzähltes in einem Roman zu vereinen, dass andere Autoren leicht sechs oder zehn einzelne Werke daraus schaffen könnten.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung. Ein symbolisches Buch.
- Zu Autor und Werk.
- Über Salman Rushdie
- The Satanic Verses – Versuch einer Inhaltsangabe
- Das Leben des Propheten
- Textgeschichte der Sira
- Vergleichende Betrachtungen
- Die Legende der satanischen Verse
- Vergleich Rushdie – Sira – at-Tabari
- Bilder und Gegenbilder. Mohammed-Darstellungen im geschichtlichen Wandel
- Rushdies Vorgehensweise
- Literaturangabe
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Mohammed-Bild in Salman Rushdies „The Satanic Verses“ im Vergleich mit der Prophetenbiographie, christlichen und islamischen Quellen. Ziel ist es, Rushdies Umgang mit historischen Fakten und die beabsichtigte Mehrdeutigkeit seiner Darstellung zu analysieren. Die Arbeit konzentriert sich auf die Passagen, die sich mit der frühen islamischen Geschichte befassen, ohne den Roman aus seinem Kontext zu reißen.
- Rushdies Darstellung Mohammeds in „The Satanic Verses“
- Vergleich der Darstellung mit der Prophetenbiographie und anderen historischen Quellen
- Analyse der Abweichungen und Ähnlichkeiten zwischen Rushdies Roman und den historischen Quellen
- Untersuchung von Rushdies Umgang mit Fiktion und Geschichte
- Die Rolle von westlichen und islamischen Polemiken in Rushdies Werk
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung. Ein symbolisches Buch: Dieses einleitende Kapitel beschreibt den Roman "The Satanic Verses" als ein Symbol, dessen Bedeutung durch die politische Kontroverse um seine Veröffentlichung verstärkt wurde. Es betont die sprachliche Dichte des Romans und die daraus resultierende Schwierigkeit der Rezeption. Der Fokus liegt auf der Vielfalt der Interpretationen und der umfangreichen Sekundärliteratur. Die Arbeit kündigt eine vergleichende Analyse von Rushdies Darstellung Mohammeds mit historischen Quellen an, unter Berücksichtigung der "Rushdie Affair" lediglich am Rande.
Zu Autor und Werk: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über Salman Rushdie und sein Werk. Es beinhaltet einen kurzen biografischen Abriss und versucht eine Inhaltsangabe des Romans "The Satanic Verses". Der Abschnitt soll einen Einblick in Rushdies Vielseitigkeit und seinen Schreibstil geben, bevor die detaillierte Analyse des Mohammed-Bildes beginnt.
Das Leben des Propheten: Dieses Kapitel befasst sich mit der Textgeschichte der Prophetenbiographie (Sira) und deren Bedeutung für den Islam. Es bildet die Grundlage für den späteren Vergleich mit Rushdies Darstellung, indem es den historischen Kontext und die Bedeutung der Sira für die islamische Tradition erläutert.
Vergleichende Betrachtungen: In diesem Kapitel wird die Legende der satanischen Verse aus at-Tabaris Geschichtswerk untersucht und mit Rushdies Darstellung verglichen. Ein detaillierter Vergleich von Passagen aus Rushdies Roman mit der Sira, at-Tabari, Montgomery Watts und der Encyclopedia of Islam soll die Abweichungen und Übereinstimmungen mit dem historischen Stoff aufzeigen. Der Vergleich von westlich-islamischen Polemiken mit Passagen aus Rushdies Werk soll die beabsichtigte Ambivalenz des Mohammed-Bildes verdeutlichen.
Schlüsselwörter
Salman Rushdie, The Satanic Verses, Mohammed-Bild, Prophetenbiographie (Sira), at-Tabari, historische Quellen, westliche und islamische Polemiken, Fiktion und Geschichte, postmoderner Roman, religiöse Kontroverse.
Häufig gestellte Fragen zu "The Satanic Verses" - Vergleichende Analyse
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese akademische Arbeit analysiert die Darstellung Mohammeds in Salman Rushdies Roman "The Satanic Verses" und vergleicht sie mit historischen Quellen wie der Prophetenbiographie (Sira) und den Schriften von at-Tabari. Der Fokus liegt auf Rushdies Umgang mit historischen Fakten, der beabsichtigten Mehrdeutigkeit seiner Darstellung und dem Einfluss westlicher und islamischer Polemiken.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit untersucht Rushdies Darstellung Mohammeds, vergleicht sie mit der Prophetenbiographie und anderen historischen Quellen, analysiert Abweichungen und Ähnlichkeiten, untersucht Rushdies Umgang mit Fiktion und Geschichte und beleuchtet die Rolle von westlichen und islamischen Polemiken in seinem Werk. Die "Rushdie Affair" wird nur am Rande betrachtet.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu einer Einführung, die den Roman als symbolisches Buch beschreibt; einem Kapitel zum Autor und Werk mit kurzer Biografie und Inhaltsangabe; einem Kapitel zur Textgeschichte der Sira; einem Kapitel mit vergleichenden Betrachtungen, inklusive der Legende der satanischen Verse aus at-Tabaris Geschichtswerk, sowie einem Kapitel zu Rushdies Vorgehensweise. Die Arbeit schließt mit einer Literaturangabe.
Welche Quellen werden herangezogen?
Neben Salman Rushdies "The Satanic Verses" werden die Prophetenbiographie (Sira), das Geschichtswerk von at-Tabari, sowie weitere relevante Quellen (z.B. Montgomery Watts, Encyclopedia of Islam) zur vergleichenden Analyse herangezogen. Die Arbeit berücksichtigt auch westliche und islamische Polemiken um das Werk.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Ziel ist die Analyse von Rushdies Umgang mit historischen Fakten und der beabsichtigten Mehrdeutigkeit seiner Darstellung Mohammeds. Die Arbeit konzentriert sich auf die Passagen, die sich mit der frühen islamischen Geschichte befassen, ohne den Roman aus seinem Kontext zu reißen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Salman Rushdie, The Satanic Verses, Mohammed-Bild, Prophetenbiographie (Sira), at-Tabari, historische Quellen, westliche und islamische Polemiken, Fiktion und Geschichte, postmoderner Roman, religiöse Kontroverse.
Welche Art von Analyse wird durchgeführt?
Die Arbeit führt eine vergleichende Analyse durch, die Rushdies Darstellung Mohammeds mit historischen Quellen konfrontiert. Dabei werden Ähnlichkeiten und Abweichungen herausgearbeitet und der Einfluss von Fiktion und Geschichte auf Rushdies Interpretation beleuchtet. Die Analyse berücksichtigt auch den Kontext von westlichen und islamischen Polemiken.
- Arbeit zitieren
- Annika Silja Sesterhenn (Autor:in), 2005, Mahound, der Geschäftsmann. Das Mohammed-Bild in Salman Rushdies The Satanic Verses im Vergleich mit der Prophetenbiographie, christlichen und islamischen Quellen, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/42942