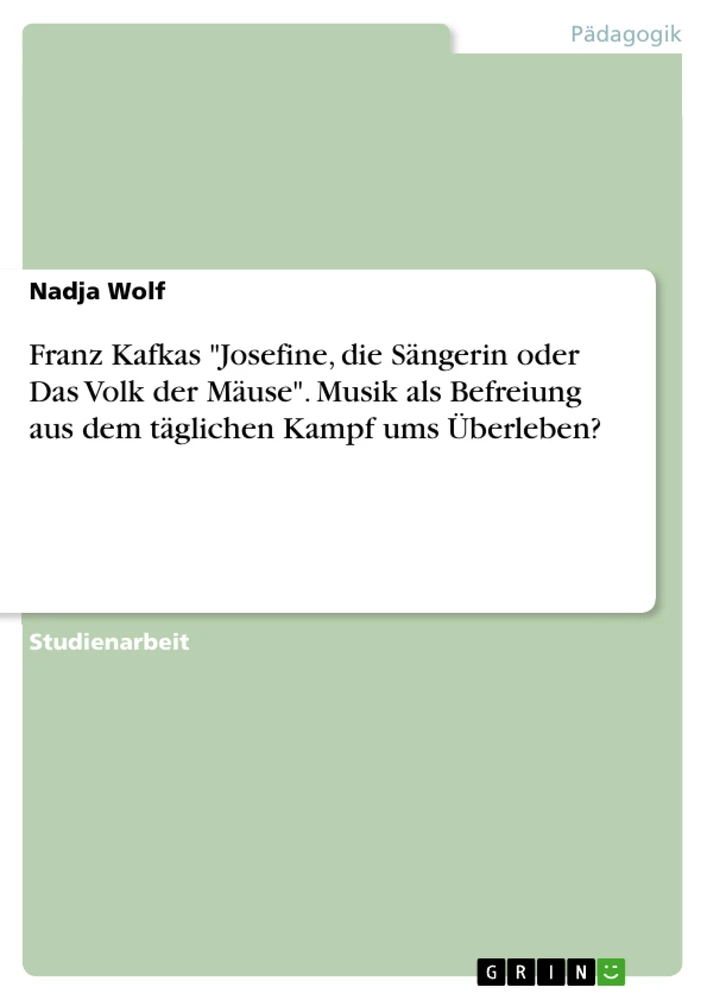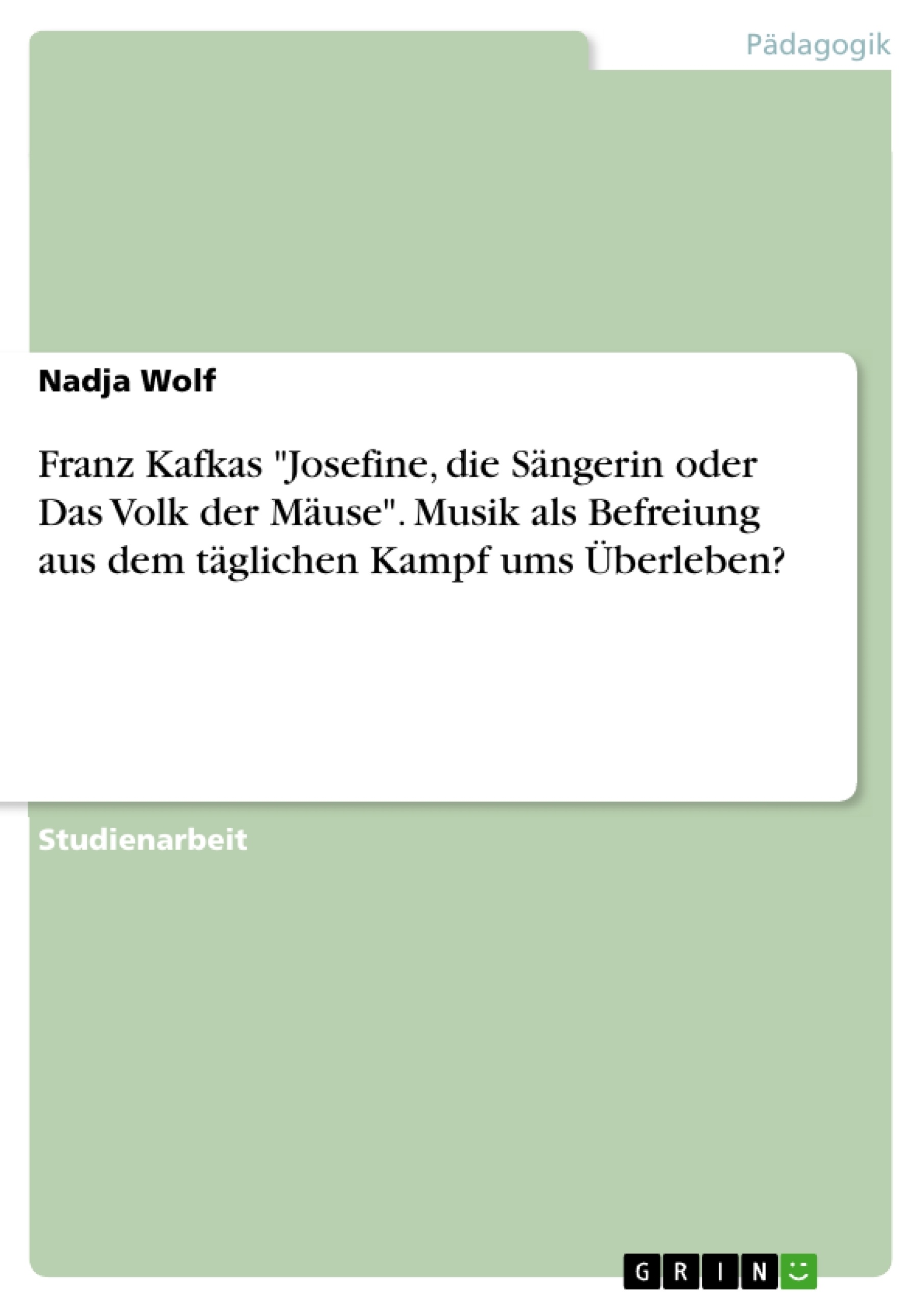In dieser Seminararbeit möchte ich einen Beitrag zur Musikthematik leisten, da diese eine zentrale Rolle in der Erzählung spielt. Meine These, die es im Folgenden geht zu überprüfen, lautet: „Trotz der ablehnenden Haltung der Mäuse, in Musik etwas Höheres zu sehen, erzeugt Josefines Gesang in dem unruhigen, durch Existenzängsten gekennzeichneten Mäusevolk ein starkes Gefühl von Schutz und Geborgenheit.“
Ich werde dabei wie folgt vorgehen: Zunächst werden unter den Vorbetrachtungen der kulturhistorische und literarische Kontext skizziert sowie autobiografische Aspekte dargestellt, um entstehungsbedingte Faktoren zu nennen. Danach wird ausführlich auf die Bedeutung des musikalischen Gehalts eingegangen und im Anschluss Bezüge zum jüdischen Volk hergestellt. Schließlich werde ich aus allen Analyse- und Interpretationsergebnissen ein Fazit ziehen und Stellung zur Ausgangsthese nehmen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vorbetrachtungen
- Kulturhistorischer und literarischer Kontext
- Autobiografische Aspekte
- Zur Bedeutung des musikalischen Gehaltes der Erzählung
- Josefine als Scheinkünstlerin
- Die Unmusikalität des Mäusevolkes
- Bezüge zum jüdischen Volk
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Musikthematik in Franz Kafkas Erzählung „Josefine, die Sängerin oder Das Volk der Mäuse“, die eine zentrale Rolle im Werk spielt. Die Arbeit prüft die These, dass Josefines Gesang trotz Ablehnung durch die Mäuse ein starkes Gefühl von Schutz und Geborgenheit im von Existenzängsten geprägten Mäusevolk erzeugt. Hierzu werden der kulturhistorische und literarische Kontext, autobiografische Aspekte Kafkas sowie Bezüge zum jüdischen Volk beleuchtet.
- Die Bedeutung von Musik als Mittel der Befreiung und des Trostes im Kontext des Überlebenskampfes.
- Die Ambivalenz der Reaktion des Mäusevolkes auf Josefines Gesang: Bewunderung und Ablehnung.
- Der kulturhistorische und literarische Kontext der Erzählung um 1900.
- Autobiografische Einflüsse Kafkas auf die Erzählung.
- Die Parallelen zwischen dem Schicksal Josefines und dem des jüdischen Volkes.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung deutet die Gesamtthematik der Erzählung an: das arbeitende Mäusevolk, das täglich ums Überleben kämpft, und Josefines Gesang als Versuch der Befreiung von der Arbeitspflicht. Sie skizziert die These der Arbeit – dass Josefines Gesang trotz Ablehnung Schutz und Geborgenheit vermittelt – und den methodischen Ansatz, der Vorbetrachtungen, die Analyse des musikalischen Gehalts und Bezüge zum jüdischen Volk umfasst. Die Einleitung verweist auf den Forschungsstand, der die vielfältigen Interpretationen der Erzählung hervorhebt, und betont die Fokussierung auf die Musikthematik.
Vorbetrachtungen: Dieses Kapitel besteht aus zwei Teilen: "Kulturhistorischer und literarischer Kontext" und "Autobiografische Aspekte". Der erste Teil beschreibt den Kontext der Moderne um 1900, mit ihren Massenphänomenen und dem Umbruch in der Literatur, der sich durch Experimentieren mit Formen und Stilen, subjektive Sichtweisen und den Ästhetizismus auszeichnete. Kafka wird als bedeutender Vertreter dieser Epoche positioniert, der die psychischen Schäden der Modernisierung thematisiert. Der zweite Teil beleuchtet autobiografische Aspekte Kafkas, seine begrenzten Lebenserfahrungen, Ängste, familiäre Probleme und sein schwieriges Verhältnis zur Kunst und Gesellschaft. Diese Aspekte werden als relevant für das Verständnis der Erzählung dargestellt, insbesondere der Konflikt zwischen Kunst und Gesellschaft.
Zur Bedeutung des musikalischen Gehaltes der Erzählung: Dieses Kapitel untersucht die Rolle der Musik in Kafkas Erzählung. Es analysiert Josefines Gesang als Scheinkunst, die zwar eine beruhigende Wirkung hat, aber von den Mäusen ambivalent aufgenommen wird – mit Bewunderung und Ablehnung gleichermaßen. Gleichzeitig wird die Unmusikalität des Mäusevolkes beleuchtet und im Kontext der Handlung und ihrer Symbolik interpretiert. Die Kapitel vertiefen sich in die Bedeutung des Gesangs als Mittel der möglichen Befreiung und die gesellschaftliche Bewertung von Kunst im Alltag der Mäuse.
Bezüge zum jüdischen Volk: Dieses Kapitel untersucht die Parallelen zwischen dem Schicksal Josefines und dem des jüdischen Volkes. Es analysiert, wie Josefines Isolation, Ausgrenzung und der Versuch, sich durch ihre Kunst zu befreien, als Metapher für die Erfahrung des jüdischen Volkes verstanden werden können. Die Kapitel untersucht möglicherweise die geschichtlichen und sozialen Umstände, die diese Parallelen belegen und verstärkt.
Schlüsselwörter
Josefine, die Sängerin oder Das Volk der Mäuse, Franz Kafka, Musik, Kunst, Gesellschaft, Moderne, Existenzangst, Befreiung, Jüdisches Volk, Autobiografie, Scheinkunst, Ambivalenz.
Häufig gestellte Fragen zu Franz Kafkas "Josefine, die Sängerin oder Das Volk der Mäuse"
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit analysiert die Musikthematik in Franz Kafkas Erzählung "Josefine, die Sängerin oder Das Volk der Mäuse" und untersucht die Rolle von Josefines Gesang im Kontext des arbeitenden und von Existenzängsten geprägten Mäusevolkes. Die zentrale These besagt, dass Josefines Gesang, trotz Ablehnung durch die Mäuse, ein Gefühl von Schutz und Geborgenheit vermittelt.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Aspekte, darunter den kulturhistorischen und literarischen Kontext der Erzählung um 1900, autobiografische Einflüsse Kafkas, die Ambivalenz der Reaktion des Mäusevolkes auf Josefines Gesang (Bewunderung und Ablehnung), die Bedeutung von Musik als Mittel der Befreiung und des Trostes, und Parallelen zwischen Josefines Schicksal und dem des jüdischen Volkes. Die Analyse konzentriert sich auf die Bedeutung des musikalischen Gehalts der Erzählung und die Symbolik des Gesangs.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Vorbetrachtungen (Kulturhistorischer und literarischer Kontext sowie autobiografische Aspekte Kafkas), ein Kapitel zur Bedeutung des musikalischen Gehalts der Erzählung (inklusive Analyse von Josefines Gesang als Scheinkunst und der Unmusikalität des Mäusevolkes), ein Kapitel zu Bezügen zum jüdischen Volk und ein Fazit. Die Einleitung skizziert die These und den methodischen Ansatz. Die Vorbetrachtungen liefern den Kontext, während die folgenden Kapitel die These vertiefen und belegen.
Wie wird Josefines Gesang in der Arbeit interpretiert?
Josefines Gesang wird als "Scheinkunst" interpretiert, die zwar eine beruhigende Wirkung auf das Mäusevolk hat, aber ambivalent aufgenommen wird. Die Arbeit analysiert die Wirkung des Gesangs im Kontext des Überlebenskampfes der Mäuse und untersucht seine Bedeutung als mögliches Mittel der Befreiung von der Arbeitspflicht. Die Unmusikalität des Mäusevolkes wird ebenfalls thematisiert und im Kontext der Handlung interpretiert.
Welche Parallelen zwischen Josefines Schicksal und dem jüdischen Volk werden gezogen?
Die Arbeit untersucht Parallelen zwischen Josefines Isolation, Ausgrenzung und ihrem Versuch, sich durch Kunst zu befreien, und der Erfahrung des jüdischen Volkes. Es werden mögliche geschichtliche und soziale Umstände analysiert, die diese Parallelen belegen und verstärken.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Josefine, die Sängerin oder Das Volk der Mäuse, Franz Kafka, Musik, Kunst, Gesellschaft, Moderne, Existenzangst, Befreiung, Jüdisches Volk, Autobiografie, Scheinkunst, Ambivalenz.
Welche Zielsetzung verfolgt die Seminararbeit?
Die Seminararbeit zielt darauf ab, die Musikthematik in Kafkas Erzählung umfassend zu untersuchen und die These zu prüfen, dass Josefines Gesang trotz Ablehnung Schutz und Geborgenheit im Mäusevolk erzeugt. Dies geschieht durch die Berücksichtigung des kulturhistorischen Kontextes, autobiografischer Aspekte und Bezüge zum jüdischen Volk.
- Quote paper
- Nadja Wolf (Author), 2017, Franz Kafkas "Josefine, die Sängerin oder Das Volk der Mäuse". Musik als Befreiung aus dem täglichen Kampf ums Überleben?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/428425