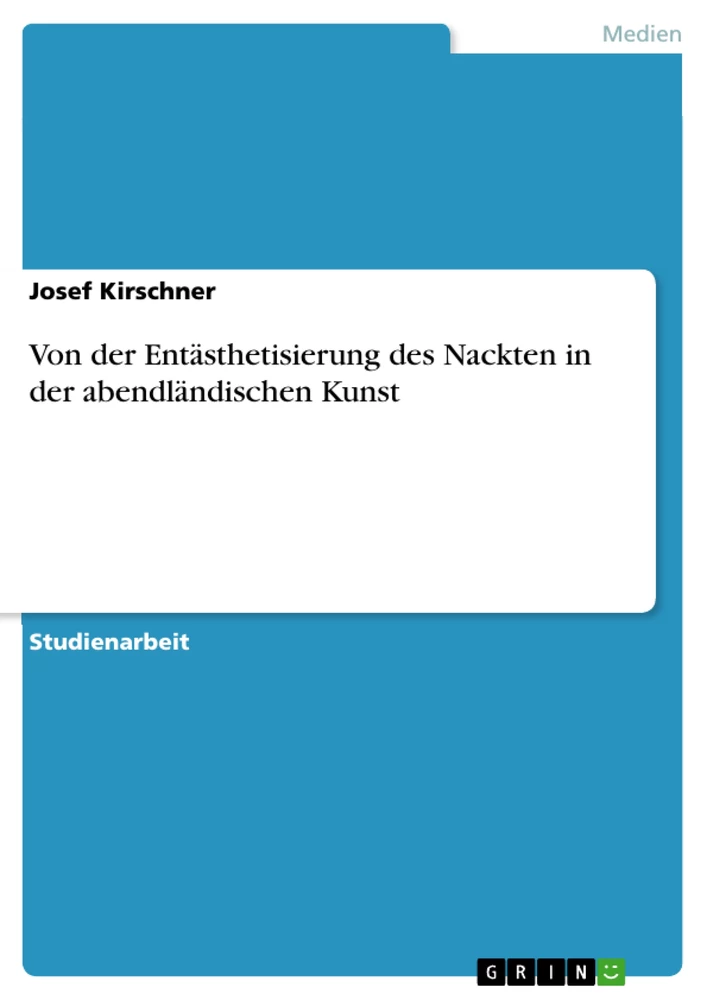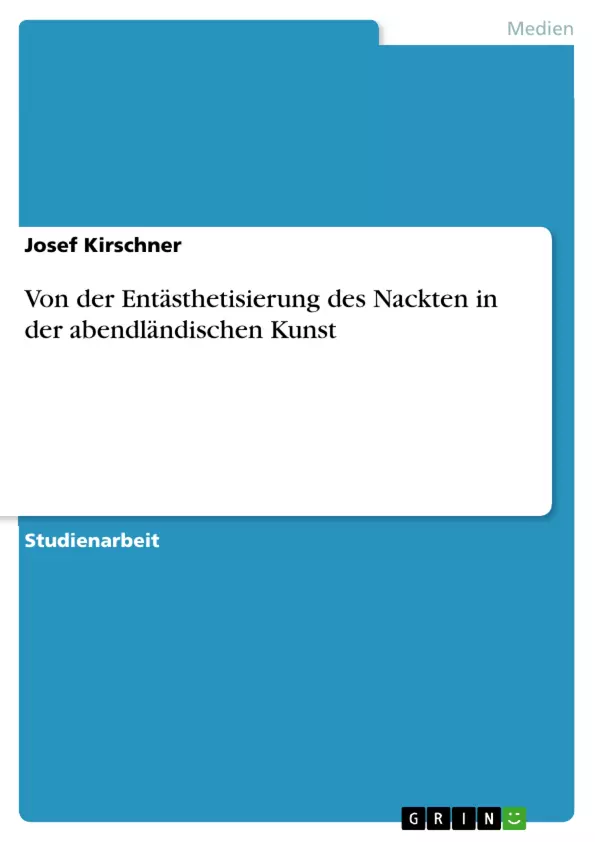Von Darstellungen der griechischen und römischen Antike über Werke der Frühen Neuzeit bis hin zur kontemporären Kunst – ein Thema scheint die bildenden Künste, vor allem aber die Gattungen der Malerei und Bildhauerei, seit Anbeginn ihrer selbst zu begleiten: Die Darstellung des menschlichen Körpers in seiner ursprünglichsten aller Erscheinungen. Selten wurde ein Sujet in der abendländischen Bilderwelt so zeitlos und wiederkehrend behandelt, wie die Ausführung des unbekleideten menschlichen Leibes. Doch betrachtet man die Bedeutung von der Nacktheit beziehungsweise des Nackten in der Kunst (eine Differenzierung soll an späterer Stelle vorgenommen werden), so ist festzustellen, dass die Notion im Laufe der Jahrhunderte einem Wandel unterworfen war. Von der unschuldigen Blöße der biblischen Ureltern über die einst heroischen Bildnissen antiker Regenten und mythologischer Gottheiten bis hin zur lasziv rezipierten Olympia und Courbets unverhohlenem Ursprung der Welt, fand auf Seiten der Künstler wie der Rezipienten eine Revision bezüglich des Umgangs mit dem Nackten statt. Vormals positiv konnotiert und als fester Bestandteil des Alltags (denkt man an die heroischen Bildnisse der Antike), erfuhr der bare menschliche Körper in der Öffentlichkeit scheinbar eine Entästhetisierung, welche dazu führte, dass dessen bloße Zurschaustellung einen Skandal hervorzurufen vermochte und von der Gesellschaft als nicht salonfähig – ebenso im wörtlichen Sinne – moniert wurde.
Inhalt dieser Arbeit ist es, zu eruieren, ob und – falls ja – was diese Entästhetisierung des Nackten in der abendländischen Kunst ausgelöst hat und inwiefern diese womöglich mit dem Zivilisierungsprozess in Verbindung gebracht werden kann. Um jedoch von einer Entästhetisierung sprechen zu können, muss zunächst geklärt werden, was unter der Idee des Ästhetischen zu verstehen ist. Hierzu sollen Betrachtungen zur Ästhetik von Baumgarten, Kant und Hegel herangezogen werden, welche aufeinander aufbauend den Begriff der Ästhetik formten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Begriff der Ästhetik
- Der gegenderte Blick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entästhetisierung des Nackten in der abendländischen Kunst und deren mögliche Verbindung zum Zivilisierungsprozess. Zunächst wird der Begriff der Ästhetik anhand der Theorien von Baumgarten, Kant und Hegel geklärt. Die Analyse konzentriert sich auf die Veränderungen in der Rezeption und Darstellung des nackten Körpers im Laufe der Geschichte.
- Entwicklung des Ästhetikbegriffs in der Kunstgeschichte
- Der Einfluss des Betrachters und des "gegenderten Blicks"
- Wandel der gesellschaftlichen Wahrnehmung von Nacktheit
- Die Rolle der Kunst im Kontext gesellschaftlicher Veränderungen
- Verbindung von Entästhetisierung und Zivilisierungsprozess
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Darstellung des menschlichen Körpers in der Kunst ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Entästhetisierung des Nackten in der abendländischen Kunstgeschichte. Sie verweist auf den Wandel der Bedeutung von Nacktheit von der unschuldigen Blöße der biblischen Figuren über die heroischen Darstellungen der Antike bis hin zur kontroversen Rezeption moderner Werke wie Manets "Olympia". Die Arbeit zielt darauf ab zu untersuchen, was diese Entästhetisierung ausgelöst hat und ob sie mit dem Zivilisierungsprozess zusammenhängt. Die Notwendigkeit einer Klärung des Begriffs "Ästhetik" wird hervorgehoben.
Der Begriff der Ästhetik: Dieses Kapitel beleuchtet den Begriff der Ästhetik anhand der Theorien von Baumgarten, Kant und Hegel. Baumgarten definiert Ästhetik als "Wissenschaft der sinnlichen Erkenntnis und Darstellung", wobei die sinnliche Wahrnehmung und das Gefühl der Vollkommenheit im Vordergrund stehen. Kant betont die Bedeutung des Zwecks und der Zweckmäßigkeit im ästhetischen Urteil, während Hegel die Kunst als "sich als Schein bekennender Schein des Wahren" versteht. Zusammenfassend wird argumentiert, dass ästhetisches Empfinden gesellschaftlich und epochenabhängig geprägt ist und kein universelles Verständnis von Schönheit existiert. Die Natur wird als Prototyp einer ästhetischen Formensprache gesehen, wobei auch der Einfluss kultureller Faktoren auf das ästhetische Verständnis betont wird.
Der gegenderte Blick: Dieses Kapitel diskutiert den Einfluss des Betrachters auf die Rezeption von Kunstwerken, insbesondere im Bezug auf die Darstellung des nackten Körpers. Unter Bezugnahme auf den rezeptionsästhetischen Ansatz von Kemp wird argumentiert, dass Bilder für bestimmte Zielgruppen mit spezifischen soziodemographischen Merkmalen geschaffen werden, und dass dies auch für die Darstellung des nackten Körpers gilt. Die unterschiedliche Wahrnehmung des Aktes durch männliche und weibliche Betrachter wird als wichtiger Aspekt hervorgehoben. Der Akt wird hierbei als eine Form unter vielen anderen betrachtet.
Schlüsselwörter
Entästhetisierung, Nacktheit, Akt, Abendländische Kunst, Ästhetik, Baumgarten, Kant, Hegel, Rezeptionsästhetik, Zivilisierungsprozess, gegenderter Blick, Kunstgeschichte.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Entästhetisierung des Nackten in der abendländischen Kunst
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Entästhetisierung des Nackten in der abendländischen Kunst und deren mögliche Verbindung zum Zivilisierungsprozess. Sie analysiert die Veränderungen in der Rezeption und Darstellung des nackten Körpers im Laufe der Geschichte und beleuchtet den Einfluss des Betrachters und des "gegenderten Blicks".
Welche zentralen Begriffe werden behandelt?
Zentrale Begriffe sind Entästhetisierung, Nacktheit, Akt, Ästhetik, Rezeptionsästhetik, Zivilisierungsprozess und gegenderter Blick. Die Arbeit bezieht sich auf die ästhetischen Theorien von Baumgarten, Kant und Hegel.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum Begriff der Ästhetik und ein Kapitel zum gegenderten Blick. Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die Forschungsfrage. Das Kapitel zur Ästhetik klärt den Begriff anhand der Theorien von Baumgarten, Kant und Hegel. Das Kapitel zum gegenderten Blick diskutiert den Einfluss des Betrachters auf die Rezeption von Kunstwerken, insbesondere von Aktdarstellungen.
Wie wird der Begriff der Ästhetik definiert?
Der Begriff der Ästhetik wird anhand der Theorien von Baumgarten (sinnliche Erkenntnis und Darstellung), Kant (Zweckmäßigkeit im ästhetischen Urteil) und Hegel (Kunst als Schein des Wahren) beleuchtet. Die Arbeit argumentiert, dass ästhetisches Empfinden gesellschaftlich und epochenabhängig geprägt ist.
Welche Rolle spielt der "gegenderte Blick"?
Das Kapitel zum "gegenderten Blick" untersucht den Einfluss des Betrachters – männlich und weiblich – auf die Wahrnehmung von Aktdarstellungen. Es wird argumentiert, dass Bilder für bestimmte Zielgruppen geschaffen werden und die Wahrnehmung des Aktes geschlechtsspezifisch beeinflusst ist.
Welche Verbindung besteht zwischen Entästhetisierung und Zivilisierungsprozess?
Die Arbeit untersucht die mögliche Verbindung zwischen der Entästhetisierung des Nackten und dem Zivilisierungsprozess. Es wird analysiert, welche Faktoren die Veränderung der Bedeutung von Nacktheit von der unschuldigen Blöße bis hin zur kontroversen Rezeption moderner Werke beeinflusst haben.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit bezieht sich auf die Theorien von Baumgarten, Kant und Hegel zur Ästhetik sowie auf rezeptionsästhetische Ansätze (z.B. Kemp). Konkrete Kunstwerke (z.B. Manets "Olympia") werden als Beispiele herangezogen.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit ist für ein akademisches Publikum bestimmt und dient der Analyse von Themen in der Kunstgeschichte.
Wo finde ich Schlüsselwörter zu dieser Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Entästhetisierung, Nacktheit, Akt, Abendländische Kunst, Ästhetik, Baumgarten, Kant, Hegel, Rezeptionsästhetik, Zivilisierungsprozess, gegenderter Blick, Kunstgeschichte.
- Quote paper
- Josef Kirschner (Author), 2017, Von der Entästhetisierung des Nackten in der abendländischen Kunst, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/426607