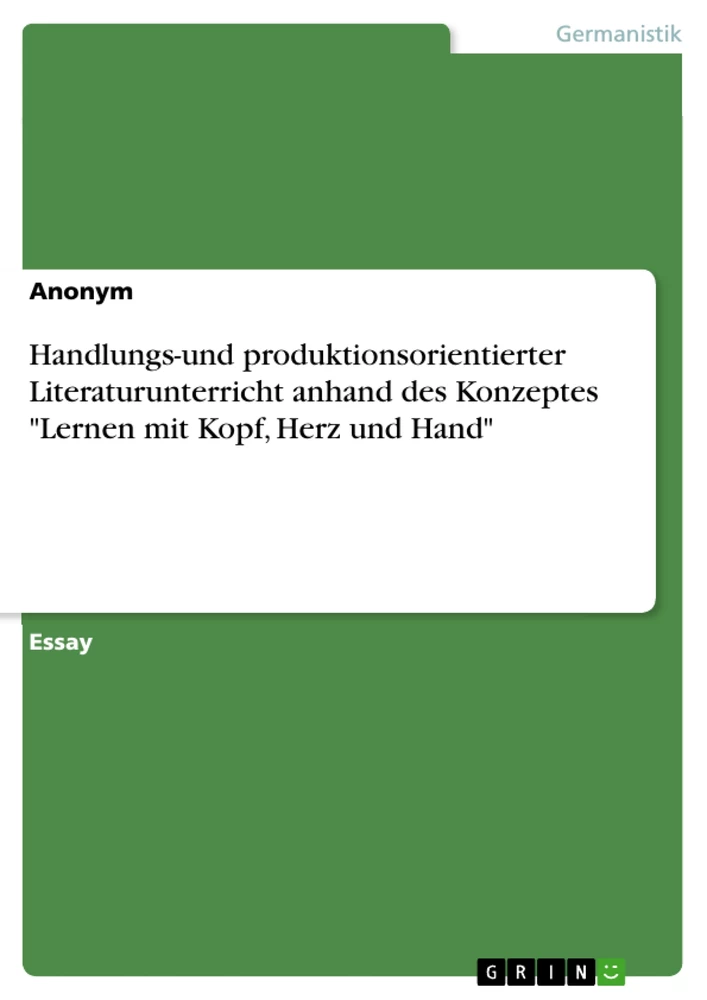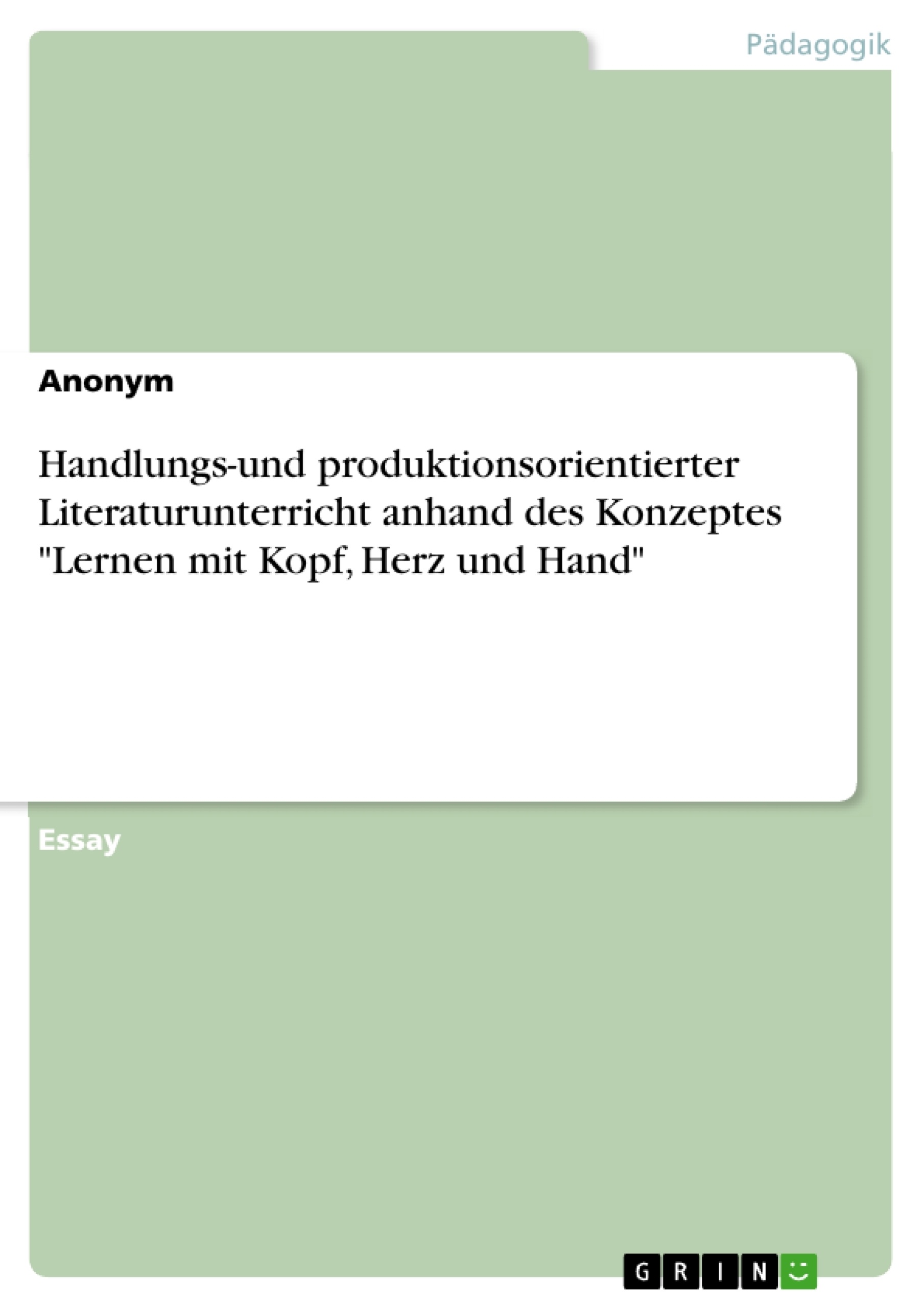Das Prinzip des Pädagogen Johann Heinrich Pestalozzi "Lernen mit Kopf, Herz und Hand" beschreibt eines der bekanntesten reformpädagogischen Konzepte. Dieses Prinzip macht sich der handlungs- und produktionsorientierte Literaturunterricht zu eigen, der in den 80er Jahren als Weiterentwicklung und Ergänzung des bisher hauptsächlich analytischen Literaturunterrichts entstanden ist. Dieser Ansatz will die SuS dazu anzuregen sich aktiv mit literarischen Texten zu beschäftigen, um in Zeiten der Technisierung die Literatur wieder interessant zu machen und die Lesebereitschaft zu fördern.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ausgangspunkte und Zielsetzung
- Parallelen zum außerschulischen Umgang mit Künsten
- Methodische Grundtypen
- Kritische Auseinandersetzung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Abhandlung untersucht den handlungs- und produktionsorientierten Literaturunterricht, seine Ausgangspunkte, methodischen Ansätze und kritischen Aspekte. Sie beleuchtet die Weiterentwicklung gegenüber dem analytischen Ansatz und zeigt dessen Zielsetzung auf, die Lesebereitschaft zu fördern und die Literatur für Schüler*innen in Zeiten der Technisierung wieder attraktiv zu gestalten.
- Praktisches und produktives Lernen ("Learning by Doing") im Literaturunterricht
- Parallelen zum außerschulischen Umgang mit Künsten (Restauration, Transformation, Inszenierung)
- Methodische Grundtypen: Vom Fragment zum Text, Vom Original zur Transformation
- Kritik am rein analytischen Literaturunterricht und dessen Auswirkungen auf die Lesemotivation
- Individualisierung und Differenzierung im Literaturunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt den handlungs- und produktionsorientierten Literaturunterricht als Weiterentwicklung des analytischen Ansatzes vor und benennt dessen Hauptvertreter (Haas, Menzel, Spinner). Sie skizziert den Aufbau der Abhandlung, der sich mit den Ausgangspunkten, Parallelen zum außerschulischen Umgang mit Künsten, methodischen Grundtypen und einer kritischen Auseinandersetzung befasst.
Ausgangspunkte: Dieses Kapitel betont das „Learning by Doing“ als zentralen Ansatz. Die Schüler*innen sollen aktiv mit literarischen Texten umgehen, sie nicht nur analysieren, sondern auch umformen, darstellen und neue Texte generieren. Analytische Prozesse werden nicht ausgeschlossen, sondern an handlungs- und produktionsorientierte Verfahren angeschlossen. Kritisiert wird der rein analytische Ansatz, der das Interesse an Literatur mindern kann, da er die eigenen Vorstellungen und Erfahrungen der Schüler*innen vernachlässigt. Der handlungs- und produktionsorientierte Ansatz hingegen fördert die Autonomie der Schüler*innen und berücksichtigt unterschiedliche Lerntypen, um Benachteiligungen entgegenzuwirken.
Parallelen zum außerschulischen Umgang mit Künsten: Dieses Kapitel beschreibt die Übernahme von Verfahren wie Restauration, Transformation und Inszenierung aus dem außerschulischen Umgang mit Künsten. Die Schüler*innen sollen Texte ergänzen, umgestalten und inszenieren, wodurch sie ein handwerkliches Verhältnis zur Literatur entwickeln und gleichzeitig ihre eigenen Vorstellungen einbringen können. Beispiele hierfür sind das Vervollständigen von Textfragmenten, das Erstellen von Analogiegedichten oder die szenische Darstellung von Texten. Der Bezug zum Original bleibt dabei stets erhalten.
Methodische Grundtypen: Das Kapitel stellt zwei methodische Grundtypen vor: „Vom Fragment zum Text“ und „Vom Original zur Transformation“. Bei der ersten Methode vervollständigen die Schüler*innen einen unvollständigen Text, was die Auseinandersetzung mit der Textstruktur fördert und die Interpretation erleichtert. Die zweite Methode beinhaltet das Erstellen eines Analogietextes zum Original, was einen persönlichen Zugang zum Text ermöglicht. Beide Methoden verbinden handlungs- und produktionsorientiertes Arbeiten mit analytischen Prozessen.
Schlüsselwörter
Handlungsorientierter Literaturunterricht, Produktionsorientierter Literaturunterricht, "Learning by Doing", Lesemotivation, analytischer Literaturunterricht, kreative Textumgestaltung, Individualisierung, Differenzierung, Restauration, Transformation, Inszenierung, Analogietext.
Häufig gestellte Fragen zum handlungs- und produktionsorientierten Literaturunterricht
Was ist der Gegenstand dieser Abhandlung?
Diese Abhandlung untersucht den handlungs- und produktionsorientierten Literaturunterricht. Sie beleuchtet dessen Ausgangspunkte, methodische Ansätze und kritische Aspekte im Vergleich zum traditionellen, analytischen Ansatz. Ein Schwerpunkt liegt auf der Förderung der Lesemotivation und der Attraktivität von Literatur für Schüler*innen im digitalen Zeitalter.
Welche Ziele werden mit dem handlungs- und produktionsorientierten Literaturunterricht verfolgt?
Das Hauptziel ist die Förderung der Lesebereitschaft und die Steigerung der Attraktivität von Literatur für Schüler*innen. Dies wird durch aktives, produktives Lernen ("Learning by Doing") erreicht. Schüler*innen sollen literarische Texte nicht nur analysieren, sondern auch aktiv umformen, darstellen und neue Texte daraus generieren. Der Ansatz zielt auch auf Individualisierung und Differenzierung im Unterricht ab, um Benachteiligungen entgegenzuwirken.
Welche methodischen Ansätze werden beschrieben?
Die Abhandlung beschreibt zwei methodische Grundtypen: "Vom Fragment zum Text" und "Vom Original zur Transformation". "Vom Fragment zum Text" fordert Schüler*innen auf, unvollständige Texte zu vervollständigen, um die Textstruktur zu verstehen und die Interpretation zu erleichtern. "Vom Original zur Transformation" beinhaltet das Erstellen von Analogietexten zum Original, was einen persönlichen Zugang zum Text ermöglicht. Beide Methoden verbinden handlungs- und produktionsorientiertes Arbeiten mit analytischen Prozessen.
Welche Parallelen zum außerschulischen Umgang mit Künsten werden gezogen?
Die Abhandlung zeigt Parallelen zwischen dem handlungs- und produktionsorientierten Literaturunterricht und dem außerschulischen Umgang mit Künsten auf, insbesondere die Verfahren der Restauration, Transformation und Inszenierung. Schüler*innen sollen Texte ergänzen, umgestalten und inszenieren, um ein handwerkliches Verhältnis zur Literatur zu entwickeln und ihre eigenen Vorstellungen einzubringen. Beispiele sind das Vervollständigen von Fragmenten, das Erstellen von Analogiegedichten oder die szenische Darstellung von Texten.
Welche Kritik am rein analytischen Literaturunterricht wird geübt?
Der rein analytische Literaturunterricht wird kritisiert, weil er das Interesse an Literatur mindern kann, da er die eigenen Vorstellungen und Erfahrungen der Schüler*innen vernachlässigt. Der handlungs- und produktionsorientierte Ansatz hingegen fördert die Autonomie der Schüler*innen und berücksichtigt unterschiedliche Lerntypen.
Welche Schlüsselbegriffe sind zentral für das Verständnis des Ansatzes?
Zentrale Schlüsselbegriffe sind: Handlungsorientierter Literaturunterricht, Produktionsorientierter Literaturunterricht, "Learning by Doing", Lesemotivation, analytischer Literaturunterricht, kreative Textumgestaltung, Individualisierung, Differenzierung, Restauration, Transformation, Inszenierung und Analogietext.
Welche Kapitel umfasst die Abhandlung?
Die Abhandlung umfasst eine Einleitung, ein Kapitel zu den Ausgangspunkten, ein Kapitel zu Parallelen zum außerschulischen Umgang mit Künsten, ein Kapitel zu methodischen Grundtypen und ein Kapitel zur kritischen Auseinandersetzung mit dem Ansatz.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2016, Handlungs-und produktionsorientierter Literaturunterricht anhand des Konzeptes "Lernen mit Kopf, Herz und Hand", Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/424022