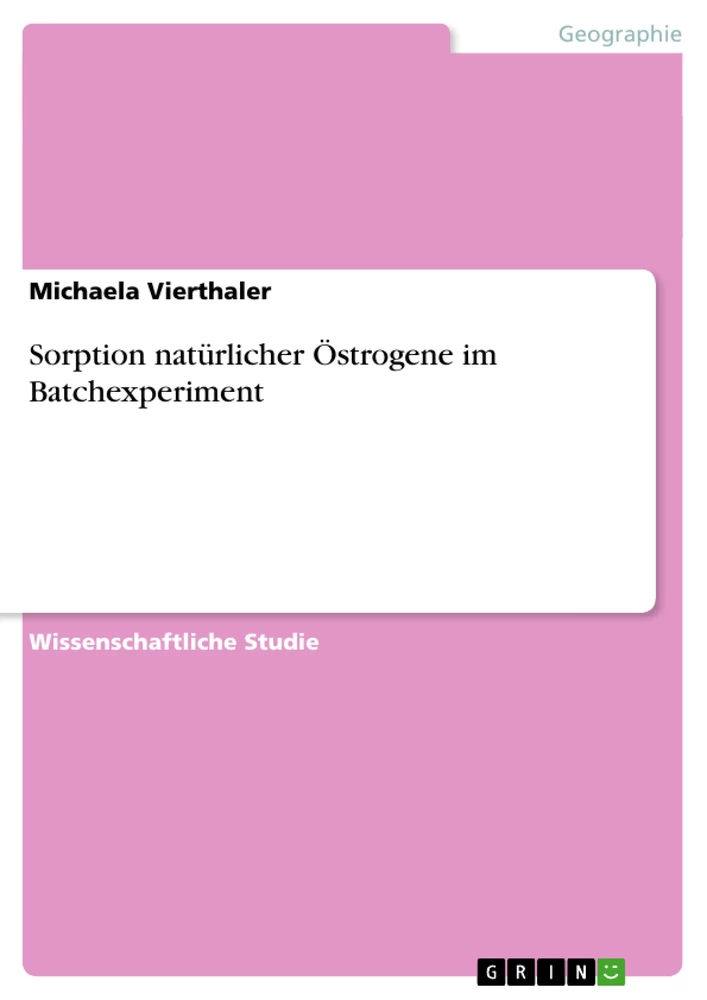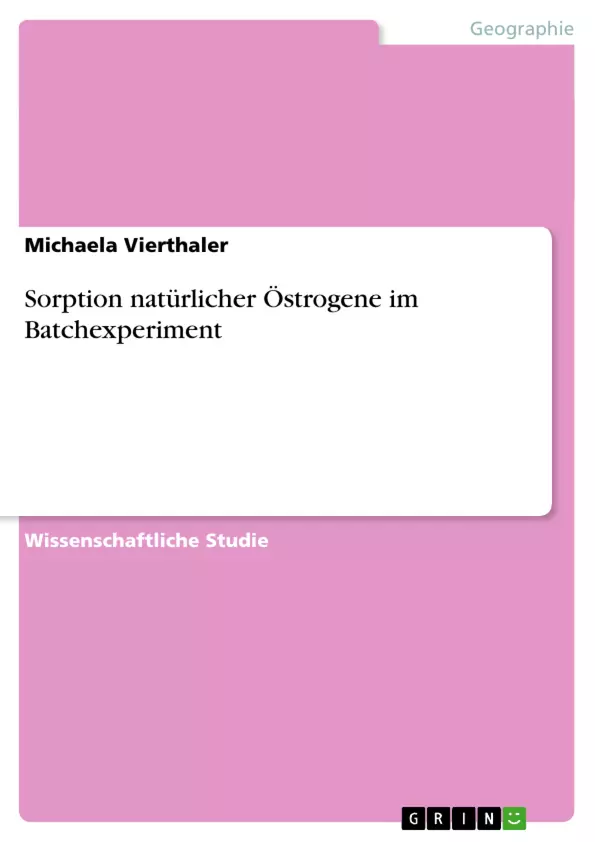Einleitung
Hormone menschlichen oder tierischen Ursprunges gelangten tausende von Jahren mit steigender Tendenz durch Populationswachstum und intensivere Landnutzung in die Umwelt. Eine Verbindung zwischen ihnen und nachteiligen Effekten auf die Tierwelt und Menschheit wurde jedoch nie erkannt. Hormone können über mehrere Wege in die Umwelt gelangen: durch die Landwirtschaft in Form von Pestiziden, Wirtschafts- und Sekundärrohstoffdünger (z.B. natürliche Östrogene, Mastförderer), durch Industrie- und Siedlungsabfälle. Gelangen sie über das Sickerwasser ins Grundwasser oder in Oberflächengewässer, können sie dort in Wirkmengen von wenigen ng/l z.B. eine Verweiblichung der Fischpopulation verursachen [1, 2]. Beim Menschen kann die Freisetzung der Hormone in die Umwelt zu einer Senkung der Spermazahl, zu einem Anstieg von Hoden-, Prostata- und Brustkrebs und zu Reproduktionsstörungen bei Männern führen [3].
Ein Problem ist die Vielzahl der Substanzen, die als endokrine Disruptoren wirken können. Sowohl Pestizide, Kosmetika, Medikamente, Farben etc. aber auch natürliche Steroide gehören dazu, wenn sie ungezielt in die Umwelt gelangen. Sie wirken unterschiedlich: die einen lösen aufgrund von Strukturähnlichkeiten zu bestimmten Hormonen im Organismus diejenigen Reaktionen aus, für die die entsprechenden Hormone zuständig wären, andere docken an Hormonrezeptoren an und verhindern so deren Wirkung, während eine dritte Kategorie Synthese, Transport oder Ausscheidung von Hormonen blockiert.
Diese Arbeit steht vor dem Hintergrund, dass jährlich etwa 2,4 g Gesamtöstrogenen pro Hektar mit Milchviehgülle auf landwirtschaftlich genutzte Flächen ausgebracht werden.
Anhand von Batchexperimenten (Schüttelversuchen) soll geklärt werden, ob und wie schnell natürliche Östrogene an Bodenmaterial gebunden werden können. Die Ergebnisse liefern Hinweise auf das Umweltgefährdungspotential, wie z.B. die Gefährdung des Grundwassers durch Auswaschung nicht retardierter und/oder abgebauter Östrogene.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Material und Methoden
- Chemikalien
- Bodenmaterial
- Batchexperimente
- Bestimmung der Östrogene
- Probenaufbereitung
- GC-MS Messmethode
- Ergebnisse und Diskussion
- Batchlösungen
- Einzelbestimmungen
- Gemische
- Zusammenfassung und Schlussfolgerung
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit zielt darauf ab, das Sorptionsverhalten natürlicher Östrogene an Bodenmaterial zu untersuchen und die potenzielle Umweltgefährdung durch Auswaschung dieser Hormone zu beurteilen. Hierfür werden Batchexperimente durchgeführt, die Erkenntnisse über die Geschwindigkeit und Effizienz der Bindung von Östrogenen an Bodenpartikel liefern.
- Sorptionsverhalten von natürlichen Östrogenen an Bodenmaterial
- Potenzielles Umweltgefährdungspotential durch Auswaschung von Östrogenen
- Einfluss von Bodenparametern auf die Sorption von Östrogenen
- Untersuchung der Bindungsmechanismen von Östrogenen an Bodenbestandteile
- Relevanz der Ergebnisse für die Bewertung des Umweltrisikos von Östrogenen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Relevanz der Östrogenbelastung in der Umwelt dar, erläutert die Quellen und die möglichen negativen Auswirkungen auf Mensch und Tier. Die Notwendigkeit der Untersuchung von Sorptionsmechanismen im Boden wird hervorgehoben.
- Material & Methoden: Dieses Kapitel beschreibt die verwendeten Chemikalien, das Bodenmaterial und die Durchführung der Batchexperimente. Die Methoden zur Bestimmung der Östrogenkonzentrationen werden detailliert dargestellt.
- Ergebnisse und Diskussion: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Batchexperimente, analysiert die Sorptionseffizienz und -geschwindigkeit der Östrogene an Bodenmaterial. Unterschiede im Sorptionsverhalten der verschiedenen Östrogenformen werden diskutiert.
Schlüsselwörter
Natürliche Östrogene, Sorption, Batchexperimente, Bodenmaterial, Umweltgefährdung, Grundwasser, Östrogenkonzentrationen, GC-MS, Wiederfindung, Abbau, Bioverfügbarkeit.
- Arbeit zitieren
- Michaela Vierthaler (Autor:in), 2005, Sorption natürlicher Östrogene im Batchexperiment, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/42183