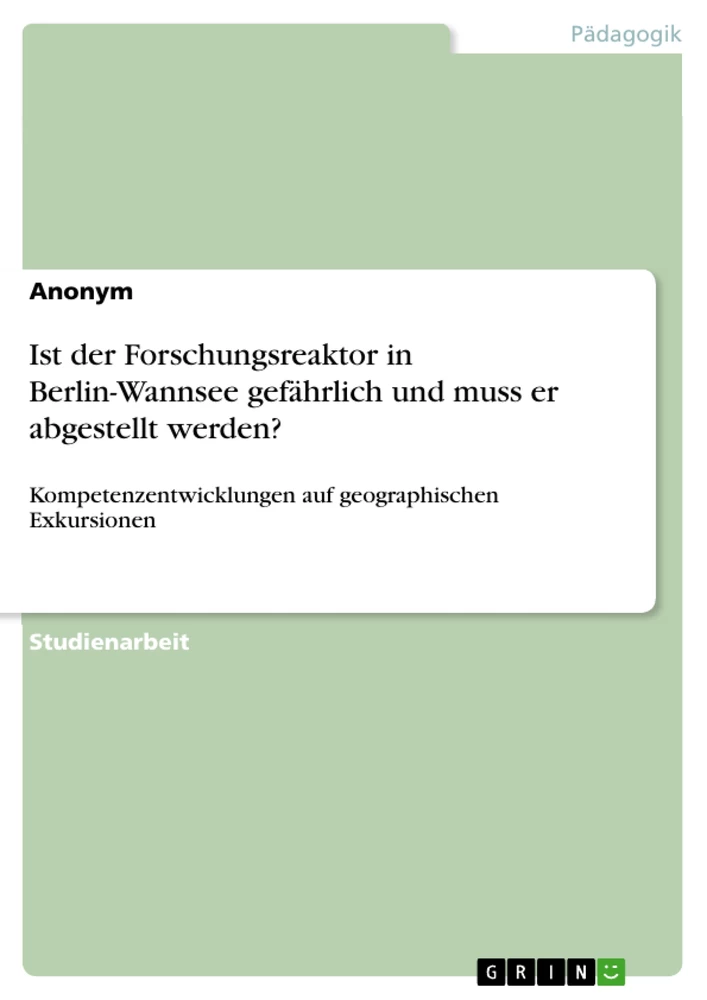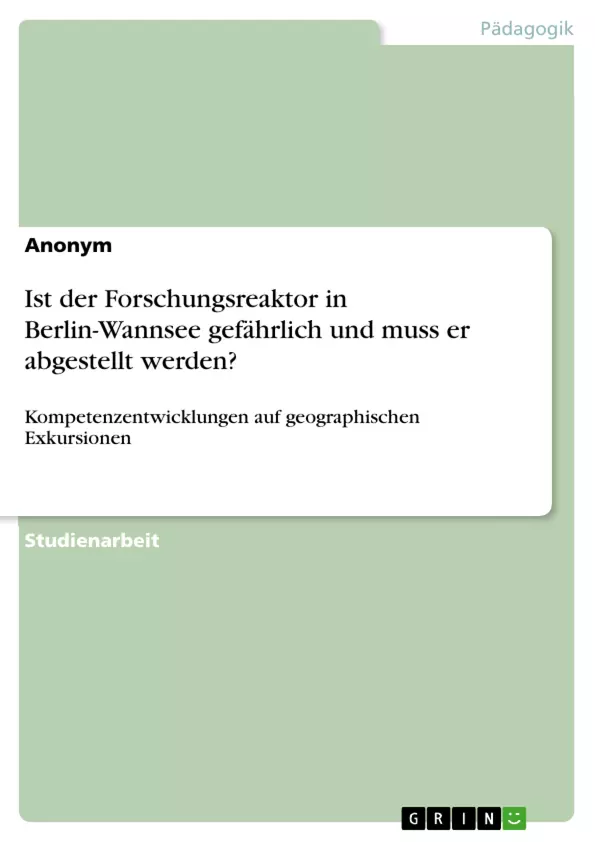Die deutsche Atompolitik ist in der Bundesregierung vom Dualismus schwarz-gelb und rot-grün geprägt. Legten diese den Ausstieg fest, so hebelten jene ihn wieder aus und beschlossen den „Ausstieg vom Ausstieg“. Der Begriff „Atompolitik“, der durch die Debatte um die atomare Bewaffnung der Bundeswehr in den 50er-Jahren meist anders verwendet und gedeutet wurde, versteht sich gegenwärtig als die Gesamtheit politischer Bestrebungen, sich mit der Kernenergie-Nutzung, sei es die Beendigung, die friedliche Nutzung oder die Begrenzung der Verbreitung (u.a. Atomwaffen), auseinanderzusetzen. Der langfristige Ausstieg aus der nuklearen Energieversorgung („Atomausstieg“) wurde ein zentraler Aspekt in der Politik, bis heute. In den Jahren 2000 und 2002 hatte die damalige rot-grüne Bundesregierung den Atomausstieg beschlossen. Es wurden Reststrommengen für jedes der 17 in Betrieb befindlichen Atomkraftwerke festgelegt, so dass sich eine Gesamtlaufzeit von etwa 32 Jahren nach Inbetriebnahme ergab. Im Herbst 2010 erwog die schwarz-gelbe Bundesregierung gegen den heftigen Widerstand der Opposition eine Verlängerung der Laufzeiten deutscher Atomkraftwerke um bis zu 28 Jahre.[...]
Die Diskussionen über die (atomare) Energieversorgung, Aussetzung der Laufzeitverlängerungen von Kernreaktoren, Atommüllzwischenlager, Risiken von Reaktorunglücken und Angst vor Terrorangriffen führten zu einem öffentlichen Diskurs der Atompolitik, an dem sich sowohl in Deutschland als auch international eine Vielzahl verschiedenster Akteure kritisch äußern. Eine Chance für angehende Lehrer/innen, dieses allgegenwärtige Thema jungen Menschen nahe zu bringen. Im Rahmen schulischen Unterrichts könnten die Schülerinnen und Schüler eine offene Diskussion über diesen gesellschaftspolitischen Diskurs führen und sachliche sowie wertbezogene Argumente austauschen (z.B.: „Ist die Aussetzung der Laufzeitverlängerung nur ein wahltaktisches Manöver?“).
[...]
Dabei weckte das Helmholtz-Zentrum Berlin (HZB) mit dem Forschungsreaktor BERII das Interesse unserer „Arbeit im Gelände“. Der Forschungsreaktor BERII ist mit den Atomreaktoren von Tschernobyl und Fukushima bis auf die Leistung (50KW versus 1500MW) vergleichbar, liegt in unmittelbarer Nähe zu Potsdam (in Berlin-Wannsee) und sorgt für mediale Brisanz („Wegen Forschungsreaktor: Gericht kippt Flugroute für Pannen-Airport“). Überdies ist der Forschungsreaktor BERII sowohl im studentischen Umfeld als auch einem Großteil der Anwohnerschaft Potsdams unbekannt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Planung der Exkursion
- Durchführung der Exkursion
- Theorie: Exkursionskonzepte und Exkursionsmethoden
- Praxis: Durchführung der Exkursion im HZB
- Praktische Umsetzung im Schulbetrieb
- Reflexion der Exkursion
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beleuchtet die Entwicklung von Kompetenzen auf geographischen Exkursionen am Beispiel einer Exkursion zum Forschungsreaktor BERII in Berlin-Wannsee. Die Arbeit zielt darauf ab, eine schüler- und problemorientierte Exkursion zu konzipieren, die sich an den Prinzipien der wissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung orientiert.
- Kompetenzentwicklung durch geographische Exkursionen
- Die Rolle von Exkursionen im Geographieunterricht
- Die Problematik der Atompolitik und des Forschungsreaktors BERII
- Wissenschaftliche Erkenntnisgewinnung im Kontext der Exkursion
- Praktische Umsetzung von Exkursionskonzepten im Schulbetrieb
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit und die Relevanz des Themas „Atompolitik“ im Geographieunterricht dar. Die Arbeit setzt sich mit der deutschen Atompolitik auseinander, die durch den „Ausstieg vom Ausstieg“ geprägt ist. Die Einleitung beleuchtet die Geschichte der deutschen Atompolitik und die mediale Aufmerksamkeit, die die Reaktorunglücke in Tschernobyl und Fukushima erregten. Die Arbeit betont die Wichtigkeit, das Thema Atompolitik im Unterricht zu behandeln, um Schülerinnen und Schüler für diesen gesellschaftspolitischen Diskurs zu sensibilisieren.
Hauptteil
Planung der Exkursion
Der Hauptteil der Arbeit konzentriert sich auf die Planung der Exkursion zum Forschungsreaktor BERII. Er erklärt den Grundgedanken, der zur Planung der Exkursion führte und skizziert das Schema „From the basic idea to the actual fieldwork“, das zur Strukturierung der Exkursion dient. Der Fokus der Exkursion liegt auf der Untersuchung der Atompolitik auf lokaler, nationaler und globaler Ebene.
Durchführung der Exkursion
Dieser Abschnitt der Arbeit widmet sich der Durchführung der Exkursion zum HZB. Er präsentiert die Exkursionskonzepte und -methoden, die während der Exkursion angewandt wurden. Die Arbeit erläutert die praktische Umsetzung der Exkursion im HZB und diskutiert die Herausforderungen der praktischen Umsetzung im Schulbetrieb.
Reflexion der Exkursion
In diesem Abschnitt werden die Reflexionen der Exkursionsteilnehmer, die zugleich allesamt angehende Lehrer/innen sind, mitberücksichtigt. Die Arbeit beleuchtet die Learnings aus der Exkursion und die Bedeutung für die praktische Anwendung im Unterricht.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Arbeit sind Kompetenzentwicklung, Geographiedidaktik, Exkursionsdidaktik, Atompolitik, Forschungsreaktor BERII, Berlin-Wannsee, wissenschaftliche Erkenntnisgewinnung, problemorientierte Arbeitsexkursion und praktische Umsetzung im Schulbetrieb.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2013, Ist der Forschungsreaktor in Berlin-Wannsee gefährlich und muss er abgestellt werden?, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/419290